| Home | Bücher | News⭐ | Über uns |
Dietrichsage
Deutsche Überarbeitung nach dem Text von Wilhelm Wägner (1878/1882) mit vielen Abbildungen
Ausgabe:
Inhaltsverzeichnis
Nibelungensage und Nibelungenlied
Hugdietrichsage
Dietrichsage
Samson als erster großer König der AmelungenHageling- und Gudrunsage
Dietrichs Kindheit und Jugend
Die Hochzeit mit Virginal
Die Kampfgesellen Heime und Wittich
Die Geschichte von Seeburg, Ecke und Fasolt
Die Gesellen Wildeber, Ilsan und Dietleib
Zwergenkönig Laurin und sein Rosengarten
Mönch Ilsan und Kriemhilds Rosengarten
Die Heerfahrten für Etzel und Ermenrich
Der Fall von Kaiser Ermenrich
Über die Herrschaft von König Etzel
Die Raben- oder Ravenschlacht
Rückkehr zu Etzel und Nibelungenschlacht
Dietrichs Sieg und Kaiserkrönung
Beowulf-Sage
Quellenverzeichnis
Dietrichsage
Samson als erster großer König der Amelungen
In der reichen Stadt Salerno (im Süden Italiens) herrschte in alter Zeit der mächtige König Rodger (oder Rodgeir), dem ein großes Reich untertan war. Er sorgte dafür, dass Handel und Gewerbe, insbesondere der Ackerbau, ungestört betrieben wurden, so dass Land und Leute zu Wohlstand gelangten. Denn er wusste, wenn Bürger und Bauern volle Säckel haben, dann ist auch der Schatz des Königs reichlich gefüllt. Dank seines Reichtums war der König in der Lage, ein stattliches Heer zu unterhalten, dessen er in der damaligen unruhigen Zeit wohl bedurfte. Es landeten nämlich oft zahlreiche Scharen von Raubfahrern an der Küste, und zu Land fielen feindliche Herrscher ein, um mit Brand, Raub und Mord das friedliche Volk zu schädigen. Doch da war der König gleich zur Stelle, und die Feinde trugen statt des Raubes blutige, zerschlagene Schädel davon. Der mächtige König hatte in seinem Gefolge einen Recken, der nach seinem kohlschwarzen Haar und Bart Samson, der Schwarze, genannt wurde. Er war in allen Gefechten voran und schlug allein oft ganze Heerhaufen in die Flucht. Schon sein Anblick war furchtbar, seine dunklen Augen glühten unter schwarzen Brauen, die wie zwei Raben darüber saßen, sein mächtiger Stiernacken und seine gewaltigen Glieder zeugten von der Stärke, die ihm eigen war. Wenn er im Kampfgetümmel gegen die Feinde zog, dann bestand kein Krieger vor seinen Schwertschlägen. Er zerhieb die Rüstungen und Leiber der Männer, als ob sie morsches Holz wären. Dennoch prahlte er nicht mit seinen Taten, und wenn die Sprache darauf kam, versuchte er auszuweichen. Wer ihm freundschaftlich entgegenkam, dem begegnete auch er trotz seines grimmigen Aussehens mitfühlend, wohlwollend, weise und freigiebig. Allerdings durfte man seinen Entschlüssen nicht entgegentreten, denn er pflegte dann wohl zu schweigen, aber er führte sein Vorhaben mit oder gegen den Willen anderer aus, unbekümmert um den Schaden, der daraus entstand. Deswegen wagte man selten Widerspruch gegen den gewalttätigen Mann.
Einstmals saß nach einem großen Sieg der mächtige König beim fröhlichen Gelage, seine Recken um ihn her, unter denen sich auch Samson befand. Dieser erhob sich, nahm dem Mundschenk den goldenen Becher des Königs aus der Hand, füllte ihn mit Wein und bot ihn vortretend dem ruhmreichen Herrscher. „Herr“, sagte er mit geziemender Sitte, „manchen Sieg habe ich dir erstritten und biete dir nun diesen Trank, auf dass du mir eine Bitte gewährst.” - „Sag an, tapferer Held“, erwiderte der König, „was dein Begehr ist. Bisher hast du für deine guten Dienste nichts verlangt, und ich habe dir Burgen und Landsitze freiwillig verliehen. Wenn du nun einen Hof und anderes Gut, was es auch sei, begehrst, werde ich es dir nicht verweigern.“ - „Guter Herr“, sprach Samson, „es sind nicht Burgen und Höfe, die mein Herz begehrt, denn damit hast du mich reich gemacht. Doch ich bin sehr einsam in meinem Hauswesen, da meine Mutter alt und grämlich ist. Du hast nun ein holdseliges Töchterlein, die goldgelockte Hildeswind, die möchte ich gern zur Hausfrau haben, und es würde mich sehr erfreuen, wenn du mir diese Bitte gewähren wolltest.“ Auf diese Rede wäre dem König vor Schrecken fast der Becher aus der Hand gefallen. Denn er liebte seine Tochter als sein einziges Kind über alles, zumal sie auch die schönste und weiseste der edlen Jungfrauen war, die jeder gern gewinnen wollte. So sprach er ausweichend: „Du bist zwar ein sehr tüchtiger Held, aber die Jungfrau ist von königlichem Geblüt. Nur ein König sollte sie heimführen, um mein Erbe und Nachfolger zu werden. Doch du bist zu meinem und ihrem Dienst bestellt. Nimm daher diese Schüssel mit Gebäck und trage sie zu ihr ins Frauenhaus. Dann kehre wieder hierher zurück und vergiss beim kreisenden Becher, was ich dir nicht gewähren kann.“
Samson nahm schweigend die leckere Kost und brachte sie der schönen Jungfrau, die mit ihren Mägden Stickereien verfertigte. Er setzte das Gebäck vor sie hin, indem er sagte: „Für dich, gute Maid, und dazu bringe ich dir auch frohe Botschaft. Du sollst mir in meine Wohnung folgen und als meine Hausfrau darin walten. Nimm deine Gewänder, und lass eine der Mägde mit dir gehen!“ Als die Jungfrau erschrocken zögerte, fügte er hinzu: „Wenn du mir nicht guten Willen trägst, dann muss der König sterben und der Palast mit aller Dienerschaft verbrennen.“ Er sah bei dieser Rede so finster und grimmig aus, dass Hildeswind vor Furcht zitterte und ohne Widerspruch folgeleistete. Dann nahm er sie bei der Hand und führte sie hinunter in den Hof, wo sein Knecht die Pferde des furchtbaren Recken bereithielt. Am hellen Tag und in Gegenwart vieler Wächter, die keinen Widerstand wagten, führte der gefürchtete Mann die Königstochter aus der Burg Salerno und immer weiter in einen öden Wald, wo er sich schon vor langer Zeit ein geräumiges Haus erbaut hatte.
Das Tor war verschlossen. Er pochte zweimal und dreimal so gewaltig, dass es durch den Wald schallte. Da rief eine heisere Stimme von innen, das Tor werde nicht aufgetan, dieweil der Eigner des Hauses auswärts am Königshof sei. „Mutter!“, rief er: „Schiebe die Eisenriegel zurück! Ich bin es selbst, dein Söhnchen, und führe dir ein Töchterlein zu, ein Königskind, das dir in deinem Alter behilflich sein soll.“ Sofort wurden die Riegel zurückgeschoben, und die Pforte öffnete sich knarrend. Da stand nun eine alte, hagere Frau in Bettlerlumpen vor den Ankömmlingen, die sie grämlich empfing. „He!“, rief sie, „Du bringst Gäste? Eine Frau in Putz und Hoffart, ihre Magd und einen faulen Knecht? Du kennst doch unsere Armut, Söhnchen!“ Sie blickte bei diesen Worten fast schon grimmig zu dem baumhohen Söhnchen empor. „Mutter“, sprach der Recke, „wo ist das Gold, das ich dir gesandt habe? Wo sind die tüchtigen Gesellen, die ich zu deinem Dienst bestellte? Wo die schmuckreichen Gewänder, womit du dich kleiden solltest?“ - „Das Gold habe ich in meiner Truhe geborgen“, versetzte die Alte, „man weiß ja nicht, wie man im Alter darben muss. Die Gesellen, die den ganzen Tag schmausten und zechten und alle Vorräte aufzehrten, habe ich hinausgetrieben, die Gewänder aber für bessere Zeiten aufbewahrt.“ - „He, Mutter“, sagte Samson, „das ist deine Weise. Doch nun laß uns eintreten und verschaffe uns gute Kost, denn wir sind weit geritten.“

Die Gäste traten in das Haus und saßen bald an der Tafel, aber die Kost, welche die Frau reichte, war nur schwarzes schimmliges Brot und der Trunk trübes Wasser, was dem Recken schlechte Labung deuchte. Indessen schaffte sein Knecht Rat, denn er führte ein feistes Hüftenstück von einem Hirsch mit sich und einen mächtigen Schlauch Wein. Nachdem sie gespeist hatten, verabschiedete sich Samson von seiner Hausfrau, um in den Wald zu reiten und ein Wild zu erlegen, während der Knecht den Keller durchsuchte und glücklich noch ein Fass guten Lagerweins vorfand. Auch die alte Mutter hatte sich entfernt, und Hildeswind sah sich mit ihrer Magd allein in der weiten Halle. Es wurde ihr gar unheimlich und schauerlich zumute, als der Abend anbrach und im Tann die Eulen riefen. Sie gebot der Dienerin, die alte Frau aufzusuchen und wieder in die Halle zu führen, aber auch diese kam nicht wieder. Nun machte sie sich selbst auf den Weg, durchirrte viele Gemächer und fand endlich die Frau in einer entlegenen Kammer vor einer großen geöffneten Truhe sitzen. Beim Schein einer Lampe, welche den Raum nur spärlich erleuchtete, bemerkte Hildeswind, dass in der Kiste Gold glänzte. Die Alte zählte Byzantiner, Dukaten und Dublonen, ohne ein Ende zu finden. „Wie mein liebster Schatz leuchtet!“, murmelte das Weib, „Wie er lacht, als wolle er mir etwas Freudiges sagen! Ja, er will wachsen, und dafür ist das Königskind bei mir eingekehrt, das reiche Schätze mit sich führt. Wenn man ihr nur die Kehle zuschnürte! He, bald geschehen, Goldpuppe!“ Die junge Königstochter stieß vor Schreck einen Schrei aus. Da sprang die Alte auf und rief: „Diebin! Räuberin! Verfluchte!“ Sie erhaschte die Unglückliche, die laut aufschrie, und versuchte, sie zu erdrosseln. Doch da erschien plötzlich Samson und stillte den Streit. „Mutter“, sagte er, „du kannst hier nicht bleiben. Am Waldesrand habe ich, wie du weißt, ein anderes Haus. Dahin führe ich dich mit dem Schatz, den du gesammelt hast.“ Er tat nach seinen Worten, und die Alte wagte keinen Widerspruch.
Mittlerweile hatte König Rodger die Geschichte erfahren, wie seine Tochter geraubt worden war. Er bot daher seine Mannen auf, dem Räuber nachzujagen. Da sie aber den Recken nicht einholen konnten, ließ er dessen Höfe und Burgen mit Feuer überschütten, sein Vieh und was ihm sonst eigen war, nach Salerno fortführen, und verhieß viel rotes Gold dem, der dem kühnen Recken das Haupt abschlage und dasselbe ihm bringe. Als Samson davon erfuhr, ritt er gewappnet aus dem Wald, erschlug manchen Kriegsmann, raubte viel Königsgut und verbrannte dessen Burgen und Höfe. Darauf zog König Rodger selbst mit vielen Mannen aus, den Recken zu ergreifen. Er verteilte das Heer in einzelne Haufen, um alle Wege und Wälder zu durchspähen. So kam er auch mit fünfzehn Recken zu einer alten Frau, die am Rande des Waldes in einem kleinen Haus wohnte. Er forschte bei ihr nach Samson, aber sie gab vor, den Mann nicht zu kennen. Als er ihr darauf rotes Gold auf einer Holztafel darbot und mehr und immer mehr hinzufügte, wurde ihre Zunge gelöst, sie redete viel von der Stärke des Recken, und wie er wohl jetzt in seiner Behausung sei, wohin ein verschlungener Weg führe. Sie ging sogar eine Strecke mit, damit sich die Männer nicht verirrten.
Der König war mit seinem Gefolge noch nicht weit in den wilden Tann geritten, da kam ihm schon der furchtbare Held entgegen. Schwarz waren sein Helm und seine Rüstung, wie Bart und Haar, schwarz auch sein gewaltiger Streithengst, aber auf dem Schild führte er einen goldenen Löwen. Ohne ein Wort zu sprechen, rannte er gegen das Geschwader und durchbohrte den vordersten Reiter mit der Lanze, während dessen Speer von seinem Schild abglitt. Ein zweiter Kämpfer hieb ihm auf den Helm, dass der Kegel zerbrach, aber er spaltete ihn bis auf den Gürtel, und einen dritten hieb er in Stücke. Nun drang König Rodger vor, begierig, seine Männer zu rächen, doch obwohl sein Schwertstreich dem Gegner durch Schild und Rüstung drang, sank er bald mit gespaltenem Haupt vom Ross. Denn keine Rüstung schützte gegen das Schwert des Recken, und daher wendeten sich die Angreifer zur Flucht, unterlagen jedoch alle bis auf einen dem zornigen Verfolger. Dieser sah recht grimmig aus, wie er sich am Ausgang des Waldes seitwärts nach dem einsamen Haus wandte und alsbald vor der greisen Frau stand, welche den König zurechtgewiesen hatte. Sie war emsig beschäftigt, das empfangene Gold zu zählen. „Mutter“, sagte er, „für rotes Gold hast du deinen Sohn verraten! Darum begehrt mein Schwert dein Blut zu trinken.“ Er zog sein Schwert, stieß es aber wieder in die Scheide, indem er hinzufügte: „Weil du meine Mutter bist, soll das Schwert seinen Willen nicht haben.“ Die Frau zählte ruhig die Haufen Goldes weiter: „Einhundert, zwei, dreihundert…“ Er sah eine Weile zu, dann sprach er, sein Dolchmesser zückend: „Mutter, für rotes Gold hast du deinen Sohn verraten, darum begehrt mein Messer dein Blut zu trinken.“ Sie sagte weiterzählend: „Versuch es, wenn du kannst.“ - Er stieß auch das Messer zurück mit den Worten: „Weil du meine Mutter bist, soll es den Bluttrunk nicht haben. Aber nun stehe nicht länger auf diesem Boden. Zieh weit fort mit dem roten Gold, dass Schwert und Messer nicht wiederum zu trinken heischen.“ Die Frau raffte den Schatz eilends in einen Sack und sagte: „Hättest du nicht die zweite Frau in dein Haus genommen, so wäre auch dieser Schatz dein Eigen. Nun will ich ihn dem König wiederbringen, der wird mich beschützen.“ - „Den habe ich erschlagen“, versetzte Samson, „und dazu seine Mannen.“ Er sah bei diesen Worten höchst grimmig aus, und als sie ihn anblickte, erschrak die Frau und murmelte: „So will ich in die Fremde ziehen, um dafür einen Erben zu suchen, der mir Herberge gönnt.“ Damit entfernte sie sich eilends. Zum dritten Mal zuckte der zornige Mann und griff nach Schwert und Messer, und zum dritten Mal zog er seine Hand zurück. Dann bestieg er sein Ross und ritt in den finsteren Tann.
Er kam in seine Behausung, wo Hildeswind emsig waltete. „Die Mutter verriet mich für rotes Gold“, sagte er, „Schwert und Messer begehrten ihr Blut, doch ich habe sie in der Scheide festgehalten. Wenn du aber falsch bist, dann dürsten die Klingen noch immer.“ Er hatte wieder ein schreckliches Aussehen. Da nahm sie ihm Helm und Rüstung ab, küsste ihn und führte ihn zum Hochsitz. Nun war er sanft und freundlich und sagte, er wolle ihr Ruhm und Ehren verschaffen, sie solle Königin werden in ihres Vaters Reich.
Der Tod des Königs wurde in Salerno von dem entflohenen Dienstmann verkündigt. Da berief Brunstein, der Bruder von Rodger, die Landesherren zu einer Versammlung und ließ sich zum neuen König über das weite Reich krönen. Das Volk freute sich darüber, denn er war ein tüchtiger Held, klug im Rat und gerecht im Gericht. Daher wäre im ganzen Reich guter Frieden gewesen, wenn nicht Samson die Ruhe durch Raubfahrten gestört hätte. Das ertrug der tapfere Brunstein um so weniger, als auch das Blut seines erschlagenen Bruders noch ungerächt war. Er entbot die kühnsten Recken aus seinem Reich und aus den Nachbarländern, um den Raubfahrer zu züchtigen. Sie gelobten alle, denselben tot oder lebend zu überliefern oder selbst unter seinen Händen zu sterben. So zogen sie unter dem Banner des neuen Königs und von ihm geführt aus, durchstreiften Gebirge und Flachland, drangen auch in den Wald ein, aber sie fanden den Mann nicht, den sie suchten. Nach mehrtägiger Fahrt kehrten sie in einer festen Burg ein, wo sie sich beim vollen Becher berieten und dann, müde von der Tagfahrt, sich der Ruhe überließen. Auch die aufgestellten Wachen schliefen ein, denn die Nacht war sehr dunkel, und man dachte nicht an einen Überfall. Indessen kam Samson um Mitternacht an das Kastell. Er fand die Mauern fest und die Tore durch Riegel und Stangen verwahrt. Vor der Festung befand sich eine Hütte, worin arme Häusler wohnten. Er weckte die Leute, hieß sie mit ihrem Vieh und anderer Habe schleunigst ausziehen, und als dieselben, zitternd vor dem schrecklichen Recken, folgeleisteten, zündete er die Baracke an. Die Flammen schlugen alsbald empor. Er aber riss brennende Balken und was ihm in die Hände kam, heraus und warf sie mit seiner Riesenkraft über die Mauer in das Gehöft. Darin waren zum Teil Strohdächer, die sogleich Feuer fingen und den Brand weiter verbreiteten. Die Wächter stießen alsbald in ihre Hörner, die Bestürzung und der Schrecken waren groß. Der König, die Recken sowie die Burgmannen wappneten sich und bestiegen ihre Rosse. Man glaubte, ein ganzes Heer habe die Burg erstürmt. Manche flohen ohne Waffen, manche ohne Gewand, alle versuchten, den Flammen und dem Schwert der vermeintlichen Feinde zu entkommen. Wie ein Nachtgespenst erschien der furchtbare Recke bald im Schein der lodernden Flammen, bald im nächtlichen Dunkel und erschlug die Flüchtlinge.
Der König entrann nur mit einem Gefolge von sechs Recken, die nicht von seiner Seite wichen. Er geriet in den wilden Tann, und als der Morgen anbrach, ritt er, des Weges unkundig, immer weiter. Gegen Mittag erreichte er einen geräumigen Hof und nahm darin Einkehr. In der Halle fand er die Hausfrau und erkannte in ihr die schöne Hildeswind, die Tochter seines Bruders. Er fragte nach Samson, und sie versicherte, derselbe sei ausgeritten. Da forderte er sie auf, den Raubfahrer zu verlassen und ihm nach Salerno zu folgen. Sie antwortete, dass sie das nicht wolle und auch nicht wage, weil ihr Ehemann sehr grimmig sei und sicherlich Rache nehmen werde. Sie riet dem Vaterbruder, eilends zurückzureiten und beschrieb ihm den Weg, der aus dem Wald führte. In der Tat fürchtete auch Brunstein in dem Tann einen Überfall und ritt mit seinem kleinen Gefolge den angedeuteten Weg.
Doch es war zu spät. Samson, der von der anderen Seite herkam, hatte die Feinde schon erspäht und schritt sogleich zum Angriff. Gegen seine furchtbaren Schläge half weder Mut noch menschliche Tapferkeit. Brunstein fiel im Kampf mit fünf seiner Recken. Den sechsten, der schwer verwundet war, trug sein gutes Ross aus dem Wald und in eine nahe Burg. Samson verfolgte ihn, wie er aber aus dem Tann hervortrabte, sah er zwölf Reiter im eiligen Galopp auf sich zukommen. Sie führten auf ihrem Banner einen goldenen Löwen. „Hei!“, rief er: „Das sind Amelungen. Sei gottwillkommen, Onkel Dietmar, mit deinen Söhnen und Mannen!“ So begrüßte der Recke die befreundeten Helden und nahm sie mit in seine Herberge, wo die Hausfrau für reichliche Bewirtung sorgte. Dietmar berichtete nun, er habe erfahren, dass Samson friedlos und in Not sei, und habe sich aufgemacht, ihm Hilfe zu bringen. „Wohlgetan!“, sagte der Recke: „Nun, schöne Hildeswind, mache ich wahr, was ich dir verheißen haben. Denn mit solchen Helfern gedenke ich nicht mehr mich heimlich zu halten, sondern wir verlassen den Tann und erobern Burgen und Städte. Wir wollen doch sehen, wo die kühnen Helden sind, die uns bestehen.“ - Er tat nach seinen Worten. Da wagte kein Burgherr, ihm entgegenzureiten. Jeder öffnete lieber freiwillig die Tore, um vor ihm Gnade zu finden. So gewann er weite Landstriche und nannte sich Herzog. Darauf rückte er nach Salerno und schickte Boten voraus, die verkündigten, die Bürger sollten ihn zum König erwählen und ihm Gehorsam geloben, sonst werde er die Stadt mit Feuer überschütten und gänzlich zerstören. Als die Stadtherren über den Antrag berieten, sagte der Stadtmeister, solange Herzog Samson ihr Freund gewesen war, habe er sie vor aller Schädigung behütet. Seitdem er aber mit ihnen in Feindschaft lebe, habe er ihnen den größten Schaden zugefügt. Es werde daher zur Gemeinwohlfahrt gereichen, wenn man ihm das Königtum zuteile. Die Herren urteilten, das sei wohlgeraten und dem allgemein Besten förderlich. Der Beschluss wurde dem Recken geziemend hinterbracht, und er nahm ihn mit großer Gnade an. Als er nun mit seinen Heermannen den Einzug halten wollte, ließ er auch seine Hausfrau, die goldgelockte Hildeswind holen, und sie ritt in königlichem Schmuck an seiner Seite. Und das Volk, das ihn gerade noch verflucht und in die Hölle gewünscht hatte, rief: „Lange lebe König Samson! Heil und Segen dem heldenmütigen König!“
Der erwählte Herrscher verwaltete sein Amt mit unbeugsamer Strenge. Er übte Gerechtigkeit ohne Ansehen des Standes und Geschlechts. Man sang von ihm: „Kein Fürstenhaupt ist ihm zu stolz, kein Grafenschloss zu hoch.“ Er ermunterte und belohnte aber auch Treue und Tüchtigkeit. Mit manchem benachbarten König geriet er noch in Unfrieden, doch alle Fehden endigten zu seinem Vorteil. Saß er einmal im Sattel, dann ließ er nicht eher ab, bis der Gegner völlig zu Boden geworfen, tot oder zumindest zinspflichtig war. Sein furchtbares Schlachtschwert blitzte stets in den Vorderreihen und entschied den Sieg. Seine geliebte Frau Hildeswind hatte ihm drei Söhne geboren, die glücklich heranwuchsen. Der älteste hieß Ermenrich, der zweite Dietmar nach Samsons Onkel, und der dritte Diether. So vergingen viele Jahre, in denen im Reich Frieden herrschte, und König Samson war allmählich ein Greis geworden. Sein Sohn Ermenrich war zum kräftigen Mann und Dietmar zum blühenden Jüngling von achtzehn Jahren herangereift, und auch der zwölfjährige Diether wusste schon das Schwert zu führen. So geschah es eines Tages, dass zur Zeit des Sonnenwendfestes König Samson auf dem Thron saß, und vor ihm stand sein ältester Sohn Ermenrich, um seine Befehle entgegenzunehmen. Da sprach der alte König: „Ermenrich, du warst all die Zeit mein getreuer und willfähriger Sohn und Dienstmann. Nun will ich dir das Königtum übergeben in meinen römischen Landen, welche ich mir mit dem Schwert errungen habe, mit zwölf starken Burgen darin, so dass du dir dein Reich wohl beschirmen und noch weiter vergrößern kannst.“
Als dies der Jüngling Dietmar vernahm, trat er mit glühenden Wangen vor seinen Vater, verneigte sich und sprach: „Deinem Sohn Ermenrich hast du Königswürde und Reich gegeben. Auch ich bin stets treu bis auf diesen Tag mit deinen Rittern und Knappen ins Feld gezogen. Doch Ehren und Würden sind ungleich zwischen mir und meinem Bruder verteilt. Darum gib auch mir eine Herrschaft und einen Titel, nachdem du ihn zu einem so großen Mann gemacht hast.“ König Samson hörte die Rede, aber antwortete nicht, sondern blickte den Jüngling nur mit seinen durchdringenden Königsaugen ernst an. Da wurde Dietmar gewahr, dass er allzu keck gesprochen hatte, und ging mit gesenkten Blicken und schweigend zu seinem Sitz.
Samson aber bedachte in der Tiefe seines Herzens, dass der Jüngling doch Wahrheit gesprochen habe. Seine Bitte war eine gerechte, und Samson sann, wie er sie erfüllen könnte. Er überlegte geraume Zeit in der Stille, und eines Tages entbot er seine Fürsten und Vasallen zum Gastmahl in die große Halle seiner Burg. Da stand nun der greise Held mitten unter den Herrschern, von denen viele seine Kampfgenossen aus alter Zeit und gleich ihm ergraut waren, sowie andere noch jung an Jahren, und er sprach zu allen: „Unserer Herrschaft sind viele Länder untertänig, unsere Burgen erheben sich stolz und unbezwingbar durch starke Mauern, unsere Hallen glänzen von Marmorstein, bei unseren Mahlen perlt edler Wein in goldenen Bechern, und Frieden herrscht nun schon lange Zeit. Dagegen hat sich auch vieles verändert. Seht, dieses Haar und dieser Bart, einst schwarz wie ein Rabe, sind beide weiß wie eine Taube geworden. Dieser Arm, einst rötlich, von blauen Adern durchzogen, ist jetzt weiß, wie der Arm eines Mägdleins. So ist es auch meinen alten Wehrgenossen ergangen, und das kommt daher, dass wir alt geworden sind. Unsere einst starken Schilde sind zerborsten, unsere Schwerter, einst rot von Blut, sind rot von Rost, und rostig sind Helme und Rüstungen. Daran ist die lange Rast schuld, weil wir seit zwanzig Wintern das Rüstzeug nicht gebraucht haben. Darum ist auch das junge Volk in Weichlichkeit und Schwäche geraten, dass ihm die Waffen der Väter zu schwer dünken, dass man jetzt statt der starken Streithengste zahme, zierliche Traber begehrt, damit keine Feder auf dem Hut im schärfsten Rennen zerknittert werde. Das alles ist nicht nach meinem Sinn und Willen. Daher bestimme ich von heute an drei Monate. In dieser Frist sollen die Mauern der Burgen hergestellt, die Streithengste zugeritten, Helme und Rüstzeug gereinigt, die Schwerter geschliffen werden. Nach Ablauf der drei Monate finde sich jeder Recke mit seinen wohlgerüsteten Mannen hier in Salerno ein und trage ein mutiges Herz in der Brust, denn wir werden einen starken Feind zu bekämpfen haben.“ So gebot König Samson, und man wusste wohl, dass er nicht mit eitler Rede loses Spiel trieb.
Noch am selben Tag, da der greise Herrscher dieses Gebot erließ, schrieb er einen Brief an den stolzen König Elsung zu Bern (Verona), der mit ihm gleichen Alters war und sich auch gleicher Ehren erfreute. Er schrieb: „Der großmächtige König Samson entbietet dem mächtigen König Elsung seinen Gruß. Bisher hast du weder Schatzung noch Zins bezahlt. Nun aber sollst du mir von deinem Reich Zins zahlen, und zwar zuerst deine Tochter Odilia als Ehefrau meines zweiten Sohnes. Mit derselben sende sechzig edle und wohlgeschmückte Jungfrauen, dazu sechzig wohlgerüstete Ritter mit jeweils einem Knappen auf zwei Rossen, sechzig wohlabgerichtete Habichte und auch sechzig wohltrainierte Jagdhunde, deren Leithund mit goldenem Halsband von einer Leine geführt werden soll, die aus den Haaren deines Langbartes gefertigt wurde. So kannst du erkennen, ob jemand noch mächtiger in dieser Welt ist als du. Falls du dich aber getraust, dem Gebot Widerstand zu leisten, dann gestatte ich dir drei Monate Frist, deine Burgen und Mauern zu rüsten, denn alsdann komme ich mit Heeresmacht in dein Reich und gedenke, mir zu gewinnen, um was ich dich gebeten habe.“ Diesen Brief sandte er durch sechs auserlesene Recken an den König zu Bern.
Wie der König das Schreiben gelesen hatte, erhob er sich in großem Zorn. Solche Schmach, sagte er zu seinen Hofleuten, sei ihm in jungen Jahren niemals widerfahren, und er werde sie auch im Alter nicht dulden. Er wolle lieber Land und Burgen verlieren und selbst den Tod erleiden, als tun, was der überhebliche König fordere. Er hoffe aber, obwohl er schon alt sei, noch Siegesehren zu erlangen, wenn seine Recken ihre Treue und ihre Tapferkeit bewahrt hätten. Nachdem alle Hofleute ihm beigestimmt hatten, hieß er sie Burgen und Dienstmannen rüsten. Dann ließ er fünf von Samsons Sendboten sogleich aufhängen, den sechsten schlug er die rechte Hand ab und sandte ihn verstümmelt an den König zurück, dass er demselben den gegebenen Bescheid bringe.
Nach Ablauf der Frist setzte sich König Samson an der Spitze eines großen Heeres von fünfzehntausend Recken und unzählbaren Waffenleuten zu Fuß in Bewegung und stand bald dem König Elsung gegenüber, dessen Macht nicht viel geringer war, da er Hilfsvölker aus dem Norden jenseits der Berge und dem Hunnenland aufgeboten hatte. Die Schlacht entbrannte mit äußerster Wut und dauerte viele Stunden ohne Entscheidung. Da erhob sich König Samson in seiner Kraft. Er stürmte unter die feindlichen Heerhaufen und streckte mit furchtbaren Streichen Reiter und Rosse nieder. Er fällte die mutigsten Helden, die sich ihm entgegenwarfen. Schrecken ging vor ihm her, Blut und Leichen waren hinter ihm. Er war entsetzlich, wie in den Tagen seiner Jugend. Dann hob er sein Schwert in die Höhe und rief wie der rollende Donner, so laut, dass man es durch das ganze Heer hören konnte: „Wenn ich auch ganz allein gegen das Heer reiten müsste und keine Hilfsmannen hätte, so könnte ich, wenn es nötig wäre, mit dieser Hand jeden Mann von Elsung erschlagen!“ Und seine Stimme war so entsetzlich, dass sich alle Feinde sehr fürchteten. Als aber König Elsung sah, welchen großen Schaden Samson seinen Mannen zufügte und dass es so nicht glücken möchte, da rief er laut: „Dringt vorwärts, meine Mannen, wir werden den Sieg erlangen, aber sie den Tod! Unsere Scharen sind stärker, und dieser dickhäutige Lindwurm, der mit seinem Gift weit in unser Heer vorgedrungen ist, soll bald tot auf die Erde niederstürzen. Andernfalls will ich selbst sterben, und dann wird dieser Kampf beendet sein.“ Diese Worte wurden zwar nur von den Nächststehenden vernommen, aber damit spornte Elsung sein Ross an und ritt allein überaus tapfer dem Würger entgegen. Mit dem ersten Streich spaltete er ihm den Schild bis zur Handhabe, mit dem zweiten den Halsberg trotz der dicken Eisenringe, so dass die Klinge noch zwischen Achsel und Hals in Fleisch und Knochen drang. Aber ebenso schnell hieb Samson nach dem Hals des Königs, so dass das Haupt abflog. Da nahm Samson das Königshaupt, hielt es empor und rief mit seiner Donnerstimme: „Lasst ab vom Streit, Elsungs Männer! Es ist genug Blut geflossen, ich gewähre euch Frieden!“ Die Hörner luden auf beiden Seiten zur Waffenruhe, und die müden, zum Teil wunden Krieger folgten willig dem Ruf. Die obersten Führer traten sofort zusammen und pflogen der Beratung. Da der König gefallen war, so dünkte es den Männern von Bern wohlgetan, an seiner Stelle dem gewaltigen Samson das Reich zu übertragen, wodurch aller Streit geschlichtet war. Der siegreiche König zog daher folgenden Tages mit seinem Heer durch das Land, und alle Burgen, sowie die Hauptstadt selbst, öffneten ihm ohne Widerstand die Tore.
Nachdem die Herrschaft geordnet war, ließ der mächtige König des Elsungs Tochter Odilia vor sich treten. Er verkündete ihr, er habe sie zur Ehegenossin seines zweiten Sohnes Dietmar bestimmt, dem er auch die Stadt Bern samt dem ganzen Reich ihres Vaters zugeteilt habe. Die Jungfrau weinte und versicherte, sie könne nach dem Tod ihres Vaters nicht sogleich in eine eheliche Verbindung einwilligen. Über dieser Weigerung ergrimmte der Held und schwur, er werde sie mit Hunden in das Brautgemach hetzen lassen. Sein Angesicht wurde bei diesen Worten so schrecklich, dass sie schier zu Boden fiel und alsbald willigen Gehorsam versprach. Diese Fügsamkeit und die Tränen der Jungfrau versöhnten den zornigen Mann. Er bezeigte sich mild und freundlich, umarmte sie und versicherte ihr seinen Schutz. Danach zog der gewaltige König mit seinem ältesten Sohn Ermenrich und seinem Heer von Bern zurück in sein Vaterland, das er jedoch nicht mehr erreichte. Er fühlte sich krank und siech auf der Reise, auch eiterte die Wunde, welche ihm Elsungs Schwert geschlagen hatte. Er musste in einer kleinen Stadt haltmachen, und daselbst kam ein stärkerer Kämpfer über ihn, dem weder er noch irgendein Menschenkind zu widerstehen vermag, denn es war der Tod. Auf dem Sterbebett übertrug er noch seinem jüngsten Sohn Diether die Herrschaft über Fritilaburg im Rheinland und das dazu gehörige Gebiet als König der Herlungen. Dann neigte er sein Haupt und schied von allen seinen Ehren und Reichen, um die er ein langes Leben hindurch gekämpft und fremdes und eigenes Blut in Strömen vergossen hatte.

König Ermenrich führte nun das Heer südwärts nach Romaburg, und nahm das ganze Reich, welches sein Vater regiert hatte, in Besitz. Er gewann noch manche Schlacht, die mächtige Romaburg, wie auch viele andere große Burgen, und wurde der größte und mächtigste aller Könige. Er war beliebt und friedsam während des früheren Teils seines Lebens.
Dietrichs Kindheit und Jugend
Dietmar, der zweite Sohn Hugdietrichs, erhielt seine Herrschaft zu Bern (heute Verona im Nordosten Italiens, nicht weit vom Gardasee) mit starker Hand aufrecht und duldete keine Abhängigkeit von seinem älteren Bruder Ermenrich, noch von irgendeinem anderen König. Sein Arm war stark und sein Schwert scharf. Daher schlug er mit siegender Gewalt alle Angriffe zurück, woher sie auch kamen. Er war furchtbar im Kampf, so dass ihm bald kein feindlicher Recke mehr ins Angesicht zu blicken wagte. Wenn er aber in der heimischen Burg war, bewies er sich gar sanft und liebreich, besonders zu seiner Ehefrau Odilia, die Tochter von Elsung. Besondere Freude hatte er an seinem Sohn Dietrich, denn der wuchs gar kräftig heran, so dass er in seinem zwölften Jahr schon die Kraft eines starken Recken hatte. Blondes Haar fiel ihm in Locken auf die Schultern herab, ein mächtiger Nacken, Arme, hart und stark wie ein Eichenstamm, ein regelmäßiges Angesicht, das aber, wenn er zornig wurde, grimmig und schrecklich erschien: Das alles verriet früh den löwenmütigen Helden, der im Streit unbezwinglich war. Man sagte aber auch, sein Atem war oft wie Feuerglut, wenn er in heftigen Zorn geriet, und das schrieb man seiner dämonischen Abkunft zu, von der mancherlei Märchen im Volksmund umgingen.
Als Dietrich fünf Jahre alt war, kam an seines Vaters Hof ein schon durch manche kühne Tat rühmlich bekannter Held, nämlich Hildebrand, der Sohn Herbrands und Enkel des treuen Berchtung. Herbrand besaß zu Lehen die schöne Burg Garden, hatte seinen Sohn wohl gepflegt und ihm schon in seinem fünfzehnten Jahr Schwert und Rüstung gegeben. Jetzt war derselbe ein vollendeter Recke und ebenso durch Einsicht und klugen Rat, wie durch Mut und schlagfertige Faust ausgezeichnet. Dietmar nahm ihn daher mit großen Ehren auf und ernannte ihn zum Pfleger seines Sohnes. Einen treueren hätte er nicht finden können, denn zwischen dem Meister und seinem Pflegling entstand ein Liebes- und Freundschaftsbund, der sich erst mit dem Tod wieder löste.
In Dietmars Land geschah viel Unfug, Mord, Raub und Plünderung, ohne dass er Hilfe schaffen konnte, denn die Räuber brachen wie Feuerflammen hervor und waren nach verübten Gräueltaten alsbald wieder verschwunden. Der König zog mit seinen Mannen vergeblich aus. Er fand wohl niedergebrannte Wohnungen und erschlagene Menschen, sowohl wehrloses Landvolk als auch gerüstete Recken, aber nicht die, welche solche Untaten verübten. Indessen erfuhr man doch durch Flüchtlinge, dass zwei Riesen, ein Mann und ein Weib, die frechen Übeltäter seien. Aber wie sehr man auch nach ihnen fahndete, ihre Raubhöhle fand man nicht. Gleichwie der König selbst, so grämten sich auch der junge Dietrich und sein Meister. Sie brannten vor Begierde, die Bösewichter zu bekämpfen und durchstreiften die wilden Berge, doch war alles nur verlorene Mühe.
Einstmals ritten die beiden Genossen mit Habichten und Hunden auf die Jagd. Sie kamen in einen großen Wald und fanden daselbst einen grünen Anger, wo sie viel Wild im hohen Gras vermuteten. Nachdem die Hunde gelöst waren, ritten sie, der eine rechts, der andere links, um den Wiesengrund und hielten ihre Waffen in Bereitschaft. Wie nun Dietrich sorgsam spähend dahintrabte, sprang ein Zwerg dicht vor ihm über den Weg. Er haschte ihn im Sprung und setze das Männlein vor sich auf den Hals des Rosses. Der Gefangene zeterte so laut und kläglich, dass ihn Meister Hildebrand auf der anderen Seite hörte und quer über den Anger heransprengte. „He, holla!“, rief er dem jungen Recken zu: „Halte den Wicht fest, denn er kennt alle Wege auf und unter der Erde. Es ist Elbegast, der Meisterdieb, und er steht sicherlich mit den Räubern im Bunde.“ Da jammerte der Zwerg noch lauter als zuvor und versicherte, er habe von dem Riesen Grim und dessen Schwester Hilde, die all die schrecklichen Gräueltaten im Lande verübten, große Drangsal erduldet. Er habe ihnen das gute Schwert Nagelring und den stahlfesten Helm Hildegrim schmieden und die verborgenen Wege zu Raub und Mord zeigen und bahnen müssen. Nun wolle er den Recken behilflich sein, die unholden Geschwister zu bekämpfen.
Auf diese Zusicherung wurde das Männlein in Freiheit gesetzt. Es atmete tief auf und sagte: „Nun könntet ihr mich nicht wieder ergreifen, wenn ich entwischen wollte. Aber ich gedenke, euch treulich beizustehen, um von der schlimmen Dienstbarkeit loszukommen. Seid morgen vor Tagesgrauen wieder an dieser Stelle. Da übergebe ich euch das Schwert Nagelring, ohne welches der schreckliche Riese nicht überwunden werden kann. Ich entwende es ihm, so wahr ich Elbegast, der Meisterdieb, bin, auch wenn er mit seinem Stierhaupt darauf läge. Dann zeige ich euch seine Spur im Tau des Grases, so dass ihr in seine Berghöhle gelangt, wo ihr, wenn es euch gelingt, den Grim samt seiner unholden Schwester Hilde totzuschlagen, großen Reichtum finden werdet.“ Als der Zwerg diese Worte gesprochen hatte, verschwand er vor den Augen der Männer, die vergebens mit den Händen nach ihm tasteten.
Ein schwach gerötetes Wölkchen verriet, dass sich der strahlende Sonnengott den Armen der Mutter Nacht entzogen hatte. Da standen der Meister und sein Pflegling wiederum am Rand des grünen Angers. Sie sprachen hin und her von der Falschheit der Bergkobolde und meinten, der diebische Elbegast werde wohl sein Wort nicht halten. Ein helles Klingen und Klirren unterbrach ihr Gespräch, und es war der Zwerg, der mühsam das gewaltige Schwert herbeischleppte. Dietrich ergriff es freudig, zog es aus der Scheide und schwang es so leicht, wie etwa ein Schulmeister seine Birkenrute. „Hei!“, rief Elbegast: „Du hast nun Zwölfmännerstärke und bist dem Unhold an Kräften gleich. Nun seht ihr hier im Tau die Spuren von seinen Schuhen eingedrückt. Ich musste sie ihm aus Eisen anfertigen, weil er geizig und das Leder heutzutage teuer ist. Wenn ihr der Spur nachgeht, dann werdet ihr an den Eingang zu des Riesen Höhle gelangen. Ich aber kann euch nicht weiter begleiten.“ So verschwand er wieder vor den Augen der Helden, und diese verfolgten des Riesen Fährte, wie der Zwerg geraten hatte.

Sie gelangten auch in der Tat an eine mächtige Steinwand, aber da war nirgends eine Pforte zu sehen. Nur einzelne Risse und Spalten waren sichtbar, durch welche wohl Eidechsen und vielleicht Zwerge schlüpfen konnten, aber keine gerüsteten Männer und noch weniger Riesen. Indessen meinte der vielerfahrene Hildebrand, es möge vielleicht ein Felsstück als Tür eingefügt sein. Er fing an, da und dort mit aller Kraft zu rütteln, und nicht vergebens, ein ungeheurer Felsblock geriet in Bewegung und stürzte, als Dietrich zu Hilfe kam, polternd ins Tal. Die Strahlen der aufgehenden Sonne leuchteten in eine tiefe Höhle, in deren Hintergrund ein großes Feuer brannte. Daselbst ruhte Grim auf einem Lager von Bären- und Wolfsfellen. Aufgeweckt durch den stürzenden Felsen, hatte er sich halb emporgerichtet, und als er dann die Schritte der Bewaffneten hörte, erhob er sich in seiner ganzen Länge, tastete nach seinem Schwert und ergriff, weil er es nicht fand, einen brennenden Holzkloben. Mit dieser Waffe stürzte er sich auf Dietrich, der voranschritt. Seine Streiche schallten wie Donnerschläge, fielen hageldicht, und nur ungemeine Gewandtheit rettete dem jungen Recken das Leben. Derselbe sprang bald rechts, bald links, um den Keulenschlägen auszuweichen, während ihn zugleich Dampf und sprühende Funken in Gefahr brachten. „Ehrliches Spiel! Einer gegen Einen!“, rief der Held seinem Pfleger zu, der ihm zu Hilfe kommen wollte. Allein dieser geriet auch selbst in Bedrängnis, denn aus einer Seitenhöhle stürzte die entsetzliche Schwester des Riesen hervor und schloss den Meister Hildebrand kräftig in die Arme. Es war aber keine Liebesumarmung, sondern eine Umarmung auf Leben und Tod. Der Recke konnte schier nicht mehr atmen, und rang umsonst, sich aus der Umstrickung loszumachen oder sein Schwert oder Dolchmesser zu zücken. Er stürzte rücklings zu Boden, und die Unholdin presste seine Arme und Hände wie mit Zangen oder Daumschrauben, dass Blut aus den Nägeln sprang. Sie sah sich nach einem Strick um, womit sie ihn knebeln und aufhängen wollte, und in dieser Not rief Hildebrand seinen Gesellen um Hilfe an. Dietrich, der die Bedrängnis seines lieben Meisters sah, tat einen verzweifelten Sprung über die niederschmetternde Keule hinweg und führte zugleich, mit beiden Händen das Schwert fassend, einen furchtbaren Streich, und schlug dem Riesen den Kopf ab. Hildebrand war dem Ersticken nahe, da die Riesin ihm in Ermangelung eines Strickes mit den eisenfesten Händen die Kehle zuschnürte. Jetzt schaffte ihm Dietrich Luft, indem er die Unholdin mit dem Schwert in zwei Stücke spaltete. Sie war aber so zauberkundig und von solcher Trollnatur, dass ihre Hälften wieder zusammenliefen, als wenn sie ganz wäre. Das fand Dietrich höchst wunderlich und schlug zum zweiten Mal auf ihren Leib. Doch es ging ebenso wie vorher. Da riet ihm Hildebrand: „Tritt mit deinen Füßen zwischen Haupt und Körper, dann wirst du dieses Trollweib kleinkriegen.“ Zum dritten Mal hieb er sie in zwei Stücke und stellte sich zwischen ihre Hälften. Da blieb das untere Stück tot, aber der Kopfteil sprach: „Hätte dich Grim so unter die Knie gezwungen wie ich Hildebrand, dann hätten wir den Sieg errungen.“ Damit fielen die Hälften nach beiden Seiten zu Tode, und er sandte sie ihrem Bruder in die Hölle nach.
Meister Hildebrand richtete sich mühsam auf. Er war rot vom Blut des teuflischen Weibes und von dem eigenen, das ihm aus Mund und Nase und aus den Fingerspitzen floss. „Junger Herr“, sagte er, „heute bist du mein Meister gewesen, denn die Teufelin hat mir übler mitgespielt, als irgendein Recke oder Riese in allen meinen Kämpfen. Nun fort aus dem Höllenloch! Aber zuvor wollen wir einpacken, was die Brut bisher gestohlen hat.“ Auf Dietrich gestützt hinkte er in eine Seitenhöhle, wo viel Gold und Silber und manches köstliche Geschmeide aufgehäuft waren. Diese Schätze nahmen die Recken als Siegesbeute mit, zusammen mit dem stahlfesten Helm Hildegrim („Kampf-Helm“), der vom Zwerg Elbegast geschmiedet worden war und nun Dietrich diente, und kehrten nach Bern zurück.
König Dietmar hatte große Freude am Ruhm seines heldenmütigen Sohnes, dessen Name in allen Ländern mit Bewunderung genannt wurde. Indessen war ihm keine lange Zeit mehr vergönnt, sich des Sohnes und der Herrschaft zu erfreuen. Nach kurzem Siechtum wurde er zu seinen Vätern versammelt, und die Sorge für das Reich ging auf Dietrich über. Hildebrand blieb dem jungen König unvermindert treu, auch als sich der Waffenmeister eine Ehefrau nahm, die edle und hochherzige Ute (Uote).
Bald nachdem Grim und Hilde in ihrer Höhle dem Schwert Dietrichs erlegen waren, schritt durch den finsteren Tannenwald ihr Neffe, der gewaltige Siegnot, ein Riese, der im nördlichen Hochgebirge (der Alpen bzw. im „Reich der Alben“) über viele dienstbare Zwerge herrschte. Er wollte seine Verwandten besuchen, aber er fand nur ihre zerhauenen Leichen. Da heulte er vor Wut und Zorn und schnaubte Rache gegen ihre Mörder. Als ihm ein herbeigerufener vielkundiger Zwerg von dem Kampf der Verwandten mit Dietrich und Hildebrand erzählte, maß er dem Bericht keinen Glauben bei, sondern beharrte vielmehr auf seiner Meinung, die Recken hätten beide Riesen im Schlaf überfallen und also meuchelmörderisch erschlagen, um sich ihres Schatzes zu bemächtigen. Seitdem lauerte er nun auf Wegen und Stegen, denn er hoffte, die Recken würden ihm wohl einmal begegnen. Er zog auch nicht, wie seine Verwandten, auf Mord und Raub aus, da die Zwerge ihm nicht nur Gold und Silber, sondern auch Gemsen und anderes Wild zum Schmaus und edlen Wein zum Trank in Fülle liefern mussten. Kamen sie seinem Gebot nicht nach, dann schlug er auch wohl ein Zwerglein tot und röstete es am Feuer zum Fraß. Dasselbe tat ein bezwungener, untertäniger Riese, denn wie der Herr, so der Knecht.
Nach einiger Zeit saßen die Helden in der Halle zu Bern bei vollem Becher und pflegten der Rede, die der feurige Südwein belebte. „Meister“, sagte König Dietrich, „niemals habe ich ein liebendes Weib einen Recken so brünstig umarmen sehen, als dort in Grims Felsenhöhle geschah. Mich dünkt, Frau Ute würde dir nimmer wieder hold werden, wenn sie gesehen hätte, wie Hilde, die wundersame Maid, dich küsste. Sie hätte dir schier Arme und Beine zerbrochen.“ - „Eine Unholdin, wie nur jemals ein Scheusal aus der Hölle hervorgegangen ist“, sagte Hildebrand schaudernd, „aber du hast mich mit starkem Arm von ihr befreit.“ - „Freilich“, versetzte der König, „ich vergalt nicht Gleiches mit Gleichem. Manchen Rutenschlag musste ich in jungen Jahren von dir erdulden und doch überließ ich dich nicht den Liebesschlägen der Frau Hilde, sondern löste ihre Umarmung mit dem Schwert. Gestehe, dass ich großmütig bin!“ - „Das tue ich gern“, versicherte der Meister, „aber sei nicht hochmütig, denn in den Bergen lauert seitdem der Riese Siegnot als Grims Rächer auf uns, und den kann kein sterblicher Mensch bezwingen, ja nicht einmal ganze Kriegsheere.“ - „Hei, das ist eine neue Geschichte!“, rief der Berner: „Und der Rächer Grims hält sich wirklich in unseren Bergen auf? Und niemand hat mir von ihm berichtet? Gleich morgen ziehe ich aus, mein Reich von dem neuen Unhold zu befreien.“
„Um Gottes Willen! - Gegen den Riesen! - Den mordgewohnten Siegnot!“, riefen die Gäste durcheinander. „Höre mich, Sohn Dietmars, mein Pflegling“, sprach Hildebrand feierlich, „der ist kein Held, sondern ein Wagehals, der Unmögliches unternimmt, und es ist unmöglich, den eisenfesten Riesen zu überwältigen.“ - „Höre, lieber Meister, mein Pfleger“, erwiderte Dietrich, „was du mich selbst gelehrt hast: Der ist ein Held, der scheinbar Unmögliches unternimmt, weil er auf seine Kraft und auf die Gerechtigkeit seiner Sache vertraut. Er ist ein Held, mag ihm der Sieg oder der Tod den Ehrenkranz reichen. Meine Sache aber ist gerecht, denn ich will mein Reich und mein Volk gegen den Unhold sicherstellen.“ - „König!“, rief Hildebrand: „Du bist nicht mehr mein Pflegling, sondern mein König, und als dein Geselle ziehe ich mit dir in den entsetzlichen Streit.“ Nach kurzem Bedenken sagte der kühne Held: „Mein Pfleger sprach dereinst zu mir: Einer gegen Einen, das ist die Weise der Recken. Zwei gegen Einen ist der Feiglinge Brauch. Daher gedenke ich, die Fahrt allein zu unternehmen.“ - „Kehrst du aber nicht binnen acht Tagen heim“, sagte der Meister, „dann reite ich dir nach und werde dein Befreier, dein Rächer oder dein Geselle im Tode.“ - „Wozu das Weinen und Winseln!“, rief Wolfhart: „Der Berner schlägt den Riesen tot, oder Oheim Hildebrand tut es, und wenn es den beiden misslingt, dann komme ich selbst als dritter Mann, und ich setze mein Haupt zum Pfand: Ich führe ihn am Strick wie einen Bären hierher in die Burg und hänge ihn an eine Mauerzinne, wo er baumeln mag, bis ihn sein Gevatter (als Teufel und Tod) in die dunkle Hölle heimholt.“
Dietrich ritt drei Tage des Weges, den ihm Hildebrand beim Abschied beschrieben hatte. Er schlief des Nachts unter Bäumen und speiste und trank von den reichlichen Vorräten, womit er versehen war, während sein edles Ross im saftigen Gras sich gütlich tat. Am dritten Tag lagerte er im Angesicht des Hochgebirges.
Da glänzen die Gipfel im Silberschein
Und rufen dem Wandrer: Oh komm' herein
In unsere Mitte, zu atmen die Luft,
Der wonnigen Blumen erquickenden Duft,
Das stählt die mutige Heldenbrust
Und erfüllt sie freudig mit Siegeslust.
Es war ihm so wohl zumute, und er fühlte sich so kräftig, dass er mit allen Riesen der Welt den Kampf gewagt hätte. Wie er noch wachend in glückliche Träume versunken war, trabte ein stattlicher Elch vorbei. „Halloh! Falke, mein edles Ross“, rief er, „lass sehen, ob du den wilden Elch überholst.“ Sofort sprang er auf den Hengst und spornte dem Edelwild in stürmischer Eile nach. Falke griff mächtig aus, und fort brauste die wilde Jagd über Berg und Tal. Er kam dem Elch näher und näher. Als aber dieser den Verfolger dicht hinter sich bemerkte, jagte er schnell wie der Wind voran. Doch auch Falke bot nun alle Kraft auf, den Siegespreis zu gewinnen, und endlich war der Jäger in gleicher Linie mit dem Wild. Da stieß er demselben von oben herab das gezückte Schwert gerade in den Nacken, so dass es nach wenigen Sprüngen verendet niederstürzte. Dietrich sprang von dem schäumenden Hengst, der freudig wieherte, und klopfte ihm den Hals, indem er sagte: „Schön, edler Falke, nun sollst du mich in ernster Feldschlacht tragen, und weder ein Recke noch ein Riese wird flüchtigen Fußes uns entrinnen.“ Er zündete darauf ein Feuer an, schnitt mit dem scharfen Dolchmesser ein fettes Hüftenstück von seiner Jagdbeute, briet und verzehrte es mit Wohlbehagen, indem er zugleich von Zeit zu Zeit einen Becher feurigen Weins aus einem Schlauch füllte und leerte, der am Sattel befestigt war.

Ein Zetergeschrei störte ihn in seiner löblichen Beschäftigung mit der Leibespflege. Er sah auf und erblickte einen ungeschlachten, ganz nackten und mit stacheligen Borsten bedeckten Mann von riesenhafter Größe, der an seiner Eisenkeule ein fest angebundenes Zwerglein trug. Das Männlein zeterte kläglich und rief, als es den Recken erblickte, dessen Hilfe an. „Hilf mir, tapferer Held!“, jammerte es: „Hilf mir vor dem Unhold, der mich bei lebendigem Leib verspeisen will.“ Dietrich trat sogleich dem wilden Mann in den Weg und bot ihm einen Tausch an. Er solle den Elch für den Zwerg nehmen, sagte er, da er daran einen fetteren Bissen habe, als an dem mageren Grubenmann. „Aus dem Weg, Hundeknecht!“, brüllte der Wilde: „Aus dem Weg, oder ich röste dich selbst an deinem Feuer und verspeise dich samt deiner Eisenrüstung.“ Da entbrannte der Zorn des Helden. Er zückte Nagelring, während der Riese das Wichtlein von seiner Keule wie eine Schneeflocke abstreifte. Die Kämpfer schlugen beide aufeinander, dass es schallte, als ob hundert Holzhauer einen Wald fällten. Hildegrim deckte den Recken gut, aber auch dessen wuchtige Streiche glitten an den hornfesten Borsten des Unholds ab, ohne ihn im Mindesten zu verletzen.
Das Gefecht währte lange Zeit, bis beide Kämpfer ermüdet ihre Waffen senkten. Während des Waffenstillstandes geiferte der Wilde immer fort, wie er dennoch den geharnischten Wicht zu Scherben schlagen und seinem Gebieter Siegnot, dem Herrn des Gebirges, den Schädel des Hundesohnes als Trinkbecher überbringen werde. Da bot ihm der König nochmals Frieden an, weil er ausgezogen sei, nicht mit dem Knecht, sondern mit dem Herrn zu kämpfen. Ein Hohngelächter war die Antwort. „Krötenbein!“, rief er, und die Bäume zitterten, „Eidechsenschwanz! Gegen Siegnot willst du ankämpfen? Der bindet dich an seine Stange, wie ich das Wichtlein, und lässt dich zu Tode zappeln.“ - Der Kampf begann von neuem. Mittlerweile hatte der Zwerg die Riemen, mit welchen er gebunden war, gelöst und stand immer hinter dem Helden, indem er ihm, als ob er des Gegners Schläge errate, die Wendungen angab, durch welche er sie vermeiden konnte. „Triff ihn mit dem Schwertknauf ans Ohr“, raunte er, „gegen die Schneide und Spitze ist er fest.“ Dietrich folgte dem guten Rat. Als des Riesen mächtige Stange bei einem Fehlschlag in die Erde fuhr, unterlief er ihn und stieß ihm hoch aufgerichtet den Knauf in das Gehörorgan. Der Unhold fiel sogleich zappelnd zur Erde, denn der Knauf war tief in seinen Schädel eingedrungen. Ein zweiter und dritter Stoß machte seinem Leben ein Ende.
Die Leiche gewährte einen schrecklichen Anblick, denn sie wurde ganz schwarz und ging sogleich in Verwesung über. „Nun fort!“, rief der Zwerg, „ehe Siegnot kommt, der Herr des Gebirges, sonst sind wir beide verloren.“ - Stolz über seinen Sieg erklärte ihm Dietrich wie zuvor dem Wilden den Zweck seiner Heldenfahrt. „Edler Held“, sagte das Männlein, „du wirst deinem Schicksal nicht entrinnen. Aber falls du durch ein Wunder glücklich bist, dann sind wir armen bedrückten Zwerge mit all unserer Kunst und Habe dir zu eigen. Unser Vater Alberich übergab mir, seinem ältesten Sohn Baldung, die Herrschaft hier über Tausende von kunstverständigen Zwergen. Aber der furchtbare Siegnot hat uns trotz unserer Tarnkappen und Zauberkunst gänzlich unterjocht und zu so schwerem Dienst gezwungen, dass schon viele Hunderte unter der harten Tyrannei umgekommen, andere aber von seinem borstigen Knecht verzehrt worden sind.“ - „Wohlan“, sprach der Berner, „erweise dich dankbar, indem du mir den Weg zu Siegnot zeigst.“ - „Dort siehst du den Berg mit dem Scheitel von Schnee.“, versetzte Baldung: „Kommst du dahin, dann brauchst du nicht lange zu suchen. Denn da lauert der entsetzliche Mann schon lange auf dich und Hildebrand, um Rache zu nehmen für den Tod seiner Verwandten Grim und Hilde. Verleiht dir Gott den Sieg, dann gebiete über alle unsere Schätze: Schmuck oder Rüstung, nichts sei dir versagt.“ Nach diesen Worten schenkte er ihm zum Dank noch einen Edelstein aus dem Schatz, der ihm Kraft geben sollte, im Kampf auszudauern und Hunger und Durst zu ertragen. Dann zog er seine Tarnkappe über die Ohren und war verschwunden.
So will ich euch doch geben
Einen Stein und der ist tugendhaft.
Er dient zu eurer Manneskraft,
Mag euch fristen euer Leben,
Dass euch weder hungert noch dürstet.
(Sigenot, Oskar Schade, 1854)
Dietrich sah den weißglänzenden Berg vor sich, aber der Weg schien ihm sehr weit. So blieb er die Nacht über auf seinem behaglichen Ruheplatz, aß des Morgens noch von seinem Elchbraten und trank den Rest seines Schlauches. Darauf bestieg er sein Pferd und trabte in der bezeichneten Richtung wohlgemut durch den wilden Tann. Gegen Mittag kam er auf eine Lichtung, wo er den Berggipfel nahe vor sich sah. Ein Gletscher zog sich von der Höhe in den Talgrund herab, Gestein und Felsen starrten überall empor, wie der Recke in jener Richtung weitertrabte. Die Tannen, nicht mehr hoch emporstrebend, senkten hier ihre Äste herab und langes Moos hing daran, das die Stämme bis zur Wurzel verhüllte. Ein dichter Nebel stieg auf, der dem Helden Berg und Gletscher verbarg. Plötzlich teilte sich der Nebel, die grauen Massen schoben sich wie ein Vorhang auseinander, und vor dem Berner stand eine Lichterscheinung, ein wundersames Frauenbild in schneeweißem Gewand, das Haupt umschlossen von einem funkelnden, mit Edelsteinen verzierten Goldreif, die Brust geschmückt mit Geschmeide, das wie die Sterne des Himmels leuchtete. Sie erhob warnend den Finger und sagte: „Sporne dein Ross eilends zurück, Berner Held, oder du bist verloren. Der Verderber lauert auf dich.“ Sie glitt unhörbar vorüber, und der Held sah, wie sie nach dem Gletscher schwebte, in welchem sie vor seinen Augen verschwand. „Ist die himmlische Freya zur Erde herabgestiegen?“, rief er überrascht: „Will sie einen sterblichen Menschen beglücken? Aber warum versucht sie, mich von meinem Vorhaben abzubringen? Oder ist es die Elfenkönigin Virginal, von der die Sage geht, dass sie verborgene Schätze hütet?“
Er konnte sich die schöne Erscheinung nicht aus dem Sinn schlagen, bis ihn ein schallendes Jauchzen aufschreckte. Es war ein Krieger von riesenhafter Gestalt, der durch den Tann auf ihn zustürmte. Er war wie ein Recke mit Helm, Brünne und Schild gerüstet, aber statt des Schwertes schwang er nach Riesenart eine mächtige Eisenkeule. „Endlich kommst du, mir dein Haupt für den Mord zu bieten, den du an Grim und Hilde hinterlistig verübtest. Ich habe dich sogleich an deinem geraubten Helm Hildegrim erkannt!“ So rief er dem Berner zu, indem er ihn unverzüglich angriff. Sofort wurden sie handgreiflich, und die schmetternden Streiche der Keule schallten wie Wetterschläge. Der Held deckte sich mit dem Schild und benutzte auch die Bäume zur Deckung. Er führte mit großer Kraft gewaltige Hiebe auf den Gegner, aber dessen Rüstung war fest wie Hildegrim. So erkannte er wohl, dass er den furchtbaren Siegnot zum Gegner hatte.
Eine Schlange, die des Riesen Fuß verletzte, schnellte auf, aber ihr giftiger Biss drang nicht durch die Eisenrüstung, und der Kämpfer zerschlug ihr den Kopf mit dem Knauf der Keule. Diesen Augenblick benutzte Dietrich zu einem verzweifelten Streich mit beiden Händen: Nagelring schwirrte durch die Luft, aber die Klinge traf einen überhängenden Ast und haftete darin. Wie sie der Held mit Macht herauszureißen versuchte, zerbrach der spröde Stahl. Ein Keulenschlag streckte den königlichen Helden zu Boden. Der gute Helm war zwar unverletzt, doch die Wucht des Streiches war so gewaltig, dass der mutige Kämpfer die Besinnung verlor. Sogleich fiel der Riese über ihn her, knebelte ihm Hände und Füße und schleppte ihn fort in seine finstere Behausung. Dort nahm er dem armen Dietrich Helm, Rüstung und Schild ab und warf ihn in eine tiefe Grube hinab, den grausigen Schlangen und Würmern zum Fraß. Dietrich wurde von diesem Fall wenig geschädigt, aber seine Fesseln waren so locker geworden, dass er sie mit geringer Mühe abstreifen konnte. Die Schlangen und Würmer taten ihm nichts zuleide, sondern flohen scheu zurück, und auch sein Mut und seine Stärke wichen ihm nicht in der dumpfigen Höhle. Das kam aber alles von der Kraft des Steins, den ihm der dankbare Zwerg gegeben hatte. Der edle Held war dadurch so gut geschützt und gekräftigt, dass er unverzagt in dem schaurigen Aufenthalt verbleiben und sogar in der Nacht Schlaf finden konnte.
Meister Hildebrand wartete mit Ungeduld acht Tage, wie verabredet war, dann aber war seines Bleibens nicht mehr zu Bern. Frau Ute musste ihm das Streitgewand festschnüren und das Schwert umgürten. Sie brach nicht in Klagen aus, aber manche Träne fiel auf die blanke Rüstung und beim Abschiedskuss auf die Wangen des Gatten. „Bist meine liebe Frau“, sagte er, auf den Hengst steigend: „Komme ich nicht wieder, dann denke, dass ich tat, was ich als ehrlicher Geselle meines königlichen Herrn tun musste.“ Er sprengte fort, und nun weinte sie viel und lange.
Der Waffenmeister ritt getrosten Mutes die ihm bekannten Wege, wie ein Mann und Krieger, der entschlossen ist, seine Pflicht zu tun, und der in diesem Bewusstsein kühn dem Tod ins bleiche Antlitz blickt. Er wusste gut Bescheid, fand den Anger, wo der modernde Elch an der Feuerstätte lag und unfern davon die verweste Leiche des borstigen Knechtes. Das waren deutliche Spuren von seinem Herrn, und er trabte durch den Tannenwald, dem silberglänzenden Berg zu. So gelangte er über die Waldblöße, und da weidete Falke. Er rief den Hengst, und der trabte herbei und sah ihn mit seinen klaren Augen so traurig an, als wolle er ihm Kunde vom Schicksal seines Herrn geben. Weiterhin fand der Recke die Bruchstücke des Schwertes, und er konnte nun nicht mehr am Tod des Königs zweifeln. Ihm blieb nur die Rache, nicht mehr die Rettung übrig. Ein Zwerglein lief über den Weg, blieb aber stehen, als es ihn sah. Es war Baldung. Er winkte dem Meister umzukehren und rief ihm zu, als er nicht darauf achtete: „Zurück, Meister Hildebrand, oder es ergeht dir wie dem guten Dietrich.“ Doch der unverzagte Meister spornte sein Ross vorwärts. „Und wenn es in die Hölle ginge“, sagte er, „so will ich meinen König rächen, oder sterben.“ Sogleich sah er den Riesen heranstürmen, sprang vom Ross und machte sich kampffertig. Er vermied klug und gewandt die Keulenschläge, doch wurde ihm der Schildrand zerschmettert, und er zog sich tiefer in den Tann zurück. Hier gewährten ihm zwar die Bäume einigen Schutz, aber Siegnot, des langen, vergeblichen Kampfes müde, riss Dornhecken, Sträucher und selbst Bäume aus und warf sie auf und um den Helden. Wie derselbe einen Ausweg suchte, traf ihn, wie früher seinen Herrn, ein Keulenschlag, der ihn niederstreckte.
Jauchzend rief Siegnot: „Nun haben wir den anderen Mörder, und Hilde und Grim sind gerächt. Fort, Langbart, in das Wurmverließ!“ Er schnürte dem gefällten Recken Hände und Füße zusammen, ergriff ihn bei seinem Bart, warf ihn über die Schultern und schritt mit seiner Last singend und pfeifend dem hohlen Berg zu, wo er hauste.
Es war ein weiter, hochgewölbter Raum, der dem schrecklichen Siegnot zur Wohnung diente. Mächtige Steinpfeiler stützten die Decke, ein strahlender Karfunkel hing an der Wölbung und verbreitete ein angenehmes Dämmerlicht, und im Hintergrund herrschte tiefes, schauerliches Dunkel. Der Riese warf am Eingang seine Bürde so schonungslos auf den Felsboden, dass der Meister meinte, alle Glieder seien ihm gebrochen. Darauf ging er in eine Seitenhalle, um eiserne Fesseln zu holen. „Ruhe dich aus, armer Knirps“, rief er ihm höhnisch zu, „gleich kommst du in das Wurmverließ, wo du im Schlangenbauch mit deinem Herrn wieder zusammentreffen wirst.“ Er ging, und der Gefangene blieb eine kurze Zeit sich selbst überlassen.
Wenn die Wogen der Not über den Häuptern der vergänglichen Kinder der Erde zusammenschlagen, dann jammert und wehklagt der Schwächling und murrt über das harte, unbeugsame Schicksal und überlässt sich rat- und tatenlos der wilden Strömung, welche ihn dem klaffenden Abgrund zutreibt. Der starke, sich selbst vertrauende Kämpfer dagegen bleibt unter den zermalmenden Schlägen des Verhängnisses ohne feige Klage, ruhig und gefasst, und blickt umher nach einem Rettungsboot, nach einem Trümmerstück, woran er sich klammern und aus dem Umsturz erretten kann. So tat Hildebrand, als er, ein gebundener und verlorener Mann, in der grausigen Felsenhöhle lag. Wie er umherspähte, sah er sein gutes Schwert, das der Riese als Beutestück mitgenommen hatte, in einem entfernten Winkel liegen. Wenn es ihm gelang, die Stricke zu lösen, die ihm ins Fleisch schnitten, dann konnte er noch einmal den Waffengang versuchen. Er lag an einem scharfkantigen Pfeiler, und daran rieb er mit aller Kraft die Fesseln der Hände. Der Versuch gelang, er hatte die Hände frei und löste nun auch die Bande an den Füßen. Schnell ergriff er sein Schwert und verbarg sich kampfbereit hinter dem Pfeiler, weil ihm der Schild fehlte, der auf dem Kampfplatz im Wald zurückgeblieben war.
Siegnot erschien wieder mit schweren Eisenketten und sah sich verwundert nach seinem Gefangenen um. Wie er aber hinter den Pfeiler blickte, führte der Held mit beiden Händen einen Streich auf des Riesen Haupt, dass derselbe zurücktaumelte. Ehe er jedoch einen zweiten Hieb tun konnte, hatte der Gegner wieder seine Keule gefasst, und nun fielen seine Schläge wie früher hageldicht. Der Meister wich ihnen aus von einem Pfeiler zum andern, bis in den dunkeln Hintergrund der Höhle. Der Boden zitterte, und die Felsen hallten von dem Kampfgetöse wider. Da hörte der Held aus der Tiefe seinen Namen rufen. Er erkannte die Stimme des Königs, und der Gedanke „Er lebt!“ gab ihm neue Kraft. Hinter dem letzten Pfeiler hervorspringend, versetzte er dem Gegner von unten herauf einen Stich mit der spitzen Klinge, der durch die Beinrüstung in den Unterleib drang. Mit fürchterlichem Gebrüll verdoppelte Siegnot seine Schläge. Einer derselben streifte des Meisters Helm und schlug ein großes Felsstück aus dem Pfeiler. Indessen war die Keule in eine Spalte gedrungen, und ehe der Unhold sie herausziehen konnte, erhielt er einen zweiten Stich, der ihn zu Boden streckte.
Der Sieg war gewonnen, und Hildebrand hieb dem gefällten Unhold den Kopf ab. Er selbst war aber so erschöpft, dass er in das strömende Blut niedersank. Sein Helm war an der Seite, wo ihn der letzte Keulenschlag gestreift hatte, zerschmettert, sein Kopf schmerzte ihn, und er musste eine kurze Weile ausruhen. Da hörte er wieder Dietrichs Stimme aus der Tiefe: „Hildebrand, lieber Meister!“ Er raffte sich auf, trat an den Rand des Abgrunds und tat dem geliebten Freunde seinen schwererfochtenen Sieg kund. „Hilf mir heraus aus dem Wurmverließ! Sonst werde ich noch zum Futter für die Würmer und Schlangen.“
Es galt jetzt, dem königlichen Helden heraufzuhelfen, aber der Abgrund war sehr tief und weder eine Leiter noch ein Strick vorhanden. Der Meister fand Rat, er zerschnitt mit dem Dolchmesser das Gewand des Riesen und einen Teil des seinigen, knüpfte die Stücke zusammen und ließ sie in die Tiefe hinab. Dieses Gebände reichte bis auf den Grund des Verlieses. Dietrich klammerte sich daran fest, aber wie der Meister ihn eine Strecke heraufgezogen hatte, zerriss der falsche Strick, und Dietrich tat einen schweren Fall. Der Meister durchirrte alle Räume der Felsenkluft, um ein taugliches Mittel zu finden. Verzweifelnd kehrte er in die große Halle zurück. Da stand das Zwerglein Baldung und hielt das gewaltige Haupt des Riesen in den Händen. Er pries laut den herrlichen Sieg des tapferen Helden, den er seinen und seiner Gehilfen Befreier nannte. Er lud ihn ein, ihm in den Berg zu folgen, wo er reichlich Erquickung und große Schätze finden werde. Als er hörte, dass Dietrich noch lebe und im Verließ schmachte, brachte er eine lederne Leiter herbei, die gar kurz erschien, aber sich nach Bedürfnis verlängerte, so dass man daran, wie er sagte, bis in die Hölle hinabsteigen könne. Mittels dieser Leiter kam der König wieder an das Tageslicht. „Hildebrand“, sagte er aufatmend, „du bist nicht mein Geselle, du bist in Wahrheit mein Meister.“ Er küsste ihn, wie ein Sohn seinen Vater, und folgte dann dem freundlichen Zwerg in seine unterirdische Welt, wo die kleinen Leute ihre Befreier mit köstlichen Speisen und Getränken labten, ihnen ihre Schätze und Kunstwerke zur Auswahl öffneten und Hilfe und Beistand in allen Gefahren versprachen. Das edelste Geschenk, das Dietrich annahm, war sein Schwert Nagelring, neu geschmiedet, gehärtet und mit Gold und Edelsteinen verziert, so dass es schöner und fester war als zuvor.
Froh der Rettung und des Sieges kehrten die Helden nach Bern zurück, wo sie mit Jubel empfangen wurden.
Die Hochzeit mit Virginal
Dietrich und Hildebrand zogen einst nordwärts, weit in die wilden Berge im Tiroler Land. Sie wollten Gemsen jagen, aber die Jagd war nicht ergiebig. Der König war wenig achtsam, schleuderte selten den Speer und verfehlte stets das Wild, so dass Hildebrand ihm häufig sein Ungeschick vorwarf. Auf einer Anhöhe im Angesicht der schneegekrönten Berge machten die Recken Halt, um von den mitgeführten Vorräten zu speisen. Der Weinschlauch fehlte nicht. Sie leerten manchen Becher und plauderten dabei von bestandenen Abenteuern. „Höre mich, Meister“, unterbrach der Berner den redseligen Genossen, „ich kann sie nicht vergessen, die Königin Virginal. Sie ging an mir vorüber, als ich gegen Siegnot auszog, und warnte mich. Sie erschien mir wie die himmlische Freya, die, so meinte ich, zu einem Sterblichen herabgestiegen sei, um ihn mit ihrer Huld zu beglücken. Ich will, ich muss ihre Behausung aufsuchen und um ihre Gunst werben, sollte mir auch ein zweiter Siegnot mit allen seinen Brüdern in den Weg treten.“ - „Du würdest von dem zweiten Siegnot und seinen Brüdern übel gebläut“, lachte der Meister, „und leichter könntest du einen Stern am Himmel um seine Gunst anrufen, als die Königin Virginal hinter ihren Gletschern und Eisbergen.“
Wie die Helden noch miteinander plauderten, stand plötzlich ein winziges Männlein, ganz wie ein Recke mit Helm und Brünne (Brustpanzer) gerüstet, vor ihnen. „Wisset, edle Recken“, sagte er, „ich bin Bibung, der unüberwindliche Leibwächter der Königin Virginal, deren Herrschaft alle Zwerge und Riesen in diesen Bergen untertänig waren. Mit meiner Hilfe hat sie den diebischen Elbegast von hier vertrieben, aber der unholde Geselle hat nun den Zauberer Ortgis mit seinen Riesen und Lindwürmern hierher gewiesen, und der zwang sie jüngst durch seine schwarze Kunst zu einem schmählichen Tribut. Sie muss ihm, sooft der volle Mond am Himmel erscheint, eine ihrer schönen Jungfrauen überliefern, die er dann einsperrt, mästet und zum Mittagsbrot verspeist. So ist Jeraspunt, ihr Palast, mit Weinen und Wehklagen erfüllt. Meine Herrin lässt euch nun zu sich entbieten, dass ihr, weil ihr den schrecklichen Siegnot besiegt habt, den Zauber löst, indem ihr den finsteren Zauberer mit seinen Helfern bekämpft. Eilt also nach Jeraspunt der hohen Königin zu Hilfe!“ - „Wo ist Jeraspunt? Wie finden wir den Weg?“, fragte Dietrich begierig. „Ihr wisst es nicht?!“, rief der Zwerg: „Blickt dorthin, auf die Höhen, die von der sinkenden Sonne beleuchtet werden, dort seht ihr den Palast in seiner Herrlichkeit.“
Der beiden Recken Blicke ferne glitten,
Wie jener deutet, zu den Höhen hin,
Wo in der Bergumkettung öder Mitten
Manch' Felsenbild, das erst noch dunkel schien,
Nun, von des Abends Purpurstrom umflossen,
Der dunklen Erde ahnungsvolles Sinnen,
Verlorne Klarheit wieder zu gewinnen,
Dem Menschenauge freudig hat erschlossen.
Die alten Häupter dort, von Jahren weiß,
Sie haben sich geschmückt mit goldnen Kränzen,
Die sonst nur um der Jugend Locken glänzen.
Um des starren Scheitelhaares Silbereis,
Und aus dem Leichentuch, von Schnee gewoben
Um toter Felsen Riesenleib, in Glut
Auflodernd, hat sich eine Welt erhoben,
Genährt von ungeahnter Lebensflut.
Da blitzen Sterne und goldne Früchte ohne Ende,
Dort Purpurblumen, die dem Firmamente
Die Kelche erschließen, Burgen und Paläste,
Geschmückt zum königlichen Hochzeitfeste,
Da sich dem Ozean, dem wunderreichen,
Die Königin des Tages gab zu eigen.
Und oben auf des Berges höchster Schräge
Erbauen stillgeschäftig Geisterhände
Ein Wunderhaus, kristallenhell die Wände;
Wohin sich wenden rings die steilen Stege,
Die Zinnen, Pfeilerreihen, von Blumenreifen
Die Knäufe umgürtet an die Sterne streifen;
Und mitten in Rubinen eingesenkt,
Des Fensters Rose, wo empor sich schwingen
Die Giebel; In Saphir das Tor gesprengt
Und offen weit, dass frei die Blicke dringen
Ins offne Heiligtum der Halle hin;
Da thront sie selbst, die hohe Königin.
Auf Erden ist kein Bild ihr zu vergleichen,
Soweit der Sonne goldne Strahlen reichen.
Die beiden Recken konnten die Blicke nicht von der Wundererscheinung abwenden. Doch allmählich verblasste sie, als die Sonne tiefer sank. Noch glänzten die Giebel und Zinnen rotglühend, dann verloren auch sie den hellen Schein, und die Berge starrten in ihrem Gewand von Schnee wie aufgehäufte Leichen zum Sternenhimmel empor. Hildebrand unterbrach zuerst das Schweigen. „Wahrlich“, rief er, „wenn Frau Ute, meine eheliche Wirtin, nicht wäre, so wollte ich selbst um die Königin Virginal werben gehen. Aber nun will ich dir, lieber Geselle, treulich beistehen, dass du sie als Eheliebste heimführst in das Königshaus zu Bern. - He, Bibung! Wo zum Henker ist der Knirps hingeraten?“ - „Der unüberwindliche Leibwächter hat Sorge vor Ortgis“, sagte Dietrich, „wir aber zerhauen mit unseren Schwertern seine Nebelgeister. Nun vorwärts zum Palast der Königin!“ - „Die Nacht ist Mutter der Hexen!“, versetzte der Meister: „Daher wollen wir hier auf dem weichen Moos ruhen, bis der Morgen aufsteigt. Hole den Schlauch hervor, denn herb ist unser Sorgenbrecher, doch labend, wie wahrhafte Treue.“
Sie schmausten und tranken und schliefen ruhig auf den Moosbetten. Der Morgen war trüb und nebelig. Eisiger Schneesturm schlug den Recken entgegen, und der Weg ging über steile Höhen, so dass sie bald ihre Pferde zurücklassen mussten. Schneefelder und Gletscher breiteten sich vor ihnen aus, donnernde Lawinen, herabrollende Felsentrümmer und Abgründe drohten ihnen auf jedem Schritt mit Verderben. Doch wanderten sie unverzagt weiter, denn vor ihnen leuchtete über dem Nebelmeer fernher der Palast der Königin im Sonnenglanz. Ein tiefes Tal trennte sie noch von jenem Berg, das sie durchschreiten mussten. Sie gelangten herabsteigend an einen Brunnen, wo sie den brennenden Durst löschen und sich ausruhen wollten. Doch ein lauter Hilferuf einer weiblichen Stimme störte ihre Ruhe. Sie gewahrten gleich darauf ein Mägdlein, das laut jammernd daher stürzte und ihre Hilfe vor dem schrecklichen Ortgis anrief. Sie erzählte ihnen, wie sie demselben nach dem Vertrag überliefert worden sei, und wie er sie gleich einem Wild mit Hunden verfolgte. Kaum hatte sie geendigt, stürmten die Rüden des wilden Jägers herbei und griffen die unglückliche Jungfrau an. Zugleich hörte man das „Halloh“ der verfolgenden Jäger. Ehe diese aber nahekamen, waren die Bestien schon erlegt, und nun begann der Kampf mit Ortgis und seinem Gefolge. Wie riesenhaft aber auch Ortgis und die anderen Jäger waren, sie unterlagen doch den Schwertern der Helden, und nur ein Mann entkam durch eilige Flucht, und der war gerade der schlimmste, nämlich Janibas, der Sohn von Ortgis und zauberkundig wie sein Vater.
Gern wären die Helden sogleich nach Jeraspunt, dem Palast der Königin, aufgebrochen, aber der Weg dahin war sehr weit, wie die Jungfrau versicherte, und der Abend dämmerte bereits. Wo sollte man aber ein Nachtlager in der eisumstarrten Einöde finden? Da lag nun vor ihnen im Talgrund eine stolze Burg, und zwar die des erschlagenen Ortgis, wie die Jungfrau gleichfalls angab. Furchtlos, wie die Helden waren, beschlossen sie, mit Güte oder Gewalt darin Herberge zu suchen. Als sie daselbst ankamen und an die Tür klopften, sprangen mehrere bewaffnete riesenhafte Männer heraus, die sie bis an den Brunnen zurückdrängten, aber endlich erschlagen wurden. Hinter ihnen hielt ein Reiter in schwarzer Rüstung, der murmelte beständig in einer fremden Sprache vor sich hin, und daraufhin erschienen, wie aus dem Boden aufsteigend, abermals riesige Männer zu neuem Kampf. Dennoch siegten die Recken. Doch das Murmeln des schwarzen Reiters dauerte fort und lockte grässliche Lindwürmer (Schlangen-Drachen) hervor, mit denen die Helden die lange Nacht hindurch zu streiten hatten. Erst als die freundliche Sonne aufging und die nächtlichen Schrecken verscheuchte, verschwand der Schwarze. Dagegen erblickte man einen ungeheuren alten Lindwurm, der einen gepanzerten Mann im Rachen trug. Das Untier wollte eilends mit seiner Beute vorüberkriechen, aber die Recken schleuderten ihre Speere und griffen es, als diese wirkungslos blieben, mit gezogenen Schwertern an. Der Drache ließ seine Beute fallen und stürzte sich zischend auf den Berner, der ihm zunächst stand. Mit der Tatze riss er ihm den Schild herunter und schlitzte ihm die Rüstung und die Seite auf, während er zugleich den Meister mit dem Schweif umschlang und gleich einem Ball weit fortschleuderte. Dafür bohrte ihm Dietrich das Schwert durch den Rachen in den Schlund und drängte nach, so dass die Klinge hindurch in einen Baum drang und so den Kopf fest anheftete. Wie grimmig auch das Ungeheuer mit Tatzen und Schweif um sich schlug, es konnte nicht loskommen und verendete unter grässlichem Geheul.
Die gerettete Jungfrau, die bisher angstvoll den Kämpfen zugesehen hatte, verband die Wunde des Helden und legte heilsamen Balsam darauf. Indessen richtete Hildebrand den Mann, der aus dem Drachenrachen gefallen war, auf und erkannte in ihm Ruotwin, den Sohn Helfrichs von Tuskan, der ein Bruder seiner Mutter war. Glücklicherweise hatte derselbe außer einigen Quetschungen keinen Schaden genommen und konnte den Helden Beistand leisten, als sie nach der Burg des erschlagenen Ortgis aufbrachen, um dessen Sohn, den Hexenmeister Janibas, zu züchtigen. Es erschien aber noch weitere Hilfe, nämlich der streitbare Helfrich, der mit bewaffnetem Gefolge den Lindwurm verfolgte, um seinen Sohn zu retten oder zu rächen. Die Freude des Wiedersehens war groß, und willig schloss sich der Graf den Helden an.
Dietrich und Hildebrand bestiegen Beutepferde, und das kleine Heer setzte sich in Bewegung. Man fand die Tore der Burg offen, aber im Hof die ganze zahlreiche Wehrmannschaft kampfbereit. Janibas, wie vorher schwarz gerüstet, hielt auf kohlschwarzem Rappen hinter den Reihen. Er murmelte Zaubersprüche, und sogleich stürzten Löwen auf die eindringenden Helden. Sie erlagen den geschleuderten Speeren, die Burgmannschaft den Schwertern, doch der Zauberer selbst entrann den Verfolgern. „Hei“, rief der Berner, „hätte ich Falke unter mir gehabt, der Hexenmeister wäre nicht ohne tüchtige Schrammen davongekommen.“ In der Burg fand man reichliche Speisevorräte und edlen Wein, aber auch noch drei Jungfrauen der Königin, nackt und bloß, die zur Mästung eingesperrt waren und vor Frost zitterten. Sie erhielten Gewänder, denn ihre Kleider und die der früher geschlachteten und verspeisten Jungfrauen gewährten hinreichende Auswahl.
Die Zauberherberge wurde beim Abzug den Flammen übergeben. Die Fahrt ging darauf weiter nach Aron, dem Burgsitz von Helfrich, der die Helden zuvor bewirten wollte, ehe sie den schwierigen Marsch nach dem Palast der Königin unternahmen. Man sah sich um so mehr zur Einkehr bei dem befreundeten Mann genötigt, da Dietrichs Wunde wieder aufbrach und eiterte. Man erreichte ohne weitere Abenteuer die gastliche Herberge. Die Hausfrau kam ihnen entgegen, umarmte den Sohn, um den sie schon viele Tränen vergossen hatte, und bot alles auf, die willkommenen Gäste zu pflegen. Besonders nahm sie sich Dietrichs an, verband seine Wunde und wandte so kräftige Heilmittel an, dass sie nach wenigen Tagen zu vernarben anfing. Als sich der Held wieder kräftig fühlte, trieb er zur Abreise, aber die gute Wirtin hatte immer einen Vorwand, die Gäste im Haus zurückzuhalten, und ihr Eheherr unterstützte sie, hielt bald ein großes Jagen, bald ein Festmahl, und schob den Termin ihrer Abreise immer weiter hinaus. Endlich wurde dieser auf den dritten Tag festgesetzt, und Helfrich versprach, ihr Führer und Geleitsmann nach Jeraspunt, dem Palast der Königin, zu sein.
Als die Recken noch darüber Absprache nahmen, sahen sie einen Zwerg auf windschnellem Ross daher jagen. Er trat auch bald in den Saal, wo sie bei vollem Becher saßen. Er war aber nicht, wie sonst, zierlich gekleidet und gerüstet. Sein Haar hing zerzaust um den Kopf, sein Mantel war zerschlitzt und bestäubt, sein Gesicht totenbleich. „Hilfe, edle Helden!“, rief er, und seine winzige Gestalt zitterte vor Hast oder Schrecken. „Helft der Königin Virginal! Janibas, der Sohn des schrecklichen Ortgis, bedrängt sie mit Hunden und Riesen. Er begehrt alle ihre Jungfrauen zur Jagd und zum Fraß und obendrein den leuchtenden Karfunkel in ihrem Stirnband. Wenn er den erlangt, dann wird seine Zauberkunst unwiderstehlich, und dann ist er Herr des ganzen Gebirges, aller Riesen, Zwerge und Lindwürmer, die sich darin aufhalten, und dann seid ihr auch selbst in seine blutigen Hände ausgeliefert.“
Sogleich erhob sich der Berner Held und erklärte, er werde ganz allein ausziehen, wenn die Recken noch zu warten gedächten. „Du allein?“, schrie das Männlein: „Oh, da bist du schon ein toter Mann. Musste doch selbst ich, der unüberwindliche Leibwächter, den Rücken wenden und entrann kaum den grässlichen Bestien.“ So ernst auch die Stunde und so dringend der Hilferuf war, konnte man sich doch des Lachens nicht erwehren, wenn man den schreckensbleichen Unüberwindlichen ansah. Indessen erhoben sich alle Recken und die Dienstmannen in der Burg, um den Berner in den gefährlichen Kampf zu begleiten. „Die Königin bedroht! Sie, die Segnungen über die Täler verbreitet, die unsere Saaten schützt und in Krankheit Heilung bringt! Wir wollen für sie in den Tod gehen!“ So riefen die Burgleute untereinander, bewaffneten sich und folgten den Recken.
Es war ein schlimmer, bald auch gefährlicher Weg, auf dem die Schar emporsteigen musste. Sie kamen über Schneefelder und Gletscher, wo sich oft Eisschlünde öffneten, die man früher nicht wahrgenommen hatte. Von Zeit zu Zeit, wenn man eine freie Höhe erreichte, sah man den leuchtenden Palast Jeraspunt, dann verschwand er wieder, und es schien den Helden, als rückten sie keine Handbreit näher. „Das schafft Janibas mit seiner Hexenkunst!“, rief der Zwerg: „Denn sein Zauberspiegel hat ihm schon gezeigt, dass wir über ihn kommen.“ Ein giftiger Nebel sank herab, doch erschien hoch darüber das Königshaus, wie von Himmelsglanz erhellt. Jetzt erkannten die Recken, dass sie nähergekommen waren und verdoppelten ihre Anstrengung. Schon hörten sie Kampfgetöse, Geschrei und Geheul, und bald sahen sie den entsetzlichen Kampf selbst.
Die Wächter des Palastes lagen zum Teil zerhauen und zerfleischt am Boden, einige versuchten sich noch zu verteidigen. Riesige Hunde mit klaffenden, blutroten Rachen, Unholde jeder Art sowie Horden von wilden Kriegern bestürmten den Palast. Viele waren schon durch die zertrümmerten Tore eingedrungen und wüteten, tobten und heulten um den Hochsitz der Königin, doch vermochten sie ihr selbst nicht zu nahen, denn ein Zauberkreis, so schien es, hielt die tobende Menge zurück. Unbewegt saß die Herrin, umgeben von ihren zitternden Jungfrauen, inmitten des wilden Aufruhrs. Ein leuchtender Karfunkel zierte das Diadem, das ihr Haupt umschloss, und ein Schleier, von Silberfäden gewoben, umwallte ihre Gestalt. War es der zauberische Reiz der Schönheit, der die Unholde bannte, oder die geheimnisvolle Magie der Liebe, die aus ihren Augen strahlte? Noch hatte weder ein Mensch noch ein Tier gewagt, den Kreis um die Herrin zu überschreiten.

Die Helden machten bei dem Anblick Halt, wie wenn sie selbst gebannt wären, aber dann stürmten sie vorwärts. Eine Wolke von Schnee und Hagel trieb ihnen entgegen, heulender Sturmwind hemmte ihre Schritte, aber sie strebten weiter. Da bebte von Donnerschlägen der Berg in seiner Grundfeste, und ein bodenloser Spalt trennte sie vom Palast. Doch nun erblickte Dietrich seitwärts den Schwarzen auf seinem Rappen, wie er von eherner Tafel seine Zaubersprüche las. Er stürzte auf ihn zu, zertrümmerte mit einem Schwertstreich die Tafel und schlug ihm mit dem zweiten Hieb den Kopf ab. Ein Donnerschlag rollte durch die Berge, Lawinen stürzten und Gletscher brachen, dann folgte Totenstille. Der Zauber war gelöst, der Erdspalt schloss sich, und der Weg nach dem Palast war frei. Dagegen wandte sich die Meute gegen die vorrückenden Helden, um ihren Herrn zu rächen, doch vergeblich, die Wurfspeere, Streitäxte und Schwerter der Recken und ihrer Dienstmannen schafften Raum. Allen voran kämpfte der Held von Bern, und bald flohen die Unholde, die noch am Leben waren, in die Einöde der Schneegebirge. Dietrich nahte jetzt an der Spitze seiner Gesellen dem Hochsitz der Königin. Er wollte vor ihr wie vor einer Göttererscheinung niederknieen, aber sie stieg zu ihm herab, reichte ihm die Hand und gab ihm den Liebesgruß mit einem Kuss. Er konnte kein Wort hervorbringen, ließ sich von ihr auf den Hochsitz geleiten und saß neben ihr, ein siegreicher, königlicher Held neben der von Liebe und Anmut strahlenden Königin. „Wisse, ruhmvoller Held“, sagte sie, „ich habe deine Liebe erkannt und deine Taten gesehen. So entsage ich meiner Herrschaft im Elfenland und will mit dir ziehen unter die sterblichen Menschen und bei dir wohnen, bis der Tod uns trennt.“
Der Palast wurde von unsichtbaren Händen gereinigt, das Tor, die Pfeiler und Säulen wurden in einer Nacht wieder aufgerichtet, und bald feierte man die Hochzeit des sterblichen Helden mit der Elfenkönigin. Da wurde der Palast von zauberischem Licht erhellt, und die Menschen, die das sahen, sprachen untereinander: „Wie glühen heute die Alpen so schön, dass man meint, Geister hätten drüben Burgen und Städte von rotem Gold erbaut.“ Auf der Höhe aber schloss ein reichliches Mahl den frohen Tag. Wie die heitere Rede hinüber und herüber wechselte, erblickte Hildebrand den Zwerg, der wankenden Schrittes durch den Saal ging und seine Nase wieder glührot gleich dem Firnschnee im Abendlicht zur Schau trug. „Heda, Bibung, unüberwindlicher Leibwächter, wo hast du während des Kampfes gesteckt?“ - „Im Hinterhalt, alter Junge!“, erwiderte selbstgefällig das Männlein: „Hätte euch der Schwarze in die Pfanne gehauen, dann wäre ich hervorgebrochen, euch zu rächen.“
Nach der Hochzeit zogen die Neuvermählten nach Bern, und Virginal stand daselbst dem königlichen Haushalt mit Ehren vor. Dietrich fühlte sich an ihrer Seite so glücklich, dass er lange Zeit nicht mehr an Abenteuer dachte. Auf den Bergen dagegen schienen die Elfen und die ganze Natur in Trauer um ihre Königin zu sein, die sich einem sterblichen Menschen vermählt hatte. Denn die schneebedeckten Gipfel glühten nicht mehr wie sonst, und der Wunderpalast war nicht mehr sichtbar.
In allen Ländern erzählte man von den Taten des Helden von Bern, und die Sänger erhoben seinen Ruhm. Deswegen kam auch mancher kühne Held, um unter seinem Banner zu kämpfen. Aber kein Widersacher wagte, in sein Reich einzufallen, und er selbst ließ es sich in der Heimat und an der Seite der hohen Königin wohl gefallen, so dass er gar nicht mehr daran dachte, ferne gefährliche Abenteuer aufzusuchen. Auch Hildebrand und Helfrich, der oft von Burg Aron herüberkam, und andere Helden ließen es sich bei Turnieren, Jagden und anderen festlichen Freuden wohl behagen.
Die Kampfgesellen Heime und Wittich
Der Ruf vom Berner Dietrich verbreitete sich auch in den nordischen Ländern. Man rühmte ihn nicht bloß in Burgen und Städten, sondern die fahrenden Spielleute sangen von ihm auch in abgelegenen Höfen und Herbergen. Da wohnte nun im tiefen Wald ein angesehener Pferdezüchter, der hieß Studas und kümmerte sich wenig um die Singerei und das Fiedeln der Fahrenden. Aber sein Sohn Heime hörte ihnen eifrig zu und ließ oftmals verlauten, er wisse Speer und Schwert ebenso gut zu gebrauchen, wie der Berner. Seinen Vater verdross dieser Übermut, und als sich der junge Recke wieder einmal vermaß, er gedenke es wohl im Kampf dem Berner gleich oder noch zuvor zu tun, rief er voll Ärger: „Dann geh doch hin in den hohlen Berg und schlage den Lindwurm tot, der so großen Schaden anrichtet!“ - Der junge Recke sah den Vater fragend an, warf ihm dann, als derselbe nickte, einen trotzigen Blick zu und ging seines Weges. „Er wird doch nicht“, brummte der Alte vor sich hin, „nein, nein, ich denke, ich habe ihm das heiße Blut abgekühlt.“ - Es war aber anders, als der ehrsame Studas sich vorstellte. Sein unverzagter Sohn wappnete sich, nahm Schwert und Speer, fing sich eins der edlen Rosse, die auf der Weide grasten, und ritt nach dem hohlen Berg. Der Lindwurm schoss mit aufgesperrtem Rachen auf ihn los. Aber der Recke schleuderte ihm mit sicherer Hand den Speer so kräftig zwischen den klaffenden Kinnladen in den Schlund, dass die Spitze am Hinterkopf weit herausragte. Das Untier schlug noch grimmig mit dem Schweif, bis es verendete. Nun hieb ihm Heime den Kopf ab, ritt nach dem Gehöft zurück und warf ihn dem alten Pferdezüchter vor die Füße. - „Heiliger Kilian!“, rief Studas: „Junge, hast du den Linddrachen totgeschlagen, dann...“ -- „Dann werde ich auch den Berner totschlagen“, setzte der kühne Recke die Rede fort: „Gib mir den Hengst, der mich soeben ohne zu scheuen gegen den Wurm trug! Er wird mich auch nach Bern und wohlbehalten wieder zurücktragen.“ Dem alten Mann schwindelte schier der Kopf bei den kecken Reden seines Sohnes. Er sah aber das Beutestück vor seinen Füßen liegen und konnte keinen Widerspruch erheben. Heime erhielt den Hengst und ritt hinaus, in die bisher ihm unbekannte Welt.
In der Königshalle zu Bern saßen die Recken beim Gelage, und die Königin Virginal schenkte den Purpurwein, der von ihrer Hand gereicht, den Gästen besser mundete, als wenn ihn der grämliche Mundschenk bot. Man rühmte den Frieden im Lande, und mancher unverzagte Recke sprach von früheren Taten und meinte, man habe lange genug der Ruhe gepflogen, die Schwerter rosteten in den Scheiden, und es sei an der Zeit, sie blank zu ziehen. Wie die Helden so plauderten, trat ein fremder gewappneter Mann ein. Derselbe war breit von Schultern, mächtig von Wuchs und schien noch jung an Jahren. Meister Hildebrand trat ihm entgegen und hieß ihn als Gast willkommen, forderte ihn aber auf, sein Streitgewand abzulegen. „In der Königshalle führen die Helden nicht Helm und Rüstung“, sagte er, „da tragen sie Purpur und Seide.“ - „Mein Gewerbe ist der Kampf“, versetzte der Fremdling, „denn ich bin Heime, des Höfners Studas Sohn. Ich will mich mit dem ruhmvollen Berner draußen auf offenem Feld versuchen, ob er mich besiegen kann.“ Er hatte die Worte so laut gesprochen, dass alle Recken und auch der König sie vernahmen. Und Dietrich erhob sich von seinem Hochsitz, indem er sagte: „Wohlauf, edle Helden, zum fröhlichen Spiel! Wir wollen sehen, ob der Sohn des Rossmanns die Probe hält.“ Der König ließ sich wappnen, bestieg seinen edlen Hengst Falke und hielt bald dem kühnen Heime gegenüber.
Beide Helden rannten mit großer Gewalt gegeneinander, aber ihre Lanzen glitten an den Schilden ab, ohne zu verletzen. Dasselbe geschah beim zweiten Rennen, aber beim dritten wurden die Schilde durchbrochen, des Königs Ross sank auf die Hinterknie zurück, doch wankte der Held nicht im Sattel, sondern trieb das Pferd mit Zügel und Sporen wieder auf. Dagegen war Heimes Rüstung an der Seite aufgerissen und aus einer Schramme floss etwas Blut. Da die Lanzen zersplittert waren, sprangen die Kämpfer von den Pferden und griffen zu den Schwertern. Sie trieben sich hin und her, bis endlich der Berner mit einem kräftigen Schlag den Gegner auf das behelmte Haupt traf, dass er in die Knie sank. Indessen sprang er ebenso schnell wieder auf und führte mit höchster Gewalt einen Streich auf Dietrichs Helm. Hildegrim aber widerstand, und die spröde Klinge Heimes sprang in Stücke. Nun stand er wehrlos dem erzürnten König gegenüber, dessen furchtbare Waffe schon über seinem Haupt schwebte. Aber der Sieger konnte den Todesstreich nicht ausführen. Ihn jammerte die Jugend und der Mut des unverzagten Recken, der furchtlos vor ihm stand. Er senkte das Schwert und bot dem Gegner die Hand zum Frieden. Dieser Großmut beugte mehr, als Waffen es tun konnten, den Trotz des kühnen Helden. Er nahm die dargebotene Hand und sagte laut, er bekenne sich für überwunden und gelobe, dass er forthin ein Dienstmann des ruhmvollen Königs von Bern sein werde, dem er nunmehr den Eid unverbrüchlicher Treue schwöre. Erfreut, einen Mann wie Heime zum Gesellen erworben zu haben, begabte ihn der reiche König mit Burgen und Knechten und behielt ihn an seinem Hof.
Fest steht der Himmel droben und ohne Wanken;
Was Menschen auch geloben, sind nur Gedanken,
Die tauchen auf und scheiden bald früh, bald spät,
Vertraue nicht den Eiden, die Weisheit rät.
Dietrichs Geselle Wittich
Auf einem Felseneiland in der Nähe von Seeland, wo meist nur Fischer und Seeleute wohnten, schallten Tag für Tag und oft spät bis in die Nacht gewaltige Hammerschläge, dass die Felsen dröhnten. Daselbst wohnte nämlich seit Jahren der Schmied Wieland, dessen Sage berichtet: Er hatte sein liebliches Weib Allweiß, zu der ihn kunstreich gefertigte Flügel emporgetragen hatten, durch den Tod verloren, und war deshalb von den seligen Höhen niedergestiegen, um in Ausübung seiner Kunst Linderung seiner Trauer zu finden. Hier fand er die noch immer schöne Böswild wieder, die er einst geliebt, aber in unstillbarer Begierde nach Rache vergewaltigt und geschwängert hatte. Sie war durch ihr Unglück sanft und mild geworden und pflegte mit mütterlicher Sorgfalt ihren und seinen Sohn Wittich, einen munteren, kräftigen Knaben, des Vaters Ebenbild. Da gedachte der Meisterschmied sein Unrecht wiedergutzumachen, sie zu heiraten und mit dem Kind in sein einsames Gehöft aufzunehmen. Die Eheleute lebten danach in Eintracht, da sich der Schmied, nur mit seiner Kunst beschäftigt, nicht um den Haushalt noch um den kräftig aufwachsenden Jungen kümmerte, vielmehr alles dem Willen der Frau anheimstellte. Doch hatte er Freude an den Spielen des Kindes und später an den Übungen des heranreifenden Jünglings. Da machte er ihm Stahlbogen und Pfeile und Wurfspeere mit gehärteten Spitzen, die selbst in Bärenfelle einbissen. Wenn dann der Bursche ein fettes Wild oder gar einen Keiler oder Bären erlegte, oder Schneehühner und Wildgänse aus hoher Luft herunterholte, strich er ihm über das krause Haar und sagte: „Du bist ein Schütze, wie mein Bruder Eigel.“
Der junge Wittich wollte gern mehr wissen von dem berühmten Schützen, und der Schmied, der gerade Feierabend gemacht hatte, erzählte gern von den Begebenheiten aus seiner Vergangenheit: „Mein Bruder Eigel kam einst zu einem König der Niaren und trat bei ihm als Leibschütze in Dienst. Alle Welt bewunderte seine Kunst, wie er einem Aar (Adler), der sich zu den Wolken aufschwang, den Kopf wegmähte, einem Luchs im Wipfel einer Eiche die rechte oder linke Tatze an den Ast nagelte, worauf er saß, einer zischenden Natter die Zunge aus dem Rachen wegschoss und andere Künste. Aber der König verlangte einen Meisterschuss. Er sollte seinem eigenen Kind auf hundert Schritte einen Apfel vom Kopf schießen. Wenn er sich dessen weigerte oder das Ziel verfehlte, dann drohte der König, den Knaben vor seinen Augen in Stücke hauen zu lassen. Eigel zog drei Pfeile aus dem Köcher und legte einen auf den Bogenstrang. Und der Knabe stand fest und schaute ohne zu blinzeln dem zielenden Vater ins Angesicht. - Hättest du das auch getan, mein Junge?“ - „Nein Vater“, sagte Wittich keck: „Ich hätte mir dein Schwert Mimung geholt und dem grässlichen König den Kopf abgehauen und seine Krieger, wenn sie zur Rache gekommen wären, aus dem Land gejagt.“ - „Schön, junger Held!“, lachte der Alte: „Aber ein wahrer Held redet nur von dem, was er getan hat, nicht von dem, was er getan hätte. Wäre Eigel so klug gewesen, dann wäre er besser gefahren. Doch Eigel konnte seine Prahlerei nicht zügeln, sondern sagte dem König, nachdem der Meisterschuss gelungen war: ‚Die zwei anderen Pfeile waren für dich bestimmt, wenn der erste meines Sohnes Haupt getroffen hätte.‘ Damals nahm der König das kühne Wort wohl auf, aber er gedachte dessen und verjagte später den Schützen ohne Dank und Lohn aus dem Land. Niemand weiß, wohin er gekommen ist.“

So plauderte der Schmied oft redselig mit seinem Sohn, doch wollte ihm mit der Zeit das Gebaren desselben nicht gefallen. Denn Wittich schwärmte Tage und Nächte auf dem Eiland herum, jagte Wild, auch Wölfe und Bären, schiffte kühn durch Sturm und Wellen nach Seeland über und trieb dort mit gleichgearteten Müßiggängern allerlei Kurzweil, wobei es oft blutige Köpfe gab. Man rühmte zwar seine Stärke und Verwegenheit und erzählte, er habe grimmige Bären ohne Waffen eingefangen und sogar einen jungen Lindwurm mit bloßen Händen erdrosselt, aber der alte Schmied meinte, das sei nutzloser Zeitvertreib. Noch weniger gefiel es ihm, wenn der Junge oft halbe Tage in seiner Werkstatt herumlungerte, oder in die Glut des Schmiedefeuers unter der Esse blickte, ohne Hand und Fuß zu rühren.
„He, Junge!“, rief er ihm einstmals zu: „Es ist Zeit, dass du ein nützliches Gewerbe lernst, damit du dein Brot verdienst, wie meine Brüder und ich getan haben. Willst du meine Kunst erlernen, dann kannst du es durch meine Lehre so weit bringen, dass kein Dritter in allen Ländern bessere Waffen und schönere Kleinodien fertigt. Sieh dort meine mit Gold und Silber gefüllten Truhen: Das sind Schätze, die ich mit Hammer und Zange ehrlich verdient habe. Gleich hierher an den Amboss!“ - „Und was hast du davon für Gewinn?“, fragte der Bursche trotzig: „Ein rußiges Gesicht und geschwärzte Hände, dass dich die Mutter nimmer küssen mag. Ich aber will mir das rote Gold mit Speer und Schwert erwerben und dessen froh werden in den Königshallen, wo man mutige Helden wohl aufnimmt.“ - Der Alte sah ihn verwundert mit offenem Mund an. - „Ja, ja“, fuhr er fort, „Hammerschaft und Zangengriff kommen nicht in meine Hände, noch das rußige Schurzfell an meinen Leib. Ich bin von königlicher Abkunft, stamme von König Wilkinus, deinem Großvater, und vom König der Niaren, dem Vater meiner Mutter. Die schlugen mit blanken Waffen auf Helme und Schilde, nicht an der Esse auf alte Eisenstangen. Sie kämpften um Königreiche und Heldenruhm. Du arbeitest um Hundelohn und um die Ehre, den ganzen Tag im Essenqualm zu schwitzen. Gib mir eine Rüstung und das gute Schwert Mimung, dann gehe ich nach Bern, um mit dem König zu kämpfen und ein Reich zu erwerben.“ - „Mit dem Berner kämpfen!“, rief der Alte: „Junge, da verlierst du deinen Kopf, den ich dir mit aller Kunst nicht wieder anschweißen kann. Oder du wirst genauso auf nimmer Wiedersehen verjagt, wie mein Bruder Eigel vom Vater deiner Mutter. Oh mein Junge!“ - Er redete den baumhohen Sohn immer noch in der alten, vertraulichen Weise an: „Junge, dein Bisschen Klugheit und Hirn…“ - Er wollte noch mehr sagen, aber die Hausfrau trat ein und fragte, den Meister unterbrechend, nach der Ursache des Streites zwischen Vater und Sohn. Als sie darüber Auskunft erhalten hatte, war sie Anfangs betroffen, bald aber gedachte sie des Ruhmes ihrer Ahnen, und ihre Zungenfertigkeit ließ den Gemahl gar nicht mehr zu Wort kommen. Er musste wohl oder übel seine Zustimmung geben.
Acht Tage arbeitete der Meister an dem Heergewand seines kühnen Sohnes, dann war das Werk vollendet. Oben auf dem lichten Helm starrte als Bügel eine Natter mit glühroten Augen von Rubin. Die Brust- und Beinrüstung war von dicken Stahlringen und doch so biegsam, als ob sie aus weichem Leder wäre. Auf dem stahlglatten Schild waren Hammer und Zange abgebildet und mit drei leuchtenden Karfunkeln verziert. Am kostbarsten schien dem jungen Recken das Schwert Mimung, Wielands Meisterwerk aus jungen Jahren. Als der Schmied dem Sohn die Waffen überreichte, sagte er: „Das Stahlgewand ist gut und sehr fest. Es wird dich in Kampfesnot wohl bewahren. Das Schwert aber habe ich mit großer Kunst hergerichtet, gestählt und geschärft, dass es in Stahl und Stein beißt, ohne schartig zu werden. Es galt damals Haupt gegen Haupt im Wettkampf mit Amilias, dem Werkmeister des Königs der Niaren, der mich aus Neid und Eifer herausgefordert hatte. Er erbot sich, Helm und Rüstung in Jahresfrist zu schaffen, die keine Waffe verletzen könne. Und ich sollte in dieser Frist ein Schwert anfertigen und damit drei Hiebe auf ihn tun, wenn er in seinem Harnisch-Fass sitze. Bliebe er unverletzt, dann werde er mir das Haupt abschlagen. Erhalte er eine Verletzung, dann dürfe ich ihm das Gleiche tun. Er schuf darauf in zwölf Monden mit Hilfe seiner Schmiedeknechte das Wehrgeschmeide, ich aber den Mimung in dreimal sieben Tagen. Nach Verlauf der Frist saß er geharnischt vor dem König und allen Hofleuten. Da setzte ich oben am Helm die gute Klinge an, drückte ein wenig, und sie schnitt durch Helm, Haupt, Rüstung und Leib bis auf den Sitz, so dass der Mann in zwei Hälften auseinanderfiel. Nun sage ich dir, mein Junge, kein Meister in der Welt, weder zu dieser Zeit noch in der künftigen, wird wieder ein solches Schwert schaffen. Nimm es aus der Vaterhand als Erbteil und gebrauche es gut! Nun aber merke weiter auf das, was ich dir zu sagen habe:

Dein Urahn, König Wilkinus, war ein tüchtiger und streitbarer Held, der große Taten verrichtete und Reiche eroberte. Er fand einstmals eine Meerjungfrau am Strand, gleich wie ich selbst die schöne Allweiß. Sie hieß Wachilde, empfand Liebe zu dem edlen Helden und blieb ihm sein Leben lang in treuer Liebe zugetan. Als er im Sterben lag, versprach sie ihm, ihrer beider Nachkommen eingedenk zu sein und sie zu beschützen, wenn sie bei ihr Zuflucht suchten. Kommst du also in Not, dann versuche das Meer zu erreichen. Dort nimmt dich unsere Ahnfrau in ihre Obhut.
Ihr und des Königs jüngster Sohn Wade, dein Großvater, war zwar von riesenhaftem Wuchs, aber er liebte den Frieden. Er duldete es daher, dass ihn seine habgierigen Brüder von der Herrschaft ausschlossen und begnügte sich mit den Höfen, welche ihm der König zu seinen Lebzeiten übertragen hatte. Ebenso genügsam war ich selbst, sein jüngster Sohn, und meine beiden Brüder hatten gleichfalls kein Verlangen nach hohen Dingen. Der Riese Wade wollte, dass jeder seiner Söhne ein nützliches Gewerbe lerne, und wandte darauf allen Fleiß. So wurde Slagfider der beste Arzt, Eigel der geschickteste Bogenschütze und ich selbst ein tüchtiger Schmied. „Die Menschen unserer Zeit“, pflegte Riese Wade zu sagen, „lernen vielerlei Dinge und darum keines richtig. Man sollte ein einziges Gewerbe lernen und damit früh anfangen, nur dann gelangt man darin zur Meisterschaft.“ Deswegen gab er mich, sobald ich neun Winter alt war, zu dem Kunstschmied Mimir in die Lehre, und ich hielt bei ihm drei Jahre aus und lernte Wehrgeschmeide und menschliche und tierische Bildnisse herstellen, obgleich ich von einem viel stärkeren Lehrburschen, dem Jungherrn Siegfried, hart bedrängt und geschlagen wurde. Darnach gab mich der Vater zu den Zwergen im Kallawa-Berg. Als ich bei den Männleins sehr geschickt wurde und manche Werke besser machte, als sie selber, wollten sie mich gern in dem hohlen Berg behalten und sagten dem Riesen Wade, ich solle noch ein Jahr bei ihnen zu Herberge sein, dann solle er mich zu derselben Stunde heimholen. Wenn er aber nicht komme, dann wollten sie meiner auf Lebenszeit pflegen. Er bemerkte ihre Tücke und verbarg vor meinen Augen sein gutes Schwert unter einem Felsen, dass ich mich ihrer erwehren könnte, wenn sie mich mit Gewalt zurückhalten wollten. Als er zur gesetzten Frist erschien, hielten sie den Berg verschlossen und schafften, dass ein Felsen auf ihn herabrollte und ihm das Haupt zerschlug. Ich sprang bei dem Getöse mit ihnen hinaus, ergriff das Schwert und schaffte mir Raum, indem ich viele von den Männlein niederstreckte. Und wie ich dann mit meinen Brüdern ins Wolfstal zog und dort Allweiß an einem Brunnen fand, habe ich dir bereits erzählt. So war meine Lehr- und frühere Lebenszeit recht mühselig. Und die deinige wird es nicht minder sein, da du beharrst, ein ruhmreicher Recke zu werden. Du wirst in kurzer Frist mehr Schläge erhalten, als ich in meinem langen Leben. Indessen sei getrost, denn ich meine, es wird sich nicht leicht ein so gutes Schwert finden, das sogar in Schilde und Rüstungen beißt, die mein Hammerschlag gefestigt hat. Dazu gebe ich dir den Hengst Skemming, der dich in Sicherheit trägt, wenn du vor einem stärkeren Gegner entweichen musst.“
„Ich bin ein fluchtträger Reiter!“, lachte der junge Recke: „Aber nun gib mir noch die rußige Hand, die mir so edle Gaben verliehen hat.“ Darauf nahm er auch Abschied von der Mutter, die ihn lange in den Armen hielt, bestieg Skemming und trabte nach dem Strand, wo ihn und sein Ross ein großes Boot aufnahm und nach dem Festland überführte. Er ritt mehrere Tage fort und zehrte von den Vorräten, womit ihn die sorgliche Mutter versehen hatte. Ein breiter Strom hemmte seine Heldenfahrt. Er wollte eine Furt oder Brücke aufsuchen und trabte deshalb immer am Ufer hin zu Tal. Als er keinen Übergang fand, beschloss er, die Tiefe des Wassers zu untersuchen, weil es ihm schwer dünkte, dass Skemming schwimmend einen gewappneten Mann hinübertrage. Er zog deshalb Rüstung und Gewand aus und ging ins Wasser, das ihm, wie er weiter watete, bis über die Schultern schlug. Da sah er auf derselben Seite, wo er stromabwärts geritten war, drei stattliche Recken stromaufwärts reiten. Als ihn diese erblickten, riefen sie ihm spottend zu: „He, Robbenhund, Fischmensch, wohin des Weges?“ - „Seid ihr wahrhafte Recken“, versetzte er, „dann lasst mich mein Streitgewand anlegen, dann will ich euch mit Schild und Schwert Rede stehen.“ Das vergönnten sie ihm willig. Als sie ihn dann aus dem Wasser hervorgehen sahen, verwunderten sie sich über seine gewaltigen Glieder, und noch mehr, als er gewappnet zu Pferde saß, wie er Skemming lenkte und kühn auf sie zuritt. Da dünkte es ihnen rätlicher, in dem fremden, wilden Land ihn zum Gefährten, als zum Gegner zu haben. Sie boten ihm daher Frieden an und gaben ihm freundlichen Handschlag. So freuten sie sich auch, als sie hörten, dass er nach Bern zu reiten gedenke und lange stromabwärts geritten war, ohne einen Übergang zu finden. „Du bist ein Vogel, der noch nicht lange flügge ist“, sagte der älteste von den Männern, „sonst hättest du gewusst, dass man stromaufwärts reiten muss, um der Quelle näherzukommen. Doch folge uns getrost, wir kommen bald an eine Brücke, wo man gegen Zoll übersetzen darf.“
Der Recke hatte wahr gesprochen, aber jenseits war ein Kastell erbaut und daraus trat eine Schar von zwölf wilden Männern, die wie Räuber anzusehen waren. Sie ritten über die Brücke und schienen Lust zu haben, den Recken den Weg zu verwehren. „Die Schufte sind uns an Zahl weit überlegen“, sagte der älteste von den Recken, „doch, denke ich, wir werden ihnen mit unseren Waffen den Zoll bezahlen.“ - „Lasst mich vorausreiten!“, rief Wittich: „Ich will ihnen ein Geld anbieten, da werden sie wohl ausländische Männer in Frieden fahrenlassen.“ Er sprengte nach diesen Worten eilends auf die Brücke zu. Als ihm die Brückenwächter nahe waren, bat er um friedlichen Durchlass, aber sie forderten höhnisch sein Pferd, seine Rüstung, Kleider, den rechten Fuß und die rechte Hand. Er sagte ihnen, wie er das alles nicht entbehren könne, und bot seinen Zoll. Sogleich griffen sie ihn mörderisch an, doch ihre Waffen bissen nicht ein auf Wielands Werk, er aber zog Mimung und versetzte ihnen gewaltige Hiebe.
Die drei Recken hielten indessen ruhig auf einer Anhöhe. „Hei, wie der junge Held sein Ross tummelt!“, rief der ältere: „Wie er die Strolche bläut! Da fällt ein Strauchdieb in zwei Stücke gehauen vom Hengst! Aber jetzt kommt die ganze Rotte über den einsamen Kämpfer. Es ziemt sich, dass wir ihm Beistand leisten, denn wir haben Wehrgenossenschaft geschlossen.“ - „Es mag uns wenig helfen, ob er heil bleibt, oder ob ihm der Schädel zerklopft wird“, meinte der zweite. „Seine Niederlage bringt uns sicherlich Unehre“, sagte der dritte und spornte sein Ross nach der Kampfstätte, wohin ihm der erste mit gleicher Hast folgte. Doch ehe sie die Walstatt erreichten, lagen schon sieben Räuber erschlagen, die übrigen ergriffen bei ihrem Anblick die Flucht.
Die Helden ritten nunmehr ohne Aufenthalt über die Brücke in das Kastell, wo sie reichliche Vorräte an guten Speisen und Getränken fanden. Sie hielten Gelage bis spät in die Nacht. Da wurden die Zungen gelöst, und sie erzählten von ihren Taten und Geschlechtern. Wittich wusste nicht viel von sich, desto mehr von seinem Vater zu berichten. Von den Gefährten aber erfuhr er, dass der ältere Meister Hildebrand, der zweite der starke Heime und der dritte Fürst Hornboge, auch ein Geselle Dietrichs war. „Hei, wie das eine gute Sache ist!“, rief der junge Recke erfreut: „Ich will auch nach Bern reiten und mich mit dem ruhmvollen König Haupt gegen Haupt versuchen, und ich habe guten Mut, einen Sieg zu gewinnen, denn ich führe Mimung, meines Vaters Schwert, das in Stahl und Stein beißt, und ihr habt gesehen, was die Klinge für Arbeit schafft.“ Als die drei Gesellen das hörten, wurden sie viel stiller als zuvor, sprachen von Ermüdung und begaben sich bald zur Ruhe, was auch Wittich tat, nachdem er noch einen mächtigen Becher geleert hatte.
Der junge Held schnarchte bald mit Heime und Hornboge um die Wette, aber Meister Hildebrand konnte nicht einschlafen. Es war ihm, als läge ein Alb auf seiner Brust, und der Alb war die Sorge um seinen Herrn. Er hatte Mimungs Werke mit eigenen Augen gesehen, und er kannte auch sonst die Güte des Schwertes. „Hildegrim“, dachte er, „kann der Klinge Wielands nicht widerstehen, und der Arm des jungen Helden ist wie der des stärksten Riesen. Ha! Hohn und Schmach, wenn der Jungspund den Berner überwindet!“ Mit einem Mal lachte er, dass ihm der lange Geißbart wackelte. Er stand auf, zog Wittichs Schwert hervor und legte das eigene daneben. Er verglich beide Waffen bei hellem Mondschein und fand, dass sie einander sehr ähnlich waren, die Klingen von gleicher Länge und Breite und gleichhell poliert. Die Griffe, Scheiden und Gürtel freilich nicht, doch dafür wusste der Meister schon Rat. Er schraubte die Griffe mit Geschick und großer Gewalt ab und vertauschte die Klingen. Niemand konnte den Tausch wahrnehmen. Darauf begab er sich wieder aufs Lager und schnarchte bald gleich den anderen.
Der Morgen weckte die Helden. Sie nahmen ein Frühmahl und ritten wohlgemut des Weges, den Hildebrand wohl kannte. Sie gelangten an den Fluss Wisera (Weser) da, wo er schmal und sonst eine feste Steinbrücke war. Doch sie fanden diese abgebrochen und sahen jenseits die entronnenen Raubgesellen stehen, welche ihnen höhnische Schmähworte zuriefen. Sogleich trieb Wittich seinen guten Hengst Skemming mit den Sporen an, und der flog wie ein Pfeil über den Strom auf den gegenüberliegenden Felsen und mit einem zweiten Sprung mitten unter die Strolche, die von allen Seiten ihren Todfeind angriffen. Heimes Hengst Rispe, ein Bruder Skemmings, hatte den gleichen Sprung getan, aber der Reiter verhielt sich müßig beim Kampf angesichts der Bedrängnis seines Gesellens. Erst später gelangten Hildebrand und Hornboge an, weil ihre Rosse den tiefen Strom schwimmend überqueren mussten. Bis dahin wurde schon das Feld geräumt, und als die Räuber sich durch Flucht zu verbergen suchten, da tat Skemming so gute Dienste, dass nicht einer entrann. Die siegreichen Recken trabten weiter und waren gar vergnügt über ihr Tagwerk, während Heime düster und schweigsam blieb. „Sei nur auch guten Mutes!“, sagte Wittich zu ihm: „Ich weiß wohl, dass du kein feiger Recke bist. Du wolltest mir die Ehre des Tages allein gönnen, und deswegen hieltest du das Schwert in der Scheide.“
Manchen Tag ritten die Helden durch Heide- und Moorland und durch einen Bergwald, bis sie an eine geräumige Burg kamen. Dort wohnte zu jener Zeit Frau Ute, Hildebrands Ehefrau. Sie empfing gastlich die müden Männer und pflegte ihrer reichlich, doch nahmen sie bald von ihr Abschied und gelangten folgenden Tages zu guter Zeit nach Bern.
König Dietrich saß beim Mahl, als ihm die Botschaft von der Ankunft seines lieben Meisters samt dessen Gesellen gebracht wurde. Er stand sogleich auf, ging ihnen entgegen und begrüßte seine Getreuen, aber nicht den ihm unbekannten Wittich. Da zog dieser einen silberbeschlagenen Handschuh ab und überreichte ihn dem König. Der sah den Fremdling erstaunt an. Bald aber erwachte sein Zorn, und er warf ihm das Fehdezeichen ins Gesicht, indem er ausrief: „Soll der König jedem Landstreicher zur Zielscheibe dienen, dass er an ihm sein Schwert und Dolchmesser versucht? Heda, meine Mannen, ergreift den Wicht, bindet und hängt ihn draußen an den höchsten Galgen!“ - „Wahrlich, du hast hier Gewalt“, versetzte Wittich, „und du kannst mich durch die Menge deiner Knechte überwältigen, aber bedenke, ob solches Gebaren deinem königlichen Heldenruhm nicht einen nachtdunklen Flecken eindrückt, der ihm für lange Zeiten bleibt.“ Als die Kriegsleute auf den Wink des zürnenden Herrschers vorrückten, trat Meister Hildebrand dazwischen. „Herr“, rief er, „der Mann hier ist Wittich, der Sohn Wielands, des Schmiedes, der in allen Landen berühmt ist. Er dünkt mich kein verräterischer Mann und wohl wert zu sein, dass du ihn unter deine Gesellen aufnimmst, wenn du seiner mächtig wirst.“ - „Gut, Meister“, erwiderte Dietrich, „ich will ihn bestehen. Aber wenn er Nagelring nicht verträgt, dann ist er dem Knüpfauf verfallen. Der soll ihm die Gurgel schnüren, dass er schnalzt wie ein Fisch auf dem Festland. Das ist mein letztes Wort. Nun gleich fort zum Turnierplatz!“
Nicht bloß Hofmänner und edle Frauen strömten aus den Toren von Bern, sondern auch zahlreiche Insassen, Jung und Alt. Sie alle wollten den Kampf der Helden auf Leben und Tod schauen. Schon standen die Recken des Streites gewärtig, da reichte Heime dem König einen vollen Becher Wein, und Hildebrand tat das Gleiche dem jungen Kämpfer, der freundlos war, begafft von der Menge, die ihm eine Niederlage wünschte. „Hab Dank, lieber Geselle!“, sagte er, den Becher leerend: „Du hast mir Wohltat erwiesen, die möge dir Gott vergelten.“ Nun sprangen die Helden auf ihre Rosse und rannten mit Lanzen gegeneinander. Die edlen Hengste schienen gleich vortrefflich im Lauf und Sprung, und auch die Reiter wankten beim Zusammentreffen nicht im Sattel. Aber Dietrichs Lanze glitt am blanken Schild des Gegners ab, Wittichs Lanze durchbrach des Königs Schild und ging an dessen Rüstung in Stücke. Als darauf Dietrich nochmals anrannte, zerhieb Wittich dessen Lanze mit dem Schwert. Nun sprangen die Kämpfer von den Rossen und griffen sich mit blanken Klingen an. Niemals hatte man ein solches Fechten und solche gewaltigen Schläge gesehen. Allmählich gewann der starke König die Oberhand, obgleich weder er noch sein Gegner von den schrecklichen Schlägen verwundet waren. Mit einem Streich, der jeden anderen Helm gespalten hätte, außer Wielands Werk, fällte er ihn zu Boden. Aber Wittich sprang sogleich wieder auf, warf den Schild auf den Rücken und führte mit beiden Händen einen nicht minder starken Hieb auf Dietrichs Haupt. Hildegrim blieb unversehrt, während der spröde Stahl in Wittichs Hand zerbrach. „Sei verdammt, Vater, zur Hölle!“, rief er: „Das ist nicht Mimung, du hast mich betrogen!“ So stand er wehrlos vor dem König, dessen Nagelring schon wieder über seinem Haupt blitzte. „Ergib dich, Strolch!“, rief der zornige König: „Und fahre zum Galgen!“ Es war um den jungen Kämpfer geschehen, aber Hildebrand sprang dazwischen. „Herr“, sagte er, „schone des Wehrlosen Leben. Nimm ihn zum Gesellen an, denn du findest in der Welt keinen besseren Helden, der in unsere Genossenschaft eintreten könnte.“ - „Er ist dem Henker verfallen!“, antwortete der Berner: „Zurück, Meister, dass er noch einmal vor mir den Staub leckt.“
Da deuchte es dem Meister, er habe übelgetan, als er dem jungen Helden das Schwert vertauscht hatte. „Hier, stolzer Recke, ist dein Mimung“, sagte er, ihm das Schwert von seiner Seite reichend, „und nun, Dietrich, bewahre dein Haupt vor Mimung!“
Der Kampf begann mit neuer Wut. Da und dort schnitt das Schwert in Wittichs Faust durch die starken Ringe seines Gegners. Stücke von dessen Schild fielen zu Boden, ein mit aller Kraft geführter Streich traf den Helm Hildegrim, und der widerstand nicht. Die eine Seite desselben war, als ob sie von weichem Wachs wäre, abgehauen, und reichlich strömte des Königs Blut aus mehreren Wunden. „Ergib dich, König!“, rief der siegreiche Recke, aber Dietrich kämpfte weiter, obgleich ihm die furchtbare Klinge immer neue Wunden schlug. Da sprang der Meister abermals zwischen die Kämpfer, indem er Waffenruhe gebot. „Wittich“, rief er, „lass ab, denn nicht deine Kraft, sondern Wielands Schwert bringt dir Gewinn. Werde unser Geselle, dann gehört uns die Herrschaft über alle Länder, denn nächst dem König bist du der kühnste von allen Helden.“ - „Meister“, sagte Wittich, „du hast mir hier in der Not beigestanden. So will ich deinen Rat nicht missachten. Wisse, ruhmvoller Held von Bern“, wandte er sich an den König, „ich bin hinfort dein Mann und gelobe dir Treue, solange ich das Leben habe.“ Der König ergriff die dargebotene Rechte und verlieh dem erworbenen Gesellen alsbald Burgen und Dienstleute, über welche er als Graf frei walten sollte.
Sobald die Wunden des Königs etwas vernarbt waren, veranstaltete er ein festliches Gelage. Zu seiner Rechten saß Wittich, zu seiner Linken Heime, gegenüber Waffenmeister Hildebrand. Spielleute sangen im Hintergrund zum Saitenklang fröhliche Lieder. Wie die Gäste fleißig den Becher leerten, wurden sie heiteren Mutes. Sie rühmten den Herrscher, seine Kühnheit im Kampf, seine Güte, womit er die Getreuen belohnte. Heime, vornehmlich aber Wittich, stimmten ein. Sie verhießen, ihm jeden Dienst zu tun und Blut und Leben nicht zu schonen. Dietrich drückte den mächtigen Helden die Hände, löste zwei schwere Goldketten von seinem Halse und begabte sie damit. Da erhob sich unter den Spielleuten ein greiser Mann mit seiner Harfe und sang mit gewaltiger Stimme:
Es hält sie fest im Arme
Der Berner Held voll Kraft;
Trutz jedem, der mit Harme
Die Waffenbrüderschaft
Antastet! Sie erheben,
Wie Felsen stark, den Bund;
Doch auch Felsen erbeben,
Gelöst vom sicheren Grund.
Hoch stand der alte Spielmann, allen sichtbar, unter seinen Genossen, die ihn nicht kannten. Er wiederholte die letzten Worte immer mächtiger, so dass eine lautlose Stille entstand. Darauf schritt er durch den Saal, und niemand wusste, woher er gekommen war. „Ein Seher der Zukunft! - Ein Lügengeist! - Ein Höllenspuk!“ riefen die Gäste untereinander. Waffenmeister Hildebrand aber sagte bedeutsam: „Lasst uns alle auf unserer Hut sein, denn auch die Hölle kann Wahrheit sprechen.“
Die Geschichte von Seeburg, Ecke und Fasolt
Zu Köln am blanken Rhein saß einst eine Königin, die hieß Seeburg. Sie war reich an Gütern, noch reicher an Schönheit. Sie war blühend wie ein frischer Maientag, wenn er blumenbekränzt, begrüßt von befiederten Sängern, durch die Länder zieht. Zwei Schwestern ruhten neben ihr auf dem Hochsitz, die eine zur Rechten, die andere zur Linken, jene heiter und lachend, gleich dem aufgehenden Morgen, diese ernst und sinnig, gleich dem Abend, wenn er hinter goldenen Wolken niedergeht. Viele fürstliche Helden hielten sich am Hofe der edlen Frauen auf und strebten durch kühne Taten nach ihrer Liebe. Unter allen ragten durch tapferen Mut, durch Ruhm und Besitztum drei Brüder hervor, Söhne des einst mächtigen Königs Mentiger und einer Meerjungfrau. Sie hießen Ecke, Fasolt und Ebenrot. Viele Abenteuer hatten sie bisher siegreich bestanden, und kein Kämpfer wagte es, gegen sie in die Schranken des Turnierplatzes zu treten. Sie saßen beim Gelage den Königinnen gegenüber und leerten die Becher mit Lust, welche die schönen Frauen ihnen füllten. „Den Recken möchte ich sehen“, rief Ecke, „der dieses Reich in Not bringen könnte, wenn wir seine Grenze behüten.“ - „Es lebt doch ein Held, der uns zu bestehen wagt“, sagte Fasolt nachdenklich, „er, der Grim und Hilde schlug, der kühne Dietrich von Bern.“ - „Hei, der schlug die Beiden, als er sie im Schlaf überfiel!“, rief Ebenrot missmutig: „Wären sie wach gewesen, dann hätten sie dem wunderkühnen Mann die Gebeine arg zerklopft und den Wölfen zum Fraß vorgeworfen.“ - „Du lügst, Ebenrot“, rief Ecke: „Dietrich ist ein unverzagter Held, der im offenen Kampf, nicht hinterlistig, zu streiten gewohnt ist.“ - In dieses Lob stimmten alle Gäste ein, und jeder wusste von einer Heldentat des Berners zu erzählen.
„Vieles habe ich schon von dem Löwenmut dieses Kämpfers gehört“, sagte die Königin Seeburg, „aber bald sagt man, er sei schön von Gestalt und Angesicht, gleich dem Gott Thor, bald vergleicht man ihn einem grimmigen Drachen, der lodernde Flammen aushauche. Ich möchte ihn wohl gern von Angesicht sehen. Fände ich einen Boten, der kühn genug wäre, ihn zu mir zu entbieten, dann würde ich ihn reich belohnen.“ - „Ich will dein Bote sein!“, rief Ecke freudig: „Längst schon gelüstete es mich, mit ihm zusammenzutreffen. Ich bringe ihn hierher zu deinen Füßen, du liebliche Frau. Ich bringe ihn dir, tot oder lebendig.“ - „Nicht so, tapferer Held!“, sagte Königin Seeburg: „Du bist uns Schutz und Schirm, bist uns teurer als Reich und Krone, und sollst nicht um einer Botschaft willen in Gefahr des Hauptes kommen.“ Da erhob sich Ecke, und seine Augen erglänzten vom Feuer des Mutes und der Liebe. „Um deiner Liebe willen gehe ich willig in Kampf und Tod!“, rief er: „Gib mir ein Pfand, dass du mir angehören willst, wenn ich ein glücklicher Bote bin!“ - Die Königin zog errötend einen Goldring von ihrer Hand und überreichte ihn dem jungen Helden mit den Worten: „Nimm hier dieses Pfand, das dir mein Reich und mich selbst zu eigen macht. Der Ring wurde von Zwergenhänden aus reinem Gold gefertigt und mit Zauberkraft geweiht.“
Ecke sah ihr begeistert in die Augen, die von Huld und Liebe glänzten. „Nun bin ich stark wie zehn Riesen und fahre hinaus in jeden Kampf, ohne Helm und Rüstung. Mir genügen Schwert und Schild.“ Die Königin dagegen hieß ihn warten, winkte ihren Dienerinnen, und alsbald brachten diese Helm, Rüstung, Schild und Schwert aus den Gemächern der hohen Frau, und sie wappnete den Recken mit eigenen Händen. Sie sagte ihm, Helm und Rüstung, mit Goldspangen verziert, seien ein Werk des Zwergenkönigs Alberichs, der diese Rüstung einst dem Kaiser Ortnit verliehen habe. An Schwert und Schild hätten zehn Zwerge gearbeitet, und das Wasser zur Härtung aus einem Fluss geholt, der bei Alten-Troja fließe. Ecke zog das Schwert aus der goldenen Scheide und schwur, es im Dienst seiner Verlobten treu zu führen. Wie er die blanke Klinge erhob und senkte, da war es, als ob ein glühender Wurm daran auf und nieder liefe. Hell strahlten Edelsteine auf dem Helm, und silberne Glöckchen klangen um den unteren Rand der Brünne. Der junge Held erschien in der strahlenden Rüstung hoch und gewaltig, wie Thor, schön und blühend, wie Freyer, als er die geliebte Gerda erwartete.
Dann wanderte er hin über die einsame Heide mächtigen Schrittes zu Fuß, denn er glaubte nicht, dass ihn ein Ross auf der weiten Reise tragen könne. Weder Moorlachen noch breite Bäche hemmten seine Schritte. Er setzte kräftig darüber weg, als ob er Flügel habe. So kam er endlich gegen Abend in einen tiefen Wald, wo er nicht mehr Weg noch Steg erkennen konnte. Doch das machte ihm nur wenig Sorge, denn ein Lager von Moos und ein Dach von dichtem Gezweig war ihm als Herberge genug. Schwerer dagegen dünkte es ihm, in der Wildnis die gewöhnte Abendkost zu finden. Während er sich nun durch Dickicht und Dornhecken Bahn brach, hörte er einen Mann mit tönender Stimme ein Lied singen. Er folgte der Stimme und gelangte an eine einsame Behausung. Was sich nun weiter begab, soll uns der Dichter berichten:
Eingegangen in die Klause,
Sitzt beim Mahle froh der Mann;
Da tritt in dem Waldeshause
Spät ein Gast zu ihm heran.
Stattlich steht er da in Rüstung,
Glänzend, licht, wie Sonnengold,
Lehnt sich auf des Fensters Brüstung;
Nachtherberg' er haben wollt'.
Ehrlich bietet er ihm die Rechte:
„Viel willkommen! Grüß dich Gott!
Ob dich lange Wandrung schwächte,
Labe dich mein gastlich Brot.“
Von Gewild ein fetter Braten
Und der blau gesottne Fisch
Zu dem leckren Mahle laden
Auf dem blanken Eichentisch.
Waldeswirt dem Gaste wählet,
Was ihm köstlich dünkt und gut,
Was die Kräfte wieder stählet,
Wenn man abends müde ruht.
Edlen Weines einen Becher
Reicht er, sprechend ohne Scheu:
„Herb ist Rheinlands Sorgenbrecher,
Labend doch wie deutsche Treu.“
Die Männer saßen bis spät in die Nacht beisammen, zechten, sangen und plauderten wie zwei alte Freunde. Da sprach Ecke auch von seinem Vorhaben, den kühnen Berner tot oder lebendig nach Köln zu der ihm verlobten Königin Seeburg zu bringen. „Den Berner Dietrich!“, rief der Waldmann erschrocken: „Und um eines Weibes willen! Freund, um Frauengunst gehe ich nicht einen Schritt aus meiner Klause. Denn die Weiber sind alle wie schwankendes Schilfrohr, das der Wind hin und her weht, wie ich selbst erfahren habe. Und um solchen Quark willst du nach Bern gehen? Höre, Freund, vor dem Schwert und dem Feueratem des Berners besteht weder Recke noch Riese, denn er ist der Sohn eines höllischen Geistes.“ - „Dieses Schwert ist Zwergenwerk und zweifach gehärtet!“, rief Ecke: „Dieser Helm und diese Rüstung gehörten einst dem Ortnit und sind fest gegen alle Waffen, und diese Faust hat sich in manchem Kampf bewährt. Darauf darf ich vertrauen, auch wenn Dietrich der kühnste Recke in allen Ländern ist. Gewinne ich ihn mit Glimpf, dass er willig zu meiner Königin folgt, dann werde ich selbst sein treuester Geselle. Ist er aber harten Herzens, dann fällt er von meiner Hand, oder ich von der seinen. Das eine wie das andere ist dem Helden Gewinn, der höhere Güter kennt als das vergängliche Gut des Erdenlebens.“ - „Frau Sälde (die Selige oder Segnende) sei mit dir auf deiner Fahrt!“, sagte der Waldmann: „Aber nun lass uns trinken und die Sorgen vergessen.“ - „Nur noch diesen Becher trinke ich zum Abschied“, versetzte der Gast, „denn die Unruhe treibt mich aus deinem gastlichen Haus. Ich muss fort nach Bern zum kühnen Wagespiel der Waffen. Ich bin Ecke, der lange um die Liebe der Königin Seeburg warb. Und nun hat sie mir diesen Goldring und alles Streitgewand als Zeichen ihrer Huld verliehen. Da kann ich nicht säumen. Zeigt dir ein anderer diesen Ring, dann bin ich im ehrlichen Kampf gefallen. Aber ich hoffe auf Siegesruhm.“ - „Du bist Ecke, von dessen Taten die fahrenden Sänger erzählen.“, sagte der Waldmann: „Du hast das Land so lange mit starker Hand beschützt. Bleibe hier in meiner Klause zur Nacht, denn ich fürchte, ich werde dich nicht mehr von Angesicht schauen.“
Doch er lässt sich nicht bewegen;
Drauf der Wirt gibt ihm Geleit.
Mondlicht spielt in den Gehegen
Und der Geist der Einsamkeit.
Rings Gesichte sich erheben
Auf und nieder im Gezweig,
Flüsternd viel von Liebeleben
In des Waldes stummem Reich.
„Uhu! Uhu!“ tönte es über dem kühnen Mann. Ein Schwarm Eulen strich mit unheimlichem Geheul um altes Gemäuer, Käuzlein krächzten, in den Moorlachen riefen Unken eine schauerliche Weise. Waren es Zeichen von Niederlage, vielleicht Anzeichen des nahen Todes? Aber da leuchtete der erste Morgenschein auf die Wipfel der Bäume, und die Vögel erwachten und begannen ihre Jubellieder, und die Silberglöckchen am Saum seiner Brünne tönten melodisch dazu. Oh, das waren glückliche Vorbedeutungen, und vor seinem Geist erhob sich im Morgenrot Frau Sälde, einen Lorbeerzweig in der Hand, und darüber erschien die geliebte Königin, geschmückt für ihn mit dem Myrtenkranz. So schritt er selig weiter nach Bern.
Endlich lagen Stadt und Burg Bern vor ihm, und bald durchmaß er die Straßen, wo das Volk staunend dem gewaltigen Recken nachgaffte. Er kehrte in einer Herberge ein, die gerade an seinem Weg einlud. Er musste sich unter der niedrigen Decke bücken und nahm Platz unter allerlei Volk, das ehrerbietig zurückwich. Ein reichliches Mahl und trinkbarer Wein mundeten ihm trefflich. Als die anfängliche Scheu der Leute geschwunden war, sprachen sie von ihren Geschäften, und weiter kam die Rede auf den herrlichen Herrscher des Landes. Da erfuhr dann Ecke, derselbe sei allein ausgezogen, um Unholde zu vertilgen, die sich in dem Wald Osning angesiedelt hatten. Er vernahm ferner, dass es derselbe Wald war, den er in anderer Richtung durchwandert hatte. Er ließ sich die Gegend beschreiben und hoffte nun, dem zu begegnen, den er suchte. So verließ er Bern, ohne in der Königsburg einzukehren. Ehe er aber den wilden Wald betrat, versah er sich mit Wein- und Speisevorrat.
Auf seiner Wanderung kam er an eine Lichtung, da standen viele Waldleute um einen ungeheuren toten Flugdrachen. Auf seine Erkundigung hin hörte er, der kühne Berner habe das Ungetüm, den Schrecken das Volkes, erschlagen und den jungen Recken Sintram, den Sohn Reginbalds von Fenedi (Venedig), aus dessen Rachen befreit. Das war ein neuer Ansporn für Ecke, nicht zu säumen. Doch die Nacht überraschte ihn auf der Wanderung. Sie war finster, kein Mondschein noch Sternenlicht erhellte sie. Ecke lagerte sich unter einen Baum und träumte halb entschlafen von Ruhm und Liebe. Da weckte ihn Hufschlag, und er sah einen Schimmer, wie wenn jemand eine Leuchte trage. Er sprang auf, eilte nach und erkannte, dass Helm und Schild eines Reiters diesen Schein verbreiteten. „Es ist der König“, sagte ihm eine Ahnung, und sie betrog ihn nicht. Er rief nachjagend dem Reiter zu, er solle anhalten, wenn er nicht ein Feigling sei. Da hielt der Mann sein Ross an und erkannte nun selbst, dass ihm ein gewappneter Recke folgte, denn auch Eckes Rüstung leuchtete wie Sternenlicht. Dietrich sprang nun von seinem Hengst, um den Ankömmling nach seinem Begehren zu fragen. Doch als er alles vernommen hatte, erklärte er, er werde nicht nach Köln gehen, um sich wie ein Wunder von neugierigen Weibern begaffen zu lassen. Auch scheine es ihm ein schlechtes Tagewerk, wenn er und Ecke sich deshalb die Hälse brechen wollten. Der junge Recke bat flehentlich, der König möge mit ihm nach Köln kommen, und fügte hinzu, er werde dort hoch in Ehren und er selbst sein Leben lang des Berners treuester Heergeselle sein. Als aber Dietrich auf seiner Meinung beharrte und auf seinen Hengst sprang, um seinen Weg fortzusetzen, schalt er ihn einen Feigling, dessen Ruhm erlogen sei und dessen Feigheit er in allen Landen verkünden werde. Zugleich schlug er an seinen Schwertknauf und forderte zur Waffenentscheidung auf. Ob dieser Rede entbrannte Dietrichs Zorn, doch sagte er, man müsse den Tag zum Waffengang auf Leben und Tod abwarten, denn in der Dunkelheit könne auch der Schwächling Sieg gewinnen und eines Meuchlers Mordwaffe den stärksten Mann fällen. „Wohlgesprochen!“, rief Ecke: „Nun erkenne ich den königlichen Helden, der seines Namens würdig ist. Aber hier im Bergwald könnten uns Lindwürmer überfallen und zum Fraß fortschleppen. Darum wollen wir Wache halten, du in der ersten Hälfte der Nacht, ich in der zweiten. Treuere Wächter finden wir nicht, wenn wir auch die ganze Welt durchsuchten.“ Nachdem er solches gesprochen hatte, streckte er sich auf den Rasen, nahm den Schild unter das Haupt und entschlief bald getrost und harmlos, wie ein Kind in den Armen der Mutter.
Dietrich wachte über dem Haupt des Mannes, der nach seinem Blut begierig war. Er betrachtete bei Sternenlicht die kraftvollen Glieder des Schläfers und sein männlich schönes Angesicht. „Und morgen, wenn der Tag erscheint“, dachte er, „senkt sich vielleicht der Todesschlaf auf seine Lider, und er ist bleich, kalt, ohne Atem und Bewegung. Er oder ich, darauf beharrt er, und andere Wahl ist mir nicht gegeben. Treuere Wächter finden wir nicht, wenn wir auch die ganze Welt durchsuchten, denn das ist die Sprache des Helden, der seinem ebenbürtigen Gegner vertraut.“
Als Mitternacht vorüber war, rief er Ecke wach und schlief nun selbst unter dessen Obhut. Dieser war ungeduldig, begierig den Streit auszufechten, der ihm die Königin erwerben sollte. Er schalt die Sonne, dass sie säume, und begrüßte jauchzend den aufsteigenden Morgen und weckte den König. Nun saßen Beide zusammen und teilten ihr Frühmahl, und jeder suchte den anderen nochmals, wiewohl vergeblich, für seine Vorschläge zu gewinnen. Darüber erhitzten sich die Gemüter, und sie griffen nach den Waffen. Der Kampf der starken Männer war entsetzlich. Die Streiche schallten wie Donnerschläge, dass Vögel und scheues Wild eilends entwichen. Schon bluteten sie aus tiefen Wunden. Doch war Eckes Rüstung noch unverletzt, da nur an den Gelenken und an dem nicht fest schließenden Halsberg das Schwert des Feindes eingedrungen war. Jeder war schon wiederholt in das blutgetränkte Gras gesunken, aber immer wieder aufgesprungen und mit neuer, von Scham und Zorn erhöhter Kraft in den Streit zurückgekehrt. Zum fünften Mal raffte sich Ecke auf, spaltete mit einem furchtbaren Schlag Dietrichs Schild und drängte den halb Entwehrten in ein Dickicht, wo er von den Zweigen einigen Schutz erhielt. Der Berner raffte nun alle Kräfte zu einem entscheidenden Streich zusammen, den er mit beiden Händen führte. Ecke fiel fast ohne Besinnung zu Boden, Dietrich warf sich über ihn und befahl ihm, sich zu ergeben. Statt der Antwort schwang ihn der Recke von sich ab und umklammerte ihn wie mit Zangen. Die Helden rangen am Boden, und bald war der eine, bald der andere oben. Indessen gelang es dem König, eine Hand freizumachen, womit er das Schwert fassen konnte. Er stieß die scharfe Klinge dem tapferen Feind unter der Brünne tief in den Leib. Es war geschehen: Die umklammernden Arme des Helden lösten sich, der Boden wurde rot von Blut, das Angesicht von den Schauern des Todes bleich. „König“, stöhnte er, „nimm den Goldring von meiner Hand, bringe ihn meiner Verlobten und sage ihr, dass ich Treue gehalten habe bis in den Tod. Was du dem Lebenden versagt hast, wirst du dem Sterbenden versprechen und dem Toten erfüllen.“ - „So tue ich“, sprach der Berner, „nun gehe ich, junger Held, zu deiner Königin, um ihr deinen letzten Gruß zu bringen.“

Kampf zwischen Ecke und Dietrich
Auch der siegreiche König war von Kampf und Wunden erschöpft, sein Helm und seine Rüstung zerhauen und fast unbrauchbar. Doch hätte er gern den kühnen Ecke wieder ins Leben gerufen, wenn ihm solche Macht vergönnt gewesen wäre. Zunächst nahm er den Goldring nach dem Willen des Sterbenden, dann aber entkleidete er ihn auch des Streitgewandes, das sich in dem schweren Kampf bewährt hatte. Und nicht minder glaubte er, dass das Schwert Eckes, genannt Eckesachs, durch den Sieg sein rechtmäßiges Eigentum und wohl mit Mimung zu vergleichen sei. Die Waffenbeute lud er auf den Rücken seines Hengstes, doch er selbst konnte aus Erschöpfung nicht aufsteigen. Er schleppte sich mühsam, das Ross am Zügel führend, durch den einsamen Wald. Brennender Durst quälte ihn, wie das bei Verwundeten gewöhnlich ist. Nach langem Suchen fand er eine strömende Quelle, dessen helle Flut ihn jetzt mehr erquickte, als sonst der funkelnde Wein. Als er den Durst gestillt hatte, erblickte er auf der anderen Seite des Wassers eine liebliche Maid, die furchtlos in diesem abgelegenen Wald entschlummert war.
Er schleppte sich mühsam hinüber zu ihr, weckte sie und bat sie, seine Wunden zu verbinden. Während sie damit beschäftigt war, redete sie ihm freundlich zu, er solle mit ihr gehen, unter dem Wasser habe sie einen schönen Saal. Wer da eintrete, genese sogleich von aller Krankheit und werde von allen Schmerzen der Erde frei. Es herrsche daselbst immer ein glücklicher Frieden. Aber wer eintrete, müsse auch immer in dem stillen Saal bleiben, denn es gäbe wohl viele Wege, die hinunterführten, aber ein Ausgang sei nicht vorhanden. Nur sie selbst, die Herrin, könne zur Oberwelt aufsteigen, um die mit Schmerzen beladenen Menschen zu sich einzuladen. „In deinen Saal der starren Ruhe folge ich dir nicht.“, sagte Dietrich: „Der tätige Mensch, der Held muss dulden, kämpfen und gewinnen, solange er Kraft in sich fühlt, solange er Atem und Leben hat.“ Da hieß ihn die Maid weiterziehen, bis er, müde der getragenen Last, Zuflucht bei ihr suche.
Der König wankte weiter. Da hörte er den Hilferuf einer weiblichen Stimme. Gleich darauf stürzte flüchtigen Fußes ein Moosweibchen, verfolgt von zwei grimmigen Rüden, auf ihn zu und flehte seine Kniee umklammernd um Schutz. Mit einem Schwertstreich fällte er den einen Hund, und der andere entfloh heulend. Durch die Anstrengung war eine Wunde des Helden wieder aufgebrochen, und er sank erschöpft auf den Rasen. Sobald das Moosweib dies bemerkte, untersuchte sie die Wunden, drückte Eiter und Blut heraus, reinigte und verband sie mit Heilbalsam und dem Saft einer Wurzel, die sie ausdrückte. Dietrich fühlte sich sehr gekräftigt und meinte, nun könne er wieder fechten, wie zuvor. Als man jedoch abermals Hundegekläff und das „Halloh“ der Jäger hörte, bat ihn das Weib zitternd, er möge mit ihr in eine Bergkluft flüchten, wohin ihnen der schreckliche Fasolt mit seinen Bestien nicht folgen könne. Der Berner, nicht gewohnt zu fliehen, erwartete die Jagd. Ein riesiger Recke jagte mit Hunden voraus. Als er den Helden mit seiner Gefährtin und zugleich die getötete Bestie im Abendlicht erblickte, rief er: „Hast meinen Machmet totgeschlagen und dir das Moosweib zugelegt, das ich schon den ganzen Tag jage! Da, nimm den Lohn!“ Mit diesen Worten warf er sein Pferd herum und führte einen so furchtbaren Streich auf des Helden Haupt, dass derselbe, wie vom Blitz getroffen, zu Boden fiel. „Ich denke, du hast einen Pass für die Hölle!“, lachte er höhnisch: „Nun magst du das Moosweib behalten, dass sie dir den geborstenen Schädel zusammenflickt, wenn sie kann.“ Mit diesen Worten jagte er fort. Das Weib aber richtete den Berner auf, und da sie fand, dass der Schwertstreich nicht das Haupt ihres Beschützers beschädigt hatte, verband sie nochmals die alten Wunden mit ihren Heilmitteln und gab dem Recken auch einen Trank, der ihn völlig herstellte. Darauf hieß sie ihn, sich zum Schlummer niederzulegen, und sang ein Schlummerlied, erst schallend in grellen Tönen vom Sturm, der durch die Wipfel der Bäume rast und Blüten und Blätter herabstört, dann leiser und leiser von den milden Frühlingslüften, deren Atem Blumen und Knospen und grüne Saaten hervorruft. Der müde Held schlief allmählich ein, und sie hütete ihn, wie eine Mutter über ihrem Kind wacht.
Er erwachte am Morgen und stieg zu Pferde, um seinen Weg fortzusehen. Das Weibchen aber sprang flüchtig wie ein scheues Reh über und durch die Büsche. Plötzlich stieß sie ein lautes Geschrei aus und nahm abermals, von Fasolt verfolgt, Zuflucht zu dem Helden. „Hei, Mordbube“, schrie der Wilde, „trägst meines Bruders Ecke Rüstung. Hast ihn im Schlaf ermordet! Nun fahre zur Hölle!“ Mit diesen Worten führte er einen gewaltigen Schlag nach Dietrichs Haupt, aber dieser vermied ihn, indem er sich bis auf die Mähne seines Rosses herabbückte, und erwiderte ihn so kräftig, dass Fasolt kopfüber den Sattel räumte. Der Held sprang von seinem Hengst, und schon blitzte sein Schwert über des Gegners Haupt. Da bat dieser um Gnade und versprach hoch und heilig, ihm ein treuer Geselle und Dienstmann zu sein. Er wiederholte feierlich den Eid, als er den Namen seines Überwinders und die näheren Umstände von dem Kampf mit Ecke erfuhr.
Beide Helden zogen nun miteinander durch das grüne Waldgebirge Osning (Asening), wo einst Asgard gestanden und die Asen ihre goldenen Hallen erbaut hatten. Dietrich bestand gefährliche Abenteuer, er hatte mit Riesen und Riesenweibern zu kämpfen, die mit entwurzelten Bäumen auf ihn losschlugen, aber blieb immer Sieger. Er verzieh auch seinem Begleiter, der sich mehrmals treulos bewies. So kamen sie endlich in die Klause des Waldmanns, der Ecke gastlich bewirtet hatte und stolz auf sein Haus war, das dem Wanderer stets offenstand. Bei einem Sorgenbrecher saß er nach dem Abendimbiss mit ihnen zusammen, aber nicht fröhlich, wie sonst, sondern wischte manchmal eine Träne aus den Augen. „Herr“, wandte er sich dann an Dietrich, „du bist der Berner Held und hast meinen armen Gastfreund Ecke erschlagen, denn du trägst seine strahlende Rüstung.“ Der Held leugnete nicht. „Wohl“, fuhr der Wirt fort, „ich würde den edlen Helden zu rächen versuchen, wäret ihr nicht meine Gäste. Nun seid ihr gut behütet, denn in des Waldes grünen Lauben geht der Falschheit Wolf nicht um.“ - Der Berner schlug vertrauensvoll in die dargebotene Hand, aber der Waldwirt gewahrte einen tückischen Blick von Fasolt und setzte noch hinzu: „Traue nicht jedem, denn es gibt auch treubrüchige Verräter.“
An den Wänden rings in der Klause waren Mooslager, die den drei Männern zu bequemen Ruhestätten dienten. Auch der Waldmann ruhte darauf, aber schlief nicht. Um Mitternacht sah er, wie Fasolt sich erhob, das Schwert Dietrichs in einem Winkel verbarg und sich darauf mit seiner eigenen Waffe dem Helden näherte. Er warf noch einen schielenden Blick nach dem Wirt, und als er denselben wach sah, flüsterte er: „Still! Es gilt Rache für meines Bruders Blut zu nehmen.“ Er zog das Schwert, aber der Waldbewohner stürzte auf ihn zu und versuchte, es ihm zu entreißen. Im Ringen der Männer fiel es klirrend auf die Erde. Dietrich erwachte, begriff, was sich begeben hatte, und durchbohrte den Verräter mit dessen eigener Klinge. „König“, sagte der Klausner, als er die Leiche fortgeschafft hatte, „meine gelobte Treue habe ich dir ehrlich gehalten. Aber kehre nie wieder hier ein, denn ich werde dir nicht mehr die Hand bieten, und suchtest du nochmals hier ein Lager, dann fändest du den Tod für Eckes Tod.“
Der Berner ritt fort durch Wald und Heide, bis er nach Köln kam. Als die Königin vom hohen Söller herab in der Ferne die glänzende, wohlbekannte Rüstung erblickte, schmückte sie sich zum Empfang des geliebten Freundes und hieß auch ihre Schwestern und Frauen das Gleiche tun. Der Held ritt in den Burghof ein. Da eilten Recken und Diener zum Empfang herbei, aber blieben stumm und regungslos, denn unter dem leuchtenden Helm schaute ein anderes Angesicht hervor als das erwartete. Kaum trat auf sein Geheiß ein Knecht herzu, ihm das Ross zu halten. Er ging darauf unangemeldet in die Königshalle, wo die Herrin den Thron eingenommen hatte. Erstaunt, bald aber zitternd über das, was sie hören sollte, blickte sie auf den Helden. „Wo ist der edle Recke, dem ich diese Rüstung verliehen habe?“, fragte sie, als Dietrich noch immer schwieg. Er fand keine Worte, das Schreckliche zu berichten, und eine peinliche Stille war im Saal. Mit Mühe brachte sie das Wort hervor: „Tot?“ - „Er starb als Held“, antwortete der König jetzt gefasst, „als Held deiner gedenkend und deiner würdig. Hier das Pfand seiner Treue bis in den Tod.“ Er überreichte der Herrin den Goldring, und sie nahm ihn und entfernte sich ohne Dank und Gruß. Seitdem trug sie stets Trauerkleider und blieb unvermählt.
Schweigsam, ohne Dank und Gruß, verharrten auch die Hofleute, als der König den Saal verließ. Mancher Recke sandte ihm drohende Blicke nach und hätte ihm noch lieber scharfe Speere nachgeschleudert, wenn ihm zuvor der Fehdehandschuh überreicht worden wäre. Indessen konnten die Drohungen künftiger Rache den Ruhm nicht schmälern, den die siegreich bestandenen Abenteuer dem Helden von Bern brachten.
Die Gesellen Wildeber, Ilsan und Dietleib
Als Dietrich in seine Burg eintrat, kam ihm zuerst Heime grüßend entgegen, nahm Falke am Zügel und rief voranschreitend: „Heil dem großen Sieger, der Ecke schlug und die Unholde vertilgte! Heil dem unüberwindlichen König!“ - „Dank dir, wackerer Geselle“, sagte Dietrich, „und hier eine Gabe für deinen Gruß!“ Mit diesen Worten überreichte er ihm das gute Schwert Nagelring. Der Recke empfing es mit Freuden und küsste es zweimal und dreimal, indem er versetzte: „Diese Gabe will ich zum Ruhm meines Königs führen, und ich will sie erst mit meinem Leben von mir lassen.“ - „Du bist des Schwertes unwert, schnöder Geselle!“, rief Wittich, der mit anderen Recken herzugetreten war: „Du hast unlöblich deine Klinge in der Scheide rosten lassen, als mich das Raubvolk bestürmte.“ Heime griff nach dem Schwert und erwiderte: „Mich verdross dein Selbstlob, wie jetzt deine Lästerzunge, die ich dir ausschneiden will.“ Schon griff auch Wittich nach Mimung, aber der König trat zwischen die hadernden Männer und ermahnte sie, den Burgfrieden aufrechtzuerhalten. Als er darauf von dem Vorgang Kenntnis erhielt, hieß er Heime seines Weges fahren, weil es nicht der Helden Art sei, den Wehrgenossen in der Gefahr zu verlassen. Er solle nun, fügte der König hinzu, durch tapfere Taten zeigen, dass er ein tüchtiger Held sei, und dann möge er wiederkommen. „Wohlan, Herr, mit Nagelring gedenke ich mir größeres Gut zu erwerben, als die Burgen, die du mir jetzt wieder entziehst.“ So sprach der kühne Recke, sprang auf seinen Hengst und ritt von dannen, ohne Abschied und Gruß.
Er ritt weit fort bis an die Wisera, wo er einen Haufen von Raubgesellen um sich sammelte und großen Unfug trieb. Er plünderte das wehrlose Landvolk und manchen Wanderer. Selbst mutige Recken mussten ihm Zoll zahlen oder ihr Gut und Leben lassen. So erwarb er sich durch Wegelagerung einen großen Schatz und wurde nimmer müde, sein Gut zu vermehren.
Das war ein schlimmer Empfang für den siegreich heimkehrenden Helden Dietrich. Desto freudiger begrüßten ihn die anderen Gesellen, und vornehmlich die Königin Virginal. Bald saß er inmitten seiner Getreuen, und es war, wie der Dichter sagt:
Die Helden spülten den Plunder
Der Sorgen trinkend hinunter.
Dietrich musste immer wieder von dem schrecklichen Kampf mit dem Helden Ecke erzählen und wie er dadurch die strahlende Rüstung und das gute Schwert Eckesachs gewonnen habe. Während die Recken so redeten, trat ein Mönch in den Saal und blieb demütig an der Tür stehen. Er war groß und stämmig und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen, dass man nur wenig von seinem Gesicht sehen konnte. Die Diener trieben mit ihm viel Kurzweil und rupften und zupften ihn bald an der langen Kutte, bald am Bart. Als das lose Spiel eine Weile gewährt hatte, wurde der Mann ungeduldig, ergriff einen der Spötter an den Ohren und ließ ihn zappelnd und schreiend in der Luft schweben. Als sich der König nach der Ursache des Geschreis erkundigte, trat der Mönch vor und bat um ein Stücklein Brot für einen halb verhungerten Klosterbruder, der für begangene Sünden Buße tue. Dietrich war selbst herzugetreten und befahl, dem jammervollen Bruder reichlich Speise und Trank vorzusetzen. Er wunderte sich aber, als der Mönch die Kapuze zurückschob und dessen breite Backen zum Vorschein kamen, die gar nicht von Hunger zeugten. Er wunderte sich noch mehr, als derselbe mit seinen Kinnladen zu arbeiten begann. Ein Schinkenstück nach dem anderen, ja eine Kalbskeule verschwanden unter seinen zermalmenden Zähnen und dazu goß er Ströme edlen Weines in seinen unersättlichen Schlund.
„Der heilige Mann hat einen Wolfshunger“, murmelten die Umstehenden, erstaunt über die unermüdliche Arbeit des Mönches. „Habe fünf Jahre Pönitenz (Buße) getan mit Beten, Fasten und Wassertrinken.“, versetzte er: „Nun habe ich die Erlaubnis vom hochwürdigen Prior, mich in der Welt umzusehen und Sünder zur Buße zu bekehren.“ Er setzte seine Mahlzeit fort und fügte dann hinzu: „Ihr aber seid alle arme Sünder mit Fressen und Saufen! Darum tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden vertilgt werden.“ Darauf intonierte er mit schallender Stimme: „Oh sanctissima! (Oh Heiligkeit!)“ Es hatten sich immer mehr Gäste um den heiligen Mann gedrängt. Dann kam auch Meister Hildebrand und rief: „Hei, das ist ja mein lieber, leiblicher Bruder, der Mönch Ilsan!“ - „Culpa mea, culpa mea! (Meine Schuld!)“, rief ihm dieser abwehrend entgegen: „Rühre mich nicht an, unheiliger Bruder! Beichte zuvor und tue Buße, dass du nicht zur Hölle fährst, gleich den anderen.“ - „Aber“, sagte der Meister, „wir haben uns doch hier zusammengeschart, um Unholde, Riesen und Zwerge zu bekehren, wenn nicht mit Güte, dann mit Gewalt. Da darf der gottselige Bruder nicht fehlen. So lege denn die Kutte ab und sei wie ehemals unser Geselle.“ - „Ja, ich habe Erlaubnis zu bekehren und will nun im frommen Werk euer Helfer sein.“ Mit diesen Worten warf er Kutte und Kapuze weg und stand da in glänzender Brünne und ganz gerüstet. „Hier“, rief er, an sein breites Schlachtschwert schlagend, „mein Predigerstab, und hier“, auf die Rüstung deutend, „mein Brevier (Gebetsbuch). Heiliger Kilian, bitte für mich, für uns alle! Ora pro nobis. (Bitte für uns!)“ Er nahm Platz unter den Recken, die den starken Mönch Ilsan von alter Zeit her kannten. Er trank und sang bald lateinische Psalmen, bald Schelmenlieder und erzählte Geschichten aus seinem Klosterleben, wie er oftmals die feisten Mönche an den Bärten gerauft oder in ihre Zellen eingesperrt habe, wenn sie ihn hätten fasten lassen.
Schon brach der Abend an und Wachskerzen erleuchteten die weite Halle. Draußen auf den Gängen und im Hof brannten Kienfackeln. Da tappte ein seltsames, abenteuerliches Geschöpf durch die offene Pforte, vor welchem Knechte und Mägde erschrocken zurückwichen. Es war wie ein Zottelbär anzusehen, aber das Haupt glich einem Eberkopf, während Hände und Füße menschlich gestaltet waren. Das Wunder stand wie angewurzelt an der Pforte und schien sich zu bedenken, auf wen es sich zuerst stürzen wolle. „Ein unreiner Geist, eine Seele aus dem Fegefeuer!“, rief der Mönch: „Ich will sie beschwören. Conjuro te…“ Da stockte er, denn der Unhold wandte ihm den Rüssel entgegen. Nun rief der kühne Wolfhart: „Ich will ihn mit meinen Fäusten hinaus und in sein Fegefeuer fegen!“ Sogleich sprang er über den Tisch und ergriff das Tier am Pelz. Soviel er aber auch raufte und zerrte, es bewegte sich nicht von der Stelle. Dagegen gab es unversehens dem Recken einen so kräftigen Stoß, dass er kopfüber rücklings in den Saal purzelte. Nun sprangen Hornboge, Wittich und andere Recken hinzu und versuchten, das Ungetüm aus der Halle zu schaffen, aber es stand unbeweglich, gleich einer Säule von Erz.

„Gebt Raum, tüchtige Gesellen!“, sagte der König voll Zorn: „Ich will sehen, ob der Unhold auch gegen Eckesachs fest ist.“ Schon hatte er das Schwert gezogen, da fiel ihm Meister Hildebrand in die Arme und sprach: „Herr, beseht es recht, da blitzt unter dem Bärenpelz an der Hand ein goldener Armring mit Edelgestein. Es ist ein Mensch, vielleicht ein kühner Recke.“ - „Wohlan“, sagte der König, zu dem seltsamen Gast gewandt, „bist du ein tüchtiger Held, dann lasse die Vermummung fallen, und du sollst uns ein treuer Geselle sein.“ Auf diese Zusage legte der Gast Eberkopf und Bärenhaut ab und stand in glänzender Rüstung vor dem König und seinen Wehrgenossen. „Ich kenne dich wohl“, sagte Hildebrand, „du bist der streitbare Held Wildeber, der Starke, und der Goldreif ist die Gabe einer Schwanjungfrau und verdoppelt deine Kraft. Aber wozu die Verkleidung? Bei unserem König ist jeder tüchtige Mann ein willkommener Gast.“
Wildeber setzte sich an des Meisters Seite, leerte einen schäumenden Pokal und erzählte: „Einst war ich nach einem schweren Kampf gegen Raubvolk am einsamen Ufer eines Sees eingeschlafen, da weckte mich ein Plätschern in den Wellen. Als ich die Augen dahin wandte, sah ich eine schöne Jungfrau, die schwimmend mit dem Wellenschlag auf- und niedertrieb. Unfern von der Stelle gewahrte ich ihr Schwanengewand, kroch vorsichtig im Gras dahin, nahm und verbarg es. Die Jungfrau suchte es nach dem Bad, und als sie es nicht fand, fing sie an, laut zu klagen. Ich ging zu ihr und bat, sie möge mir in meine Behausung folgen und dort als meine Ehefrau über mein Fürstentum herrschen. Sie weinte aber immerfort und sagte, sie müsse sterben, wenn sie ihr Flughemd nicht wiederfinde. Das erbarmte mich, und ich gab ihr das Gewand. „Wohl“, sagte sie, „edler Held, für deine Gabe schenke ich dir diesen kostbaren Goldreif, der die Kraft des Besitzers so vermehrt, dass ihn kaum ein Kämpfer bezwingt. Du musst aber, wenn du ihn sicher behalten willst, als Bär und Eber umherwandeln, bis dich der ruhmvollste König auf Erden zu seinem Gesellen erwählt. Tust du es nicht, dann schwindet die Kraft des Kleinods, und du wirst früh im Kampf erschlagen.“ Als sie diese Worte gesprochen hatte, schlang sie das Gewand um und schwebte auf Schwanenschwingen zu den Wolken empor. Darum bin ich im Bärenpelz zu dir gekommen, kühner Held von Bern. Und weil du mich freiwillig zu deinem Gesellen erwählt hast, so vertraue ich, dass die Kraft des Goldreifs nicht eher schwinden wird, als mit meinem Leben.“ - „Pax vobiscum! (Friede sei mit dir!)“, lallte Mönch Ilsan und schwankte unsicheren Schrittes nach seinem Lager. Die anderen Recken folgten bald seinem Beispiel. Etliche fanden ihre Schlafstätte, andere lagerten sich auf den mit Kissen belegten Bänken der Halle.
Wohl ein Jahr ist hingegangen
In den Schoß der Mutter Zeit,
Sieh, da lehnt in blanker Rüstung
Dietrich auf des Söllers Brüstung,
Knappen sind im Hof bereit.
Neben ihm stand Virginal, die hohe Königin, heiteren Angesichts, denn der Held war nicht zu einem gefährlichen Abenteuer gerüstet, sondern wollte infolge einer Einladung von Kaiser Ermenrich, dem Bruder seines Vaters, nach Romaburg zu einem Festgelage fahren. Da trabte auf stolzem Rosse ein Recke in den Hof. Der König erkannte ihn sogleich: Es war Heime auf seinem Hengst Rispe. Derselbe stand bald vor dem Berner, der ihn nicht eben freundlich empfing. Der Recke berichtete, wie er viele Kämpfe mit Räubern und Riesen bestanden habe, was auch eine tiefe Schramme im Gesicht und manch zerhauener Rüstungsring bezeugten. Er bat um Wiederaufnahme in die Gesellenschaft und verhieß auf Treue seinen Beistand in allen Gefahren und Nöten. Als auch die Königin für den alten Gesellen ein begütigendes Wort sprach, reichte ihm Dietrich die Hand und forderte ihn zugleich auf, mit ihm und anderen seiner Gesellen nach Romaburg zu Kaiser Ermenrich zu fahren.
Die Reise währte manchen Tag, denn der König wollte auch in Fritilaburg Herberge nehmen, wo er zu schaffen hatte. Als die Helden von dort weiterreiten wollten, hielt sie ein junger Recke in starker Eisenrüstung an und fragte nach dem weltberühmten Dietrich von Bern, weil er bei ihm Dienst nehmen wollte. Er nannte sich Ilmenrik, Sohn des Bonden (Freibauern) Soti aus Danland. Als er an den König gewiesen wurde, sprach er: „Heil, Herr! Willst du mein König sein und meinen Dienst annehmen, so möchte ich wohl deine und deiner Gesellen Gewänder, Waffen und Rosse in guter Pflege bewahren.“ Der Berner fand Wohlgefallen an dem jungen Gesellen und wies ihn zu seinem Gefolge, das außer Wittich und Heime aus zwanzig edlen Dienstmannen und noch mehreren Knechten bestand. Man kam zu Romaburg an, wo der reiche Kaiser die geladenen Gäste mit großen Ehren empfing und alsbald in die festliche Halle führte. Dagegen kümmerte sich niemand um die Dienstleute, die doch auch ein Unterkommen begehrten. Sobald aber Ilmenrik die Gewänder, Waffen und Rosse des Königs, Wittichs und Heimes wohlversorgt hatte, ging er zu den Dienstleuten, die ratlos im Burghof standen. Er hieß sie guten Mutes sein, weil er für sie Sorge tragen werde.
Er nahm sie darauf mit sich in die beste Herberge, die man ihm anzeigte, ließ die Halle daselbst zum Gastmahl herrichten und kaufte für zwanzig Goldmark, die er im Säckel mit sich führte, gute Speisen und Getränke. Bald saßen die Männer an den vollen Tischen, schmausten und zechten und waren guter Dinge bis spät in der Nacht. Ehe sie schieden, lud sie der freigebige Gefährte für den folgenden Tag wiederum zur Freudentafel. Er ging dann, als der Morgen anbrach, abermals auf den Markt. Weil aber sein Bargeld erschöpft war, so verpfändete er Heimes Rüstung und Ross für zehn Mark und verwendete die ganze Summe auf die Bewirtung. Am dritten Tage verpfändete er Wittichs Habe um zwanzig, am vierten die Waffen und den Hengst seines Herrn um dreißig Mark. Er ließ bei dem Gelage Spielleute kommen und schenkte dem besten Spielmann, der Isung hieß und auch ein tüchtiger Kämpfer war, ein Purpurgewand seines Herrn. Die Leute ließen sich das wohl gefallen und meinten, ihr Genosse sei ein Kind reicher Eltern, dessen Säckel nie leer werde.
Am fünften Tag wollte der König aufbrechen, um nach Bern zu fahren. Er hieß seinen Dienstmann die Waffen herzuschaffen und die Hengste aufschirren. „Heil, Herr!“, sagte Ilmenrik, ich will es gern tun, aber du musst das alles erst auslösen, denn ich habe es für Speise und Getränke um sechzig Mark verpfändet, nachdem ich meine eigenen zwanzig Mark verwendet hatte.“ - „Hei!“, rief Dietrich erstaunt und zornig: „Hast du einen Magen von hundert Wölfen? Da wirst du noch Bern verpfänden, und ich muss mein Brot heischen gehen.“ - „Du bist ein großer und sehr weiser König“, versetzte der Diener, „du wirst doch deine Dienstleute nicht hungrig und durstig lassen, wenn du selbst beim fröhlichen Gelage sitzt. Niemand bot uns auch nur Brot und Wein. Daher habe ich statt deiner die Dienstleute von ihren Sorgen befreit.“ Der Berner war über die gewaltige Zeche nicht eben erfreut, doch nahm den unberufenen Säckelmeister mit sich zu Kaiser Ermenrich und fragte denselben, ob er als Gastgeber nicht auch die Kosten für die Dienstmannen tragen wolle. Der reiche Herrscher war sogleich dazu bereit. Als ihm aber der Diener den Betrag angab, schalt er ihn einen falschen Knecht, der seines Herrn Güter in Unzucht und Unehre zugrunde richte. Dann rief ihm auch ein anderer König, der anwesend war, der waffenmächtige Walther von Wasgenstein, spottend zu, ob er noch andere lose Künste verstehe, als Fressen und Saufen, wie ein Werwolf? Ilmenrik meinte ganz bescheiden, er habe von seinem Vater manche Spiele gelernt, welche die Recken zu üben pflegten, und er getraue sich wohl, mit den edlen Herren einen Wettkampf einzugehen, Haupt um Haupt. Über diese Vermessenheit war man nicht wenig erstaunt. „Wohlan, es gilt“, rief der vom Wasgenstein, „versuchen wir uns im Steinstoßen und Speerwerfen.“ Er ergriff sogleich einen Stein, so schwer, dass ihn zwei Männer, wie sie jetzt sind, kaum lüften würden. Er warf ihn dreizehn Klafter weit, der andere vierzehn (ca. 25m). Zum zweiten Mal versuchten sich die Kämpfer, und Walther schoss den Stein sechzehn Klafter, sein Gegner brachte ihn zwei Klafter weiter. „Nun versuchen wir uns im Speerschießen!“, rief Walther. Er nahm aber statt des Speeres eine schwere Bannerstange und schleuderte sie mit großer Gewalt hoch über die ganze Dachwölbung der Halle, dass sie jenseits mit der goldenen Spitze tief in die Erde fuhr. Ilmenrik schritt durch den nach beiden Seiten offenen Saal, riss die Stange aus dem Boden und schwang sie noch höher zurück. Er sprang aber gleichzeitig wieder durch die Halle und fing das Geschoß in der Luft auf, ehe es den Boden berührte.
Solche Kunst war noch niemals gesehen worden. Die Helden umher verharrten schweigend und fürchteten um das Leben des tüchtigen Recken vom Wasgenstein. Da berief Ermenrich den jungen Sieger vor sich. „Höre meine Rede, kühner Held!“, sagte er: „Ich will das Haupt meines Lehnsmannes lösen, welchen Preis du auch begehrst. Gold für Blut, das ist altes Recht.“ - „Sei ohne Sorge, Herr“, versetzte Ilmenrik, „das Haupt des tüchtigen Helden ist wohlbehütet. Ich begehre seiner nicht. Willst du mir aber eine Bitte vergönnen, so verleihe mir so viel des Geldes, wie ich zur Pflege der Dienstmannen verwendet habe, damit ich die verpfändeten Waffen, Gewänder und Rosse wieder auslösen kann.“ - „Säckelmeister“, wandte sich der Kaiser an einen Mann aus seinem Gefolge, „wäge dem Gesellen sechzig Mark roten Goldes dar zur Lösung der Pfänder und andere sechzig Mark, damit er seinen eigenen Säckel fülle.“ - „Habe Dank, Herr“, antwortete der Recke, „ich selbst bedarf der Gabe nicht, da ich Dienstmann des reichen Königs von Bern bin, der meiner wohl pflegen wird. Vergönnst du aber, dass wir noch einen Tag zu Romaburg herbergen, dann will ich das Gesinde für diese sechzig Mark reichlicher als zuvor bewirten und auch meinen Herrn samt seinen Recken und dich selbst, wenn du eintreten magst, sollte ich auch Rosse und Rüstungen nochmals zum Pfand geben.“ Die Recken lachten über den fröhlichen Helden. Nur Heime lachte nicht und drohte, wenn er seinen Hengst nochmals verpfände, dann solle es ihm ans Leben gehen.
Bei dem Gastmahl, das der Dienstmann herrichtete, war kaiserliche Pracht aufgewendet. Da saßen oben an den Tischen die Herren und unten das Gesinde. Aber die leckere Kost und die edlen Weine wurden den Knechten wie den Herren gereicht. Alle waren fröhlich, nur Heime blickte manchmal hämisch und ergrimmt auf den jungen Gesellen, der, wie er fürchtete, wiederum über sein Eigentum verfügte. Ilmenrik setzte sich, als Raum war, an Heimes Seite und fragte ihn heimlich, ob er den Mann kenne, der ihm die Schramme auf der Stirn geschlagen habe? Heime versetzte, es war Dietleib, der Sohn des Fürsten Biterolf. Er werde ihn wohl wiedererkennen, wenn er ihm zu Gesicht komme, und dann solle es ihm das Haupt kosten. „Nun, tapferer Held“, sagte der junge Recke, „dein Gedächtnis ist dir abhanden gekommen. Ich will es dir zurückrufen. Sieh mir nur recht ins Angesicht, denn ich selbst bin jener Dietleib, den du mit deinen Raubgesellen überfielst, als er mit seinem Vater Biterolf durch den Falsterwald ritt. Der Räuber Ingram und seine Gesellen wurden von uns beiden gefällt, du aber entrannst mit der blutigen Wunde auf der Stirn durch deinen guten Hengst Rispe. Wenn du die Begebenheit nicht glaubst, dann trage ich hier an der Seite einen Zeugen, der es dir auf offenem Feld beweisen soll. Vertraust du dagegen meiner Rede, dann bleibt die Sache unter uns eine Heimlichkeit.“ Der Recke war verzagt geworden und recht wohl damit zufrieden, dass jenes Abenteuer geheimgehalten werde.
Der Wein, den der junge Held reichlich schenken ließ, mundete den Gästen und insonderheit dem Berner König. Derselbe erhob sich und rief laut, dass alle Zecher sein Wort vernahmen: „Heil und Dank dir, tüchtiger Dienstmann! Du sollst hinfort nicht mehr Rosse und Gewänder behüten oder zum Pfand austun, sondern in Ehren einer unserer Gesellen sein!“ - „Heil, Herr“, versetzte der junge Recke, „du übst solche Guttat nicht an einem unwerten Mann. Denn ich bin Dietleib, der Sohn des Fürsten Biterolf, dessen Kriegsfahrten unter den Hunnen und Reußen auch im Südland bekannt sind. Er und meine Mutter Dietlinde achteten meiner nicht, weil sie mich für schwach und zaghaft hielten, und ich musste viel im Kochhaus auf der Asche liegen. Aber ich sah oft die Waffenspiele seiner Mannen und ahmte sie heimlich nach. So wurde ich kraftvoll und wehrhaft. Als aber der Vater dessen innewurde, gab er mir diese Eisenrüstung, ein gutes Schwert und ein Ross. Auf der Rückreise von einer Hochzeit wurden wir im Falsterwald von Ingram und seinem Raubvolk angegriffen. Wir schlugen die üblen Raufbolde alle tot, bis auf einen, der mit blutigem Haupt auf seinem guten Hengst entrann.“ Dietrichs Gesellen nahmen den tüchtigen Helden gern in ihre Mitte, nur Heime blieb trotz des Weines finster und üblen Mutes.
Der junge Held zog mit dem König zurück nach Bern, wo er sich in manchem Abenteuer als treuer Geselle bewies. Er hatte indessen nicht lange Ruhe, sondern wollte die Sitten vieler Völker sehen und fuhr deswegen zu König Etzel ins Hünenland. Dort fand er seinen Vater Biterolf wieder, doch sie töteten sich in einem Zweikampf beinahe gegenseitig. Rüdiger von Bechelaren schritt ein und erklärte, dass sie Vater und Sohn seien. Da erkannten sich die Helden und vollbrachten gemeinsam noch mächtige Taten in großen Kämpfen. König Etzel bot ihnen, um sie bei sich zu behalten, das schöne und reiche Land Steiermark zum Lehen an. Biterolf überließ das Lehen seinem Sohn, welcher deshalb der „Stiräre“ genannt wurde, oft aber auch als Dietleib, der Däne, in der Sage erscheint.
Zwergenkönig Laurin und sein Rosengarten
Meister Hildebrand saß zu Garden (am Gardasee) auf seiner Burg, leerte von Zeit zu Zeit den silbernen Becher, den ein dienender Knappe wieder füllte, und blickte hinaus auf den See und die Berge, die bis an das Ufer des Wasserspiegels reichten. Da sah er einen Reiter auf der Heerstraße daher traben, der ihm bekannt schien. Er winkte ihm ein Willkommen zu, denn es war Dietleib, der liebe Geselle, den er lange nicht gesehen hatte. Der Mann trat bald in das Gemach und erwiderte den Gruß, doch nicht frohen Mutes, wie er sonst pflegte, denn er schien eine wichtige Sache auf dem Herzen zu haben. „Ja, lieber Meister“, sagte er, als Hildebrand nach seiner Sorge forschte, „ich will es dir wohl kundtun, auf dass du mir deinen Rat nicht verweigerst. Ich hatte eine gar holdselige und kluge Schwester mit Namen Künhild, die meinem Haushalt in der Steiermark vorstand. Sie ging mit anderen Mägdlein zum Spiel und Tanz auf eine grüne Wiese, und ich selbst schaute der harmlosen Kurzweil zu. Da verschwand sie plötzlich mitten aus dem Reigen, und niemand wusste, wohin sie gekommen war. Später erfuhr ich von einem zauberkundigen Mann, dass der Zwergenkönig Laurin sie mittels einer Tarnkappe geraubt und mit sich in seinen hohlen Berg geführt habe. Dieser Berg ist im Land Tirol, wo der Zwerg auch einen wundersamen Rosengarten hat. Nun meine ich, guter Meister, du müsstest der Dinge wohl kundig sein und könntest mir mit Rat und Tat Beistand leisten, so dass ich die Jungfrau wieder aus der Gewalt der Unterirdischen befreie.“ - „Das ist eine üble Sache“, meinte Hildebrand, „und sie kann manchen tüchtigen Recken in Not bringen. Ich will aber mit dir nach Bern zu Dietrich und den anderen Gesellen reiten. Dort wollen wir gemeinsam beraten, was zu tun ist, denn das Gezwerg ist gewaltig durch seine Herrschaft über ein weites Reich unter der Erde und durch viele Zauberdinge.“
Die beiden Recken ritten nach Bern (heute Verona), wo sie den König und die Gesellen zusammen antrafen. Als nun der junge Held von Steiermark die Begebenheit berichtete, rief Wolfhart zuerst, er wolle das Abenteuer allein bestehen und nicht bloß die Jungfrau frei und ledig machen, sondern auch den Knirps von einem König auf seinem Sattelbogen gebunden nach Bern führen. - „Hei, unverzagter Held“, rief Dietleib, „weißt du auch den Weg zu finden, der in den Rosengarten führt?“ - „Den kenne ich wohl“, sagte der Meister, „aber Laurin behütet den Garten, und wer ihm die Rosen stört, von dem nimmt er keine andere Buße, als den rechten Fuß und die linke Hand.“ - „Er nimmt erst die Buße, wenn er die Gewalt dazu hat, und das sollen ihm unsere guten Waffen verwehren“, sagte Wittich, an sein Schwert schlagend. „Wohlan“, versetzte der König, „wir wollen nicht die lieblichen Blumen antasten, sondern die schöne Künhild, die Schwester unseres Gesellen, aus der Gewalt der Bergmännlein erlösen, denn das geziemt den Recken.“ Nachdem nun die Helden gelobt hatten, dass sie den Garten nicht verletzen wollten, erbot sich Hildebrand, ihr Führer zu sein. Mit ihm, dem kundigen Geleitsmann, machten sich folgenden Tages Dietrich, Dietleib, Wittich und Wolfhart auf den Weg, um den Zwergenkönig und seinen Garten in Tirol aufzusuchen.
Die Reise ging nordwärts in die wilden Berge, durch finstere Schluchten, an Abgründen vorbei über Schneefelder und starrende Gletscher, wo man oft die Rosse am Zügel führen musste. Es war eine mühevolle und gefährliche Fahrt. Sie stiegen immer höher in der einsamen Bergwüste empor, und oft erstarrten ihnen von der kalten Luft Hände und Füße. Als sie wiederum eine Höhe erstiegen und ein Schneefeld überschritten hatten, wehte ihnen plötzlich milde Frühlingsluft entgegen, und bald lag der wonnesame Garten vor ihnen ausgebreitet. Sie atmeten mit Lust den süßen Blumenduft und blickten mit Freude auf die Beete, wo Tausende von Rosen auf den Zweigen schwankten, auf die Lauben von Lorbeer, Granat- und Myrtenbäumen, auf die weitschattenden Linden und Olivenbäume, wo die Vöglein ihr süßes Getön hören ließen. Es wurde ihnen so wohl, als seien sie im Paradies, alle Sorgen der Erde schwanden, und frische, fröhliche Lebenslust erfüllte ihre Herzen.
Lange standen die Helden wie eingegangen in den himmlischen Freudensaal, der die Gerechten einst aufnehmen soll. Da rief Wolfhart, das Schweigen unterbrechend: „Hinein, Gesellen, in das irdische Paradies!“ Er spornte sein Ross nach dem Garten, aber ein mächtiges Tor aus Eisen mit Goldstäben verwehrte den Eintritt. Der Recke stand betroffen vor der Pforte und blickte das Eisen an. Dagegen stürmte der starke Wittich jetzt herzu, sprang vom Pferd und trat mit äußerster Gewalt gegen die Tür, doch richtete nicht mehr aus, als sein Gefährte mit Anstarren. Sofort gesellten sich auch Dietrich und Dietleib zu den Belagerern, und wie die vier kraftvollen Männer ihre Anstrengungen vereinigten, wich die Pforte aus Angeln und Banden, so dass der Zutritt offen war. Den inneren Raum umschloss noch eine Goldborte oder ein Goldfaden, wie vor Zeiten die heiligen Götterhöfe verwahrt waren. Die schwache Einfriedigung wurde von Wittich zerrissen und niedergetreten, und vom Widerstand erbittert, begann er zusammen mit Wolfhart, die Rosenbüsche zu verwüsten. Meister Hildebrand mahnte vergebens, sich des Frevels zu enthalten. Dietleib sah unentschlossen zu, und Dietrich blieb unter einer Linde stehen, deren Blütenduft ihn berauschte.
Schon hatten die beiden wütigen Zerstörer auch die Pferde in den Garten getrieben, um die Verwüstung fortzusehen, da rief Hildebrand, der außerhalb geblieben war: „Lasst ab! Nehmt eurer Schwerter wahr! Er kommt, der Herr des Gartens!“ Alle blickten auf und sahen einen Lichtglanz in der Ferne, der eilends näherkam. Bald unterschied man einen Reiter auf windschnellem Ross. Er war von kleiner Gestalt, aber ganz nach Reckenart gerüstet. Schild und Brünne glänzten von Gold, den Helm umschlossen Goldspangen und ein Reif von Juwelen, in deren Mitte ein Karfunkel wie die mittägliche Sonne strahlte. Er hielt sein Pferd an, als er die Verwüstung sah. „Heda!“, rief er zornig: „Ihr Raubgesellen, was habe ich euch Leids getan, dass ihr meine Freude und Wonne zerstört? Oder hattet ihr Ursache zur Fehde? Warum habt ihr mir diese nicht als ehrliche Recken angesagt? Nun sollt ihr mir alle Buße tun, jeder die rechte Hand und den linken Fuß!“ - „Bist du König Laurin?“, fragte der Berner Held: „Dann sind wir dir Buße schuldig, und ich will dir reichlich Gold darbringen. Aber die rechte Hand braucht jeglicher zur Führung des Schwertes, und auch den Fuß kann keiner füglich entbehren, der ein Ross besteigen will.“ - „Ein Feigling, wer von Buße redet!“, schrie Wolfhart: „Wir zahlen mit Lanzenstößen und Schwertstreichen.“ - „Und ich will den Däumling da samt der Geis, die er reitet, an der Steinwand zerschellen, dass das Gesinde der Knirpse seine Knöchlein nicht wieder zusammenlesen kann.“, schrie Wittich. „Wolfsgezücht!“, rief der Zwerg, „Wolfsgezücht mit vermessenen Zungen und schwachen Händen, macht eure Rede wahr, wenn ihr tüchtige Recken seid!“ Damit warf er sein Rösslein herum und rannte gegen Wolfhart, der bereits mit erhobenem Speer anstürmte. Der unverzagte Held flog aber, sobald ihn des Gegners Waffe berührte, wie eine Feder vom Sattel. Nicht besser erging es dem starken Wittich. Er verfehlte den Zwerg und stürzte selbst, von dessen Speer getroffen, fünf Schritte weit kopfüber in den Staub.
Laurin sprang vom Ross, zog ein großes Messer heraus und näherte sich dem Helden, der ohne Besinnung am Boden lag, um ihm Hand und Fuß abzuschneiden. Zum Schutz seines Gesellen erhob sich Dietrich. Doch Hildebrand raunte ihm zu: „Wage nicht den Speerstoß! Er hat drei Zauberdinge, die du ihm zuerst entreißen musst: Am Finger den Ring mit einem Siegstein, um die Lenden einen Zaubergürtel, der ihm Zwölfmännerstärke verleiht, und in der Tasche ein Tarnkäpplein, das ihn unsichtbar macht.“ Der Berner streckte sein gutes Schwert Eckesachs über den gefallenen Wittich, um ihn zu beschützen. Sogleich griff ihn der Zwerg mit blanker Waffe an, umkreiste ihn, wie ein Habicht seinen Raub und schlug ihn bald da, bald dort, dass das Blut unter den Rüstungsringen hervorrann. Der kühne Berner dachte, das Männlein mit einem Schlag in Stücke zu hauen, aber er traf es nicht, und wenn er traf, so biss das Schwert nicht, denn Laurins Helm, Schild und Rüstung waren Zwergenarbeit und in Salamanderblut gehärtet. Der Kampf wurde für ihn immer nachteiliger, da rief ihm Hildebrand zu: „Edler Held, gedenke meines Rates, oder du bist verloren!“ Sofort tat der Berner einen Schirmschlag und wurde mit dem Zwerg handgemein. Zwar stieß ihn dieser mit der Kraft eines Riesen zurück, aber es war ihm doch gelungen, demselben den verhängnisvollen Ring vom Finger zu streifen, den der Meister herzuspringend sogleich an sich nahm. Dennoch war der Streit nicht weniger heftig, ja Laurin schien noch stärker als zuvor. Dietrich bat um eine kurze Waffenruhe und Laurin gewährte sie, indem er sagte: „Du bist ein wackerer Kämpfer, aber ich werde doch meine Pfänder nehmen.“ Er stützte sich dabei auf sein Schlachtschwert, dessen Knauf kaum seine Hände erreichten. Als der Kampf wieder begann, traf der Zwerg mit dem ersten Hieb den Schild des Königs, dass ein großes Stück davon herausgetrennt wurde. Dafür unterlief ihn der Berner nochmals und fasste ihn am Gürtel, während derselbe seine Kniee wie mit einer Zange umklammerte und ihn rücklings zu Boden warf, dass die Ringe der Rüstung laut klangen. Durch den heftigen Ruck, war indessen der Gürtel, den der König festhielt, zerrissen und beim Sturz des Helden zu Boden gefallen.
Hildebrand bemächtigte sich sogleich des Kleinods, aber er, wie der kampfmüde Held und die anderen Recken sahen den Zwerg nicht mehr. Der Berner fühlte die Streiche des unsichtbaren Gegners, doch konnte ihn nicht treffen. Darüber geriet er in Berserkerwut, so dass er die Wunden nicht mehr fühlte und sein Atem wie versengende Glut wurde. Er warf Schwert und Schild weg, sprang wie ein Tigertier nach der Richtung, wo er des Gegners Waffe sausen hörte, und fasste den Zwerg zum dritten Mal. Er riss ihm die Tarnkappe vom gekrönten Helm, und nun stand der unglückliche Laurin vor ihm und bat um Frieden. „Erst nehme ich die Pfänder von dir und das Haupt dazu, dann hast du Frieden!“, rief der wütende Held, den flüchtigen Zwerg verfolgend. „Rette mich, Dietleib, lieber Schwager!“, rief dieser, zu dem Recken fliehend: „Deine Schwester ist meine Königin.“ Dietleib schwang den Kleinen sogleich zu sich auf sein Ross und jagte mit ihm davon in den wilden Tann. Daselbst ließ er ihn nieder und hieß ihn sich verbergen, bis er den ergrimmten König für die Sühne geneigt gemacht habe.
Als Dietleib auf den Kampfplatz zurückkehrte, fand er den Helden zu Ross und in gleicher Wut, wie zuvor. Er forderte von ihm des Zwerges Haupt oder sein eigenes. Schon blitzten die Schwerter in den Händen der erbitterten Helden, doch da umfasste Hildebrand seinen Herrn, Wolfhart tat dasselbe mit Dietleib, und die freundlichen Reden der beiden Gesellen brachten endlich Versöhnung und auch Sühne mit Laurin zustande. Bald saßen die Männer ohne heimlichen Zorn beisammen, und der König der Unterirdischen wurde in den Bund der Gesellen aufgenommen. „Wohl, ihr tapferen Kämpfer“, sagte er, „nun will ich euch auch die Wunder in meinem hohlen Berg aufschließen und euch gastlich beherbergen. Und du, Dietleib, sollst mir dann deine holdselige Schwester zur rechtmäßigen Hausfrau zusprechen.“ - „Es ist altes Recht“, versetzte der Held von Steiermark, „dass einer Jungfrau, wenn sie geraubt und wiedergefunden ist, die Wahl zusteht, ob sie bleiben oder in ihr Haus zurückkehren will. Bist du dessen Willens?“ - „Mit Freuden!“, rief der Zwerg: „Lasst uns ungesäumt aufbrechen! Seht ihr dort den Berg mit dem weißen Haupt? Dort ist mein Reich. Also gleich zu Ross, damit ich die Verwüstung in meinem Garten nicht mehr sehe. Wenn die Maienlüfte wieder wehen, blühen meine Rosen von neuem.“
Die Reise nach dem schneegekrönten Berg war weiter, als die Recken geglaubt hatten, und dauerte bis zum folgenden Mittag. Da gelangte man an den Fuß des weißen Hauptes und erblickte einen Anger, so schön wie der Rosengarten. Blumendüfte erfüllten die Luft, Vogelsang ertönte tausendstimmig in den Zweigen, und Zwerglein zogen in Scharen vorüber, etliche rüstig mit Hammer und Schurzfell, andere geschmückt wie Könige, noch andere, mit Schalmeien und Hörnern blasend. Es war, als ob die Vögel ihr süßes Getön nach der Musik der Erdmännlein gestimmt hätten, so lieblich klang das alles zusammen. Laurin führte die Helden zu dem Berg, dessen Tor sich vor ihm auftat. Die Gäste waren so froh und von Erdensorgen frei, dass sie willig dem Führer folgten. Nur Wittich, der den Sturz durch den Speer des winzigen Gegners nicht vergessen konnte, war misstrauisch und warnte vor dem Eintritt in die unterirdische Welt. Aber Wolfhart rief: „Haben wir nicht unsere Schwerter zum Schutz und Trotz? Ich muss die Wunder im Berg schauen, und wenn der Teufel selbst da unten los wäre.“ Damit sprang er in den inneren Raum, die anderen, auch Wittich folgten, und das Tor schloss sich krachend hinter ihnen. „Die Hölle hat ihren Rachen hinter uns zugetan, nun kommt der Teufel und seine Ahne, uns zu holen“, sagte Wittich. Auch die anderen Helden sahen sich erschrocken um, aber hatten keine Muße, lange nachzusinnen, denn die Wunder der Unterwelt taten sich vor ihnen auf, und die Schätze der Tiefe, die sonst niemals menschliche Augen zu schauen vermögen, offenbarten sich ihren Blicken.

In König Laurins Reich, aus Villamaria „Elfenreigen“
Eine lichte Dämmerung herrschte in dem weiten Raum der Halle, wie wenn der volle Mond die Erde beleuchtet. Die Wände waren glattpolierter Marmor, von Gold- und Silberstäben in Felder geteilt. Der Fußboden war wie ein einziger Achat, die Decke ein Saphir, und leuchtende Karfunkel hingen davon herunter, wie Sterne am blauen Nachthimmel. Mit einem Mal wurde es taghell, denn sie selbst, die Königin kam, umgeben von einer Schar Mägdlein, alle klein von Wuchs und doch lieblich anzuschauen. Ihr Gürtel und Halsschmuck glänzten von Juwelen, in ihrer Krone aber strahlte ein Diamant wie eine Sonne und verbreitete den hellen Schein, der die Halle durchstrahlte. Schöner als der Schmuck war die Herrin selbst, die ihn trug, und man konnte die Augen nicht von ihr abwenden. Sie setzte sich neben Laurin und winkte ihrem Bruder Dietleib, dass er sich an ihrer anderen Seite niederlasse. Als dies geschehen war, umarmte sie ihn, als wolle sie ihn nicht wieder von sich lassen, und fragte, wie es im Haus stehe, ob noch die Wiesen grünten, die Bäume blühten und das Wild in den Wäldern den fröhlichen Jäger für seine Mühen belohne, wie damals, als sie an seiner Seite mit dem Speer die heimischen Berge und Täler durchwanderte. Indessen waren die Tische mit köstlichen Speisen und Getränken besetzt, und die Gäste langten wacker zu. Während gespeist wurde, führten Bergmännlein und Mägdlein mancherlei Spiele auf, und Musik ertönte bald wie Vogelsang, bald ernst und feierlich, wie Orgel und Posaunen. Die Gäste fühlten sich so behaglich, dass selbst Wittich allen Argwohn und Groll schwinden ließ.

Als sich Laurin einmal entfernte, fragte Dietleib die Schwester, ob sie nicht hier im unterirdischen Paradies wohnen und Königin sein wolle. Da rannen ihr Tränen aus den Augen, und sie sagte ihm, sie könne die Heimat, die menschliche Gesellschaft nicht vergessen, und sie wolle lieber drüben in einer Bauernhütte wohnen, als hier unter dem Zwergenvolk. Laurin sei liebreich zu ihr, aber er sei doch nicht wie andere Menschen. Als Dietleib dies vernahm, versicherte er ihr, er werde sein Leben daran wagen, sie zu befreien.
Der Zwergenkönig trat wieder ein, bat Dietleib, ihm zu folgen, und führte ihn in ein abgelegenes Gemach. Hier sagte er ihm, seine Gesellen seien alle dem Tode verfallen, er aber solle als sein Schwager erhalten bleiben und gemeinsame Sache mit ihm machen. „Verräter, falscher Zwerg!“, rief der Held: „Ich lebe und sterbe mit meinen Gesellen. Du aber bist in meiner Gewalt!“ Er griff nach ihm, aber Laurin schlüpfte im Nu durch die offene Türe, die sich hinter ihm schloss und der Recke vergeblich zu öffnen versuchte.
Laurin trat wieder ganz harmlos in den Saal, ließ die Becher aus einem besonderen Gefäß füllen und forderte die werten Gäste auf, diesen Trank bis auf die Neige zu leeren, damit sie glückliche Träume hätten. Als sie dies arglos taten, fielen sie sogleich in Schlaf. Darauf sagte Laurin zur Königin: „Wende dich nach deinem Gemach, denn diesen Männern, die meinen Rosengarten verwüstet haben, muss es ans Leben gehen. Deinen Bruder habe ich jedoch in sicheren Gewahrsam gebracht, dass er um deinetwillen erhalten bleibe.“ Künhild weinte laut und erklärte ihm, dass sie sterben werde, wenn er das blutige Vorhaben ausführe. Er gab ihr keine bestimmte Antwort, sondern wiederholte sein Gebot. Sobald sich die Herrin entfernt hatte, stieß er in sein Horn, und alsbald erschienen fünf Riesen und viele Zwerge. Er befahl ihnen, den Recken Arme und Beine mit Stricken fest zu binden, damit sie sich, wenn sie erwachten, nicht rühren könnten. Dann hieß er sie die Gefangenen in ein tiefes Verließ schleppen und früh am Morgen wacker sein, um seine weiteren Befehle zu vernehmen. Er selbst begab sich hierauf in sein Schlafgemach und dachte nach, ob er die Eingekerkerten der Königin zu liebe im Verließ am Leben erhalten, oder für ihren Frevel mit dem Tod bestrafen solle. Letzteres schien ihm das Sicherste, und er entschlief mit diesem Gedanken.

Schon bald nach Mitternacht erwachte der Berner, fühlte sich geknebelt und rief die Gesellen zu Hilfe. Sie waren alle in gleich hilfloser Lage und ahnten den Verrat. Da geriet Dietrich in Wut, und sein Feueratem versengte die Stricke, so dass eine Hand frei wurde. Darauf löste er auch die andere Hand und die Füße und befreite sodann die übrigen Gesellen. Was aber war weiter zu tun? Sie vermochten die eherne Tür des Kerkers nicht zu sprengen und hatten weder Schwerter noch Heergewand. So waren sie hilflos der Rache des Zwerges preisgegeben. Wie sie sich über ihre schlimme Lage berieten, wurde leise an die Tür gepocht, und eine sanfte weibliche Stimme fragte, ob sie noch am Leben seien. „Heil dir, edle Königin“, sagte Hildebrand leise, „wir sind noch wacker, aber ohne Waffen.“ Sogleich sprang die Tür auf, ein Lichtschein fiel in den Kerker, und die Gefangenen erkannten die schöne Künhild und neben ihr den lieben Gesellen Dietleib. Dieser hatte auch die Waffen und Rüstungen herbeigeschleppt und erzählte ihnen, während sie sich wappneten, wie die Schwester von dem Verrat Kenntnis erhalten und gewacht habe, bis die Zwerge eingeschlafen waren, und wie sie dann mit einem Zauberring die Pforte seines Gemachs aufgesprengt, ihm die Waffen gezeigt und ihn endlich hierhergeleitet habe. Die Königin gab nun jedem Recken einen Ring, durch dessen Kraft man die Zwerge trotz ihrer Tarnkappen sehen konnte, und gebot ihnen, sich ganz still zu verhalten. Doch Wolfhart rief „Hollaho!“, dass es durch den Berg scholl: „Jetzt ist es an der Zeit zu lärmen, denn wir stehen in Rüstung!“ Wie eine Antwort auf den Fehderuf tönte dreimal der Klang eines Heerhorns, und es schwirrte und rauschte, es klirrte und rasselte von Waffen durch alle Gänge und Säle der unterirdischen Welt.
Laurin war durch Wolfharts Ruf erwacht und hatte sogleich, die Befreiung der Gefangenen erkennend, das Heervolk der Zwerge aufgeboten. Tausende strömten herbei, alle wohlgerüstet und entschlossen, ihren heimischen Berg, die Quelle ihrer Macht und ihrer Schätze, mit Gefahr ihres Lebens zu verteidigen. Der Sturm des Krieges war los, und aus entfernten Bergen zogen immer neue Scharen von Erdmännlein heran. König Laurin war nicht unwillig darüber, dass er nun mit offener Gewalt den Untergang der frevelhaften Recken herbeiführen konnte, anstatt mit arger List und Tücke. Er ordnete seine Macht und griff die fünf Gesellen mutig an. Diese kamen sehr ins Gedränge, wurden voneinander getrennt, verteidigten sich aber nicht bloß mit ihren guten Klingen, sondern mit allen Mitteln, die ihnen zu Gebote standen. Sie stürzten Steintische, eiserne Türen und Felstrümmer auf die zahllosen Zwerglein und zerschmetterten Tausende. Laurins Horn rief noch fünf Riesen mit ihren Stangen zu Hilfe, aber die starken, sieggewohnten Helden behielten endlich die Oberhand. Die Riesen wurden erschlagen, die Zwerge in ihre Schlupfwinkel verscheucht und Laurin selbst gefangen.
Auf Bitten der Königin wurde dem König der Zwerge das Leben geschenkt, sodann belehnte Dietrich Sintram, einen anderen König, mit dem gewonnenen Berg gegen das Versprechen eines jährlichen Zinses. Nachdem alles wohlgeordnet war, verließen die Helden den Schauplatz ihrer Taten. Sie führten viele Schätze mit sich und auch die Königin, freudig über ihre gewonnene Freiheit, sowie den König Laurin, der unwillig über seine Gefangenschaft und die misslungene Rache an den Zerstörern seines Gartens war.
In Bern war des Jubels und der festlichen Gelage kein Ende. Die Helden wurden weithin gepriesen, der unglückliche Laurin aber war der Leute Spott. Er ging frei herum, doch versuchte sich zu verbergen, soviel er konnte. Nur ein Wesen war da, welches ihm Teilnahme bewies, nämlich Künhild, die Königin. Sie traf ihn einstmals, wie er einsam am Ufer des rauschenden Sees weilte. Sie redete ihn freundlich an, suchte ihn zu trösten und versicherte ihm, er werde des Königs Huld erlangen, wenn er sich treu beweise. „Treu?“, lachte er grimmig: „Ja, sie meinen, sie hätten einen Hund getreten, der dafür die Hände lecke. Aber der getretene Giftwurm hat einen Stachel und sticht, und wer ihn getreten hat, muss daran sterben. Du sollst alles wissen, was sich begeben wird: Walberan, mein Oheim, dem das Zwergen- und Riesenvolk vom Kaukasus bis zum Sinai dienstbar ist, zieht mit Heeresmacht heran, mich zu rächen. Vor ihm wird der starke Dietrich mit seinen Gesellen erliegen, Bern und das ganze Land verwüstet werden, und dann, wenn die Rache erfüllt ist, führe ich dich wieder in mein Reich und pflanze den Garten, dass die Rosen im Maimond schöner blühen und du dort mit mir in einem königlichen Palast wohnst.“ - „Laurin“, versetzte sie, „du hattest mich damals durch List und Zauberkunst geraubt. Aber ich habe wohl deine große Liebe erkannt, womit du mich geehrt und geschmückt hast. In deinem unterirdischen Reich wollte ich nicht bleiben, aber ich will dir hold und deine Königin im Rosengarten sein, wenn du nicht mehr der Rache, sondern der Liebe und Treue gedenkst.“ Sie verließ ihn, und er dachte lange der Rede nach.
Wenige Zeit nachher kam der Berner Held zu dem Zwergenkönig, fasste seine Hand und sagte: „Lange genug hast du Schmach erduldet. Du sollst forthin kein Gefangener mehr sein, sondern unter meinen Gesellen sitzen, oder in deinen Berg zurückkehren, wenn es dich gelüstet. Den Rosengarten besuchen wir gemeinsam, sobald im kommenden Frühling die Blüten wieder hervorbrechen. Schweigend folgte der Zwerg dem König in die Halle, wo die Recken beim Gelage versammelt waren. Er saß an Dietrichs Seite mitten unter den fröhlichen Zechern und gedachte der Rache, die er nehmen wollte, wenn sein Oheim hereinbreche. Als aber die holdselige Königin erschien und ihm den Becher mit freundlichem Gruß darreichte, da siegte die Liebe über den Hass, und er rief, den Becher leerend: „Nun will ich euer Geselle sein auf Leben und Sterben!“
Noch saßen die Gäste beim festlichen Mahl, da trat ein Sendbote des Königs Walberan ein und verkündigte den Fehderuf seines Herrn. Derselbe entbot Krieg und gänzliche Verwüstung der Stadt und des Landes, wenn man nicht alsbald Laurin in sein Reich einsetze und als Buße für den Frevel alles Geld, alle Waffen der streitbaren Mannschaft, desgleichen die rechte Hand und den linken Fuß eines jeden Recken ausliefere, die sich der Gewalttaten schuldig gemacht hätten. „Sage deinem Herrn“, rief der Berner stolz, „dass wir ihn erwarten, dieweil wir des Geldes, der Waffen, der Hände und Füße zum Kampf bedürftig seien.“ - „Entbiete ihm auch meinen Gruß und Dank für seinen Beistand“, fügte Laurin hinzu, „und sage ihm, dass ich nun frei und ledig sei und in Liebe und Freundschaft mit dem König von Bern stehe.“
Man rüstete sich in Bern mit großem Eifer. Die Vasallen und Bundesgenossen wurden entboten, Waffen geschmiedet, Rosse herbeigeführt. Doch war die Kriegsbereitschaft noch nicht vollendet, als schon Walberan mit sechzigtausend Riesen und Zwergen vor Bern erschien. Die Leute hatten alle Tarnkappen und waren unsichtbar aus dem fernen Morgenland genaht. Aber vor der Stadt nahmen sie die Kappen ab und schlugen ihr Lager auf. Ein so großes und prächtig gerüstetes Heer war noch nicht gesehen worden, und die Krieger tummelten ihre Rosse und schwangen Speere und Schwerter, dass man wohl ihren Mut und ihre Wehrhaftigkeit erkannte. Laurin ritt ins Lager, um gütlichen Vergleich zu vermitteln, aber Walberan schalt ihn einen Knechtssohn, der sich in das Joch gefügt habe. Er behielt ihn bei sich und forderte als Vorspiel der Schlacht zwölf Recken zum Kampf auf offenem Feld mit einer gleichen Zahl seiner Krieger. Seine Forderung wurde genehmigt. Der Berner selbst nebst Wittich, Hildebrand, Dietleib, Wolfhart und andere trabten durch das offene Tor den feindlichen Kriegern entgegen, die sich bereits aufgestellt hatten. Wolfhart stürmte zuerst gegen den riesigen Schildung, wurde aber aus dem Sattel gehoben und von dem Gegner, der vom Pferd sprang, besinnungslos, wie er war, zum feindlichen König getragen. Diese Schmach zu rächen, sprengte der Berner in die Schranken. Ihn wollte Walberan bestehen, und wie derselbe aus der Mitte seiner Krieger hervorjagte, waren alle Augen vom Glanz seiner Rüstung geblendet. Sein Schild glänzte wie Spiegelglas, und die Krone auf seinem Helm bestand aus köstlichen Edelsteinen, die Sonne, Mond und Sterne vorstellten und sich ebenso wie die leuchtenden Himmelslichter bewegten. Als die königlichen Kämpfer zusammentrafen, krachten und zersplitterten die Schäfte, aber Dietrich wurde gleich seinem Vorgänger hart zu Boden geworfen. Er sprang indessen sogleich wieder auf und griff zur blanken Waffe. Der Schwertkampf war fürchterlich. Die Könige bluteten schon aus schweren Wunden, und es schien den Zuschauern, als ob beide sich gegenseitig fällen würden. Da stürzte plötzlich zwischen die blitzschnell geschwungenen, mörderischen Klingen der ungerüstete Laurin, ohne Furcht vor dem drohenden Tod. Er umschlang den König Walberan und flehte, dass er Frieden mache. Fast gleichzeitig umfasste Hildebrand den zornigen Berner, und die Bitten der beiden Friedensboten bezwangen den wilden Mut der erbitterten Streiter. Sie senkten die Schwerter und gaben ihre Zustimmung zur Sühne.
So wurde die Kriegsfahrt in eine friedliche umgewandelt, und die Könige bestätigten bei frohem Festmahl den Bund des Friedens. Dann erhob sich der Berner Held und redete vieles zum Lob des treuen Gesellen Laurin, der mit Gefahr seines Lebens den Kampf geschlichtet habe, dem er deshalb seine Herrschaft in den Bergen und seinen Rosengarten als frei und eigen zurückerstatte. Als er so gesprochen hatte, trat Königin Virginal mit der schönen Künhild ein, legte deren Hand in die Laurins und sagte, die würdigste Belohnung für die Treue des Herrn der Berge sei die Hand seiner Königin, die künftig mit ihm den Rosengarten bewohnen wolle, wenn ihr Bruder Dietleib seine Zustimmung gebe. Dieser erhob keinen Einwand, und mit dem Fest des Friedens wurde zugleich die Hochzeit gefeiert. Als im Maimond des folgenden Jahres die Rosen wieder blühten, erhob sich durch die Hände der kunstreichen Zwerge im Rosengarten ein Wunderpalast, den mancher Hirte und Alpenjäger schon gesehen hat, der aber für neugierige Menschenkinder unsichtbar ist. Laurin, der reiche Zwergenkönig, und die liebliche Künhild sollen noch jetzt zuweilen in den Tälern von Tirol sich zeigen und treue, liebende Burschen und Mädchen beschenken, dass sie den Ehebund schließen und ihren Haushalt gründen können. Und wenn ein solches beglücktes Paar am frühen Morgen oder des Abends beim Geläut der Feierglocken auf einer Alpenhöhe weilt, so sieht es den Rosengarten an der Grenze des ewigen Schnees und darin den Palast, glühend vom Schein der auf- oder untergehenden Sonne.
Mönch Ilsan und Kriemhilds Rosengarten
Dietrich war unter Abenteuern und Kriegsfahrten in das reifere Mannesalter eingetreten, er war jetzt ein vollendeter Held und sich seiner Kraft bewusst. Als nun der König einstmals viele seiner Gesellen um sich versammelt sah und der Becher fleißig geleert wurde, da meinte er großmütig, kein Herrscher auf Erden habe solche Helden um sich vereinigt, keiner solche Abenteuer siegreich bestanden, als er mit seinen Gesellen, und keiner könne sich mit ihnen vergleichen. Jubelnd stimmten ihm die Recken zu, nur der junge Herzog von Brabant, der kürzlich als Gast aus dem Rheinland erschienen war, blieb still und sah spöttisch drein, als sich mancher seiner Taten rühmte. Da fragte ihn der Berner, ob er auf seinen Fahrten kühnere Helden irgendwo gesehen habe? „Wohl habe ich solche gefunden“, rief jener, „mit denen sich keiner vergleichen kann, wer er auch sei, und das war in der guten Stadt Worms am Rheinstrom im Land der Burgunden. Da ist der große Rosengarten, eine Meile lang und eine halbe breit, von einer goldenen Borte umfriedet, den die wunderschöne Kriemhild selbst mit ihren Dienerinnen pflegt, und zwölf gewaltige Recken halten Wache, dass niemand den Garten betrete ohne den guten Willen der königlichen Jungfrau. Sie lädt alle ein, die mit den Wächtern kämpfen wollen, doch bisher konnte sie niemand besiegen, und viele Riesen und Recken haben schon ihr Haupt verloren.“ - „Hei, lasst uns Rosen pflücken, die mit dem Blut der Helden begossen sind!“, rief der Berner: „Mit meinen Heergesellen gedenke ich, die stolzen Wächter zu bestehen.“ - „Wenn ihr das versuchen wollt“, sagte der Herzog, „so wisset, dass die liebliche Jungfrau jedem Sieger ein Rosenkränzlein und einen Kuss gewährt.“ - „Um eine Rose und einen Jungfrauenkuss“, sprach der alte Meister, „gebe ich nicht ein Haar aus meinem Bart, noch weniger mein Haupt, und ich habe doch viele Barthaare, aber nur ein einziges Haupt. Wer Rosen pflücken und Jungfrauen küssen will, der findet deren genug zu Bern, und es bedarf nicht der Fahrt an den Rhein.“ Die anderen Gesellen stimmten ihm zu, denn sie kannten wohl die burgundischen Recken. Aber der unverzagte Berner sprach trotzigen Mutes, es sei nicht um Rosen und Küsse zu kämpfen, sondern um ewige Ehre und Heldenruhm, und wollten die Gesellen nicht mit ihm reiten, dann würde er das Abenteuer allein bestehen. Darauf erhob sich Meister Hildebrand und sagte, auf seinen ergrauenden Bart deutend, er sei in Ehren ergraut und werde den König nicht verlassen. Er habe so manche Fahrt mit ihm vollbracht, daher hoffe er auch, im Rosengarten sein Haupt zu bewahren. Diese Worte erweckten den Mut der Gesellen, und sie erklärten sich alle zur Fahrt bereit. Da waren: Der Berner Dietrich selbst, Meister Hildebrand, Hornboge, der starke Wittich, Helfrich und sein Sohn Ruotwin, Heime, genannt der Grimmige, Wildeber und Wolfhart. Es waren aber nur neun kühne Recken, und es sollten zwölf sein, um den zwölf Wächtern zu begegnen.
Hildebrand wusste auch jetzt Rat. Er sagte: „Der zehnte Recke ist der gute Rüdiger von Bechelaren, der uns den Dienst nicht versagen wird, der elfte ist der tüchtige Dietleib von Steiermark, und der zwölfte mein frommer Bruder, der Mönch Ilsan.“ - „Der Mönch Ilsan!“, riefen die Helden durcheinander, „der schmaust im Kloster Fastenspeise, mästet den Leib und betet Litanei! Der reitet nimmer auf Heldenfahrt!“ - “Wir wollen gehen und ihn werben. Er hat unserem Herrn eine Heerfahrt auf Treue gelobt und wird sich uns nicht verweigern.“ So sprach der Meister, und die Recken machten sich auf den Weg, die drei Mitkämpfer zu werben.
Sie kamen zuerst nach Bechelaren im Donauland. Dort fanden sie gute Herberge bei Rüdiger, dessen Hausfrau, die edle Gotlinde, mit Dietrich verwandt, nämlich die Tochter seiner Base (seiner Vatersschwester) war. Was Haus und Keller des reichen Markgrafen vermochten, wurde den werten Gästen dargereicht. Auch weigerte sich der gutmütige Rüdiger nicht, die Helden an den Rhein zu begleiten, nur wollte er zuvor Abschied von Etzel nehmen, weil er sein Markgraftum von dem mächtigen König als Lehen trug. Die Helden fuhren dann weiter nach Steiermark zu Dietleib, dem kühnen Mann. Sie fanden ihn nicht in seinem Heim, sondern nur Biterolf, seinen Vater, der von dieser Fahrt an den Rhein ernstlich abriet, weil nur ein Narr um eine Rose und eines Kusses willen den Kampf auf Leben und Tod mit den kühnsten Recken aller Welt versuche. Als sie aber auf der Fahrt dem jungen Helden begegneten, sprach Dietrich: „Lieber Dietleib, sage mir mit wahrer Treue, ob dich etwas am Übermut der Recken vom Rhein ärgert, zu denen uns Kriemhild, die königliche Jungfrau, herausgefordert hat. Wenn wir diese Herausforderung nicht bestehen, wäre es uns ewig Schimpf und Schande.“ Daraufhin fanden sie ihn sogleich entschlossen, in ihrem Gefolge den Kampf im Rosengarten zu wagen. Weiter ging die Reise nach dem Kloster Münchenzell, wo sich Hildebrands Bruder aufhielt.
Auf dem weiten Feld vor dem Kloster schlugen sie ihre Zelte auf, und als Mönch Ilsan am Morgen auf die wehrhafte Klostermauer stieg und Ausschau hielt, da sah er auf der Heide das stolze Heer liegen. Sogleich wandelte sich das Gemüt des frommen und heiligen Mannes, und er rief: „Das sollen sie wohl bereuen, die uns hier angreifen!“ Seine Brüder fürchteten seinen kämpferischen Zorn und dass sie durch ihn alle verlorengingen. Doch Mönch Ilsan sprach: „Ich will ihnen entgegenreiten und sie allein bestehen. Solange mir das Schwert in der Hand nicht zerbricht, sollen sie manche tiefe Wunde erfahren.“ So wurde der Mönch in stahlharte Rüstung gekleidet, und kühnen Mutes ritt er mit gewaltiger Lanze in starker Hand vor des Klosters Pforte. Da erkannte Meister Hildebrand als erster, dass der Mönch Ilsan in der Kutte angeritten kam und sprach: „Ich sehe wahrlich, das ist mein Bruder, der uns in seiner Wildheit ganz allein bestehen kann.“ Sogleich ritt er dem zornigen Klostermann entgegen, der ihn mit der Lanzenspitze alsbald anrannte. Doch dem Stoß wich er aus, nahm den Helm ab und sprach seinen Bruder mit freundlicher Rede an: „Du sollst mit uns reiten und unser Heergeselle sein. Wir wollen zum Rosengarten nach Worms am Rhein, um dort Rosen zu pflücken, vom Blute rot, und die königliche Jungfrau zu küssen oder den grimmigen Tod.“ - „Hei, du alter Graubart!“, antwortete der Mönch: „Bist du noch nicht genug nach Abenteuern geritten? Ziehst du wie ein Gockelhahn allen Kämpfen nach? Du solltest doch bei deiner Frau Ute gut Gemach haben.“ - „Das könnte ich, wenn ich wöllte“, antwortete Hildebrand, „doch hat mich mein König zu dir hierher gesandt, dass du des Eides und der Hilfe gedächtest, die du uns gelobt hast, wenn wir ihrer bedürftig wären.“ - „Wohl gedenke ich des Eides, den ich ihm einst getan, doch kämpfe ich nicht zur Kurzweil.“, sprach der Mönch: „Ist es euch Not zu Bern, dann will ich mit euch gehen. Doch geht es nur um Rosen, will ich mein Haupt bewahren.“ Darauf sprach der alte Hildebrand: „Magst du den Dienst nicht dem edlen König von Bern leisten, dann tue es, um meinetwillen, frommer Bruder. Ich möchte dich wohl schauen, mit dem Schwert in starker Hand, zur Ehre aller Mönche!“ - „Gut, ich will mir Urlaub erbeten, wenn es der Abt gewährt. Derweilen kommt zu Tisch, zu speisen, was ihr begehrt. Bestellt sind Keller und Küche mit Vorrat aller Art, mit Wildbret, Wein und Fischen. Der Abt mit den Dechanten schmaust und trinkt gern, derweil wir armen Brüder von ferne zuzuschauen haben, und müssen beten und fasten und das Brevier lesen.“ - „Und doch hast du feiste Wangen.“, sprach Hildebrand: „Das Fasten ist wohl heilsam dir.“
Darauf ging Mönch Ilsan zum hochwürdigen Herrn und sprach: „Gebt mir Urlaub, um mit dem König von Bern zu reiten und mir ein Siegerkränzlein am Rhein zu holen. Das will ich euch aus dem Rosengarten bringen.“ Der Abt sprach: „Frommer Bruder, es ist nicht unser Recht, dass wir für Könige fechten sollen, denn wir sind Gottes Knechte. Zu seinem Dienst sollen wir Tag und Nacht bereit sein, dem Gott, der uns geschaffen hat, und Buße tun für die Sünde in dieser Zeitlichkeit.“ - „Hochwürdiger!“, rief im Zorn der Mönch: „Hört mein Wort: Träfe diese Recken am Rhein ein Leid, das ich abwenden könnte, aber ihr mich nicht gehenlasst, dafür müssten meine Brüder wahrlich Buße tun.“ Der Abt erschrak und sprach: „Viellieber Bruder, willst du mir vom Rhein ein Rosenkränzlein bringen, dann wollen wir für dich beten und für deine Sünden Buße tun. Wenn du gern reitest, dann zieh hin nach deiner Wahl.“ Da ging der starke Mönch Ilsan mit Freude vom Abt zur Halle, wo die Recken sich weidlich taten. Dort zog er die Kutte aus und stand in stolzer Rüstung, wie ein Held bedarf.
Meister Hildebrand rief: „Trägst du immer eine Rüstung unter der Kutte?“ - „Ja, lieber Bruder“ antwortete der Mönch, „das ist mein altes Kampfgewand.“ Dietrich beschaute des Mönches Breitschwert und sprach: „Mit einem guten Predigerstab bist du wohl auch bewährt. Wem dieser Stab den Bann löst, der ist zwar seiner Sünden ledig, aber nicht mehr weit vom Grab. Wüßten die Burgunden, wie du Sünde vertreibst, dann wollten sie wohl lieber Heiden bleiben als dir beichten.“ Und mancher alte Bruder, der das von ferne sah, sprach: „Gott sei Dank und Lob! Er hat uns oft die Bärte tüchtig gerauft und gezogen, wenn wir ihm nicht tun wollten, was er gebot. Vielleicht kommt er nicht wieder, dann hat im Kloster unsere Not ein Ende.“ Ja, manche verfluchten ihn sogar und baten Christus im Himmel um seinen Tod. So schauten sie mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu, wie sich Ilsan seinen Schild und Speer bringen ließ, womit er in früheren Tagen oft gekämpft hatte, sein gutes Ross Benig bestieg und voller Freude mit den Recken von Bern durch die Klosterpforte davonritt.

Die Helden fuhren vorerst nach Bern, wo die Versammlung war. Dort erwartete sie Wolfhart, der sich über den gerüsteten Mönch im Gefolge sehr wunderte, und mit ihm nichts zu tun haben wollte. „Der alte Sünder soll zurück in seine Zelle gehen!“, rief er, worüber Ilsan erzürnte, so dass Meister Hildebrand den Streit mit guten Worten schlichten musste. Der edle Markgraf Rüdiger war der letzte, der sich einfand. Er hatte zuvor Abschied von seinem Lehnsherrn, König Etzel, genommen und von ihm eine silberglänzende Rüstung mit goldbesticktem Umhang erhalten, denn der reiche Führer der Hünen wollte, dass sein Markgraf in Ehren unter den kühnen Recken von Bern wie unter den Burgunden sich kundtue. Nun ging die Fahrt an den Rhein, wo der kühne Fährmann den rechten Fuß und die rechte Hand als Preis für die Überfahrt forderte, vor allem, als er den Mönch Ilsan im Gefolge erkannte. Er rief: „Wer hat nach euch gesandt, ihr alter Laienbruder? Macht euch wieder in eure Zelle! Dort solltet ihr mit euren Brüdern Metten singen, daheim im Kloster mit heiligem Sinn und Mut.“ Meister Hildebrand musste wieder vermitteln, denn er war ein guter Freund des Fährmanns, und bezahlte ihn mit Gold, Silber und Gewändern. So wurden die Helden samt ihrem zahlreichen Gefolge in einem Boot über den Rhein gebracht, das so überladen schien, dass Wolfhart aus Furcht ins Wasser sprang, um ans Ufer zurückzukehren und dabei bald ertrunken wäre. Nur mit Mühe konnte er aus dem reißenden Strom gerettet werden.
Vor Worms schlugen sie ihre königlichen und reichgeschmückten Zelte auf. Darauf erwählte man Rüdiger zum Boten an den König zu Worms, um den Kampf im Rosengarten anzukündigen. Er war wohlbekannt am Rhein und wurde gastlich von der wunderschönen Kriemhild selbst empfangen. Sie verweilten im Rosengarten unter einer Linde, in der aus Gold gemachte Vögel saßen, die durch Luftröhren mit einem Blasebalg zum Singen gebracht werden konnten. Sie sangen gegeneinander, kleine und größere, und es war niemand so traurig, dass er daran keine Freude finden konnte. Auf Wunsch des edlen Markgrafen ließ Kriemhild den Blasebalg betätigen, und nachdem er eine Weile auf den Gesang gelauscht hatte, sprach er: „Ihr habt auf dieser Erde ein paradiesisches Himmelreich. Könnte ich darin verbleiben, wenn ich das sagen darf, mir wäre ein ganzes Jahr wie ein einziger Tag.“ Dazu spielte eine Jungfrau aus dem Gefolge Kriemhilds die Harfe so himmlisch schön, dass alle Herzen von höchster Freude und Liebe erfüllt wurden. Der Markgraf erhob sich, zog den goldbestickten Ehrenumhang aus, den er von König Etzel empfangen hatte, und schenkte ihn der Harfenspielerin zum Dank. Unsinnig erschien es ihm jetzt, in diesem paradiesischen Garten von Kampf zu reden, doch Kriemhild fragte ihn nach dem Grund seines Erscheinens. Da überbrachte er seine Botschaft, die freudig aufgenommen wurde, und Kriemhild, die schönste aller Jungfrauen, setzte Tag und Stunde fest, da im Rosengarten um Rosen und Küsse und unvergänglichen Ruhm gekämpft werden sollte.
Der Garten war eröffnet, die Recken kampfbereit, zwölf gegen zwölf, doch immer nur je zwei gegeneinander. Der stürmische Wolfhart wollte der erste sein, und ihm begegnete der mächtige Küchenmeister Rumold, der ihm im ersten Anlauf mit der Lanze vom Pferd stieß, so dass er in die dornigen Rosen fiel. Daraufhin erwachte in ihm der wilde Wolf, und er schlug Rumold so tiefe Wunden, dass er mit seinem Blut die Rosen begoss und das Feld räumen musste. Nachdem der stolze Wolfhart seinen Gegner gefällt hatte, verschmähte er den Kuss der Jungfrau und begnügte sich mit dem Kränzlein. Danach kämpfte Wildeber gegen den Truchsess Ortwin, Heime gegen den Mundschenk Sindold, Dietleib gegen den Marshall Dankwart und Hornboge gegen den Kämmerer Hunold. Die Kämpfe wogten hin und her, doch schließlich siegten Dietrichs Gesellen und gewannen sich Küsschen und Rosenkränzlein. Das wollte sich Hagen, der mächtige Berater des Königs, nicht länger mit anschauen, und begab sich in die Schranken. Hildebrand forderte Wittich auf, ihm zu begegnen, der aber gegen diesen mächtigen Recken nur kämpfen wollte, wenn er Dietrichs Pferd Falke für diesen Kampf bekomme. Dietrich willigte ein, und gewaltig stießen sie sich mit ihren Lanzen, bis diese brachen und die Helden zu ihren Schwertern griffen. Hier konnte nun Wittich mit seinem Schwert Mimung einen Vorteil gewinnen, verwundete Hagen nach langem Gefecht und zerschlug ihm Schild und Schwert. Daraufhin wurde Hagen grimmig und verfluchte Kriemhild als Urheberin dieses Unglücks im Rosengarten. Wittich senkte sein Schwert, verschonte Hagen, reichte ihm die Hand, schloss Freundschaft mit ihm und verzichtete auf Kuss und Rosenkranz.
Nun schritt der Mönch Ilsan in seiner grauen Kutte zu Fuß in die Schranken und wälzte sich mit Wonne in den Rosen herum, so dass Kriemhild meinte, man habe ihr einen Narren gesandt. Darauf gebot sie den Spielman Volker in den Kampf, der zunächst glaubte, mit seinem Fiedelbogen ein einfaches Spiel zu haben, sich lustig machte und rief: „Zum Kirchenchor möge er lieber gehen und beim Messesingen helfen. Das stünde dem Narren besser an!“ Darauf antwortete Ilsan: „Du sollst noch spüren, ob ich ein Narr bin!“ Und schlug ihn mit der Faust, dass er mit seiner Fiedel rücklings in die dornigen Rosen fiel. Da bemerkte der kühne Spielmann, dass er einen gewaltigen Kämpfer gegen sich hatte, erhob sich und ging den Mönch mit harten Schlägen an. Sein Fiedelbogen strich gewaltig über den Helm, und im Gegenzug sauste der Predigerstab durch die Rüstung, dass die Rosen ringherum mit Blut benetzt wurden, und die beiden Recken in große Not gerieten. Schließlich schlug der Predigerstab so hart auf des Fiedlers Nacken, dass ihm das Blut in Strömen floss, und er zu Boden sank. Um Volkers Leben zu schonen wurde der Kampf beendet, und der Sieger empfing den Kuss der königlichen Jungfrau, die dabei laut aufschrie, denn ihre rosenroten Lippen wurden vom Stachelbart des Mönches verwundet, dass ihr das Blut über das Kinn rann. Da sprach er:
„Schöne Jungfrauen am Rhein, doch von allzu weicher Art,
Ich küsse keine wieder mit meinem Stachelbart.“
Daraufhin drückte sie ihm den Rosenkranz so hart auf sein geschorenes Haupt, dass auch ihm das Blut wie Tränen über die Wangen lief.
Das Ganze verdross nun auch König Gunther, und er schickte seinen jüngsten Bruder Giselher in den Wettkampf, der auf Helfrich traf, aber ebenso unterlag wie der Markgraf Gere gegen Helfrichs Sohn Ruotwin. Darauf sprach der König zu Gernot, seinem mittleren Bruder: „Lass dir unseren schändlichen Spott geklagt sein! Nun sorge du dafür, tüchtiger Held, stets kühn und mutig, dass man von deiner Stärke ewig singt und spricht.“ Sogleich machte sich Gernot kampfbereit und forderte Markgraf Rüdiger heraus. Als der Kampf einige Zeit blutig hin und herwogte, sprach jene Jungfrau, die von Rüdiger das edle Ehrengewand geschenkt bekam: „Ach, reicher Gott im Himmel, hilf doch dem guten Rüdiger!“ Bei diesen Worten erzürnte Kriemhild und verbot ihr solche Rede, dass sie schwieg. Doch bald darauf unterlag Gernot und flüchtete blutüberströmt, um sein Leben zu retten. Da gab Kriemhild dem edlen Rüdiger einen besonders liebreichen Kuss und einen duftig blühenden Rosenkranz, so dass der Markgraf den Garten als hochgeehrter Held verließ.
Als König Gunther sah, wie seine Brüder im Wettkampf unterlagen, wurde er zornig, rüstete sich selbst zum Kampf, um die Wunden seiner Brüder zu rächen, und erschien mit einer Krone aus rotem Gold auf seinem Helm. Ihm stellte sich Meister Hildebrand entgegen und sprengte auf seinem Ross ins Rosenfeld. Gunther galoppierte ihm entgegen, und ihre Lanzen zersplitterten gegenseitig an ihren wehrhaften Schilden. Da stiegen sie von den Pferden und schlugen sich mit ihren scharfen Schwertern gegenseitig tiefe Wunden. Das Blut floss durch die Rüstungsringe und färbte das Rosenbeet. Bald hatten sie sich auch ihre Schilde zerhauen, und Meister Hildebrand holte zu einem mächtigen Schlag gegen Gunther aus. Da sprang Kriemhild zwischen die Kämpfer, um das Leben ihres Königs und Bruders zu retten, und verlieh Hildebrand das Rosenkränzlein. Auf den lieblichen Kuss verzichtete er und sprach: „Nein, das soll nicht sein! Ich will ihn daheim von meiner lieben Ehefrau Ute empfangen. Nun lasst euren Bruder in die Herberge tragen und seine Wunden pflegen.“ So verließ der alte Hildebrand den Kampfplatz und wurde von Dietrich freudig empfangen.
König Gunther war verzweifelt und wusste nur noch einen Rat, um die Ehre der Burgunder zu retten: Der unverletzliche Siegfried solle anstatt Markgraf Eckewart in den Kampf ziehen, der von den zwölf burgundischen Recken noch übrig war. Hagen stimmte zu, und König Gunther versprach Siegfried für diesen Dienst die Hand seiner Schwester Kriemhild. Siegfried war bereit, Kriemhild küsste ihn freundlich auf seinen Mund und sprach: „Nun kämpfe mutig, und ich tue dir mehr dergleichen kund.“ So legte er seine Rüstung an, ergriff die Waffen und rief: „Wer nimmt den Kampf mit mir auf?“ Darauf sprach Hildebrand: „Dietrich mein Herr, ich habe dir die Ehre hier am Rhein bewahrt. Siehst du Siegfried aus Niederland in den Garten reiten? Nun kämpfe du für unsterblichen Ruhm mit diesem mächtigen König!“ - „Meister, lass dein Spotten sein!“, antwortete der Berner, „Lieber bestände ich vier Recken, selbst die besten vom Rhein. Willst du mich an diesen Unverwundbaren verraten? Wer könnte mit einem fechten, den keine Waffe verletzen kann?“ - „Freilich, niemals besiegt ihn eine zaghafte Hand“, antwortete Hildebrand, „aber wer mit ganzem Herzen kämpft, kann ihn sicherlich bestehen.“ - „Nein, ich will nicht gegen ihn kämpfen!“, rief Dietrich, riss sich zornig den Helm vom Haupt und ging aus dem Rosengarten. Hildebrand rannte ihm nach und sprach: „Nie sollst du mehr mein Herr sein, verzagter Dietrich, denn du schändest damit nicht nur dich, sondern auch deine Gesellen!“ Sie gingen in ein kleines Wäldchen, und Hildebrand versuchte, Dietrich immer mehr zu provozieren, bis er ihm sogar mit der Faust ins Gesicht schlug, dass er niedersank, und schließlich sein Schwert zog, um Dietrich als Feigling zu töten. Da zog nun auch Dietrich das Schwert und schlug Hildebrand, der noch schwach und verwundet vom Kampf sogleich niedersank. Mittlerweile hatte Wolfhart die beiden im Rosengarten vermisst, fand sie im Wäldchen und rief: „Herr von Bern, erschlagt ihr jetzt eure eigenen Gesellen? Und getraut euch nicht vor den Frauen mit Siegfried zu kämpfen?!“
Daraufhin sah Dietrich keinen Ausweg mehr, ließ sich sein Ross Falke bringen und ritt in den Rosengarten, wo er auf Siegfried traf. Sie grüßten sich ritterlich, verneigten sich voreinander und begannen den Kampf mit ihren Lanzen, die aber bald schon an ihren Schilden und Rüstungen zerbrachen. Daraufhin stiegen sie von den Rössern und kämpfen in den Rosen mit ihren Schwertern, Siegfried mit Balmung und Dietrich mit Eckesachs. Wild tobte der Kampf, und ihre Helme glühten bald von den Schlägen, doch keiner konnte den anderen verletzen. Mit Lust sah Kriemhild diesem Spiel zu. Doch Hildebrand bemerkte bald, dass Dietrich nicht mit ganzer Kraft kämpfte und schickte Wolfhart in den Ring, der dort lautstark verkündete: „Meister Hildebrand ist tot! Er ist an seinen Wunden gestorben und muss begraben werden.“ Da stürzte in Dietrich eine Welt zusammen. Was war nun noch zu verlieren? Ohne zu denken ließ er jetzt sein Schwert tanzen, das mit jedem Gegenschlag von Siegfried mächtiger und bald so schnell und unvorhersehbar wurde, dass Siegfrieds Schild, Rüstung und Helm völlig zertrümmert waren, seine Kleider zerfetzt, und Kriemhild das Schlimmste befürchtete. Mit lauten Worten wollte sie den Kampf beenden und rief: „Lasst nun ab, Herr Dietrich, von eurem Streit und stellt um meinetwillen das Fechten ein. Ihr habt gesiegt zu Worms am Rhein!“ Aber Dietrich hörte sie nicht, und man sah ihn wie einen Wütenden durch die Rosen toben und Siegfried vor sich hertreiben. Da erschien Hildebrand, stellte sich furchtlos zwischen die Kämpfer und sprach zu Dietrich: „Wohlgetan! Du hast gesiegt, und ich bin wiedergeboren!“ Diese Worte hörte Dietrich, kam wieder zu sich und beendete den Kampf, so dass sich Siegfried vor ihm verneigen und den Rosengarten verlassen konnte. Darauf sprach Kriemhild: „Herr Dietrich, ihr seid ein tapferer Held, wie wohl keiner sonst in der Welt zu finden ist.“ So empfing der Berner Kuss und Rosenkranz, und umarmte auch Meister Hildebrand, glücklich, dass er noch lebte.
Schließlich sprach Dietrich: „Verehrte Königin, haben wir gesiegt, so gewährt uns nun, wieder nach Hause zurückzukehren.“ Sie antwortete vor allen Recken: „Wohl getan! Zieht heim mit Heil, ihr unverzagte Helden. Wer sich mit Überheblichkeit den Spott erkaufte, hat mit Recht Schande verdient.“ So hatten die unverzagten Helden von Bern in Worms am Rhein unvergänglichen Ruhm gewonnen und kehrten freudig und hochgefeiert in ihre Heimat zurück.
Auch Ilsan kehrte in sein Kloster zu den Mönchen zurück, die über seine Rückkehr erschraken und ihn nur widerwillig hereinließen. Dort überreichte er dem Abt den versprochenen Rosenkranz, und drückte ihn ebenso fest auf dessen geschorenen Kopf, dass das Blut floss. „So leicht war er nicht zu gewinnen“, sprach er, „und es wäre Sünde, wenn Ihr das Leid nicht mit mir teilen wolltet.“ Und der Abt antwortete: „Da du wiedergekommen bist, so nehmen wir auch deine Sünden auf uns.“ Doch einige Mönche zeigten sich widerspenstig, so dass Ilsan sie an ihren Bärten zusammenband und festhielt, bis sie nachgiebig wurden.
Die Heerfahrten für Etzel und Ermenrich
Dietrich lebte in Freundschaft mit Etzel, dem mächtigen König der Hünen, seitdem dieser durch Markgraf Rüdiger mit ihm in Verbindung gekommen war. Der Berner hatte den König nach seiner Heimkehr von den Burgunden durch Boten grüßen lassen und ihm seine Hilfe in Bedrängnis zugesichert. Es ereignete sich bald, dass er an sein Versprechen gemahnt wurde. Der Markgraf nämlich, der mit Recht in allen Landen als der Gute und Milde bekannt war, kam an den Hof zu Bern, wo er allzeit ein willkommener Gast war. Als dann die Helden beim Becherklang in traulichem Kreis von ihren Abenteuern sprachen, so erzählte auch Rüdiger von seinen Erlebnissen. „Mein Vater“, sagte er einstmals, „war ein kühner Held und gewann im arabischen Spanien ein ansehnliches Reich. Er stand in guter Freundschaft mit den benachbarten arabischen Königen, denen er oft mit tapferer Hand Beistand leistete. Doch als er starb und mir die Herrschaft als Erbe hinterließ, erwachte der Hass gegen den Sohn des Fremdlings. Alle Nachbarn vereinigten sich gegen mich. Ich erwehrte mich geraume Zeit der Feinde, musste aber endlich der Übermacht weichen. Mit meiner Gefolgschaft bahnte ich mir einen blutigen Weg durch die Menge und gelangte unter vielen Kämpfen zu König Etzel im Hünenland. Derselbe nahm den verlassenen, ganz aufgegebenen Flüchtling freundlich und mit großen Ehren auf. Ich wurde sein Dienstmann, und als ich ihm gute Treue in seinen Kriegsfahrten bewiesen hatte, übertrug er mir als Lehen das reiche Markgraftum zu Bechelaren. Da wohne ich nun in Freuden mit meiner lieben Hausfrau Gotlinde. Doch wenn ein Festgelage in seiner guten Königsburg ansteht, dann beruft mich der große König an seinen Hof, und ich muss mit ihm den Hochsitz teilen. Dann erzählt er von seinen Erlebnissen, wie er auch in früher Jugend länderlos und schier heimatlos war und sich in mancher Not befunden hatte.“
„Ja, sicherlich“, unterbrach Meister Hildebrand den Markgrafen, „das ist mir alles besser bekannt als dem großen König selbst. Da war einst Wilkinus Beherrscher der Wilkinenmänner...“ - „Hei, mein Urahne!“, rief Wittich: „Was ist von ihm zu sagen?“ - „Ich weiß nur“, fuhr der Meister fort, „dass er ein mächtiger und kühner König war, der sich Reußen- und Griechenland unterwarf, doch den König Hertnit daselbst in seiner Burg Holmgard als Lehnsfürsten bestehenließ. Aber dieser König sammelte nach dem Tod des siegreichen Wilkinus die ganze Macht der Reußen unter sein Banner, löste das Joch der Lehnsherrschaft auf und überzog Nordian, den Sohn und Erben des Wilkinus, mit Krieg. Er gewann manche Schlacht, kämpfte und verheerte in den feindlichen Ländern, bis sie ihm untertänig wurden und Nordian seine Lehnsherrschaft anerkannte. Der besiegte König behielt als Lehen die Herrschaft in Seeland und gab sich damit zufrieden, obgleich er vier gewaltige, riesenhafte Söhne hatte, nämlich den Aspilian, Edgeir, Awentrod und auch den furchtbaren Widolf mit der Eisenstange, der allezeit an einer Kette geführt wird, weil er, wenn gereizt, alles niederschlägt und zertrümmert. Als der mächtige Hertnit sterbend alle seine Herrlichkeit verlassen musste, verteilte er die Reiche unter seinen drei Söhnen: Osantrix erhielt die Gewalt über die Wilkinen, Waldemar über die Reußen, und Ilias wurde König der Griechen. Osantrix warb dann um die Hand der schönen Oda, der Tochter des Hünenkönigs Melias. Er gewann sie durch List und Gewalt mit Hilfe der vier riesenhaften Söhne Nordians, seines Lehnsmannes. Die verschwägerten Könige blieben nun in Freundschaft, doch konnten sie den trotzigen Friesen nicht wehren, die oftmals in das Hünenland einfielen und es verheerten, denn Melias war alt und schwach geworden, und die Wilkinenmänner kamen wegen der Entfernung immer zu spät, um die flüchtigen Raubfahrer zu greifen. Der Führer dieser kühnen Scharen, die oftmals bis an die Königsburg Susat vordrangen, war der jetzt so mächtige König Etzel, den man auch Attila („Väterchen“) nennt.
Er war ein Sohn des friesischen Königs Osid. Er hatte seinem Bruder Herding die Herrschaft über Friesland zugestehen müssen und nichts weiter erhalten, als Rüstung und ein gutes Schwert. Aber die Friesen sind kühne und kriegsbereite Männer, und als der junge Held erfuhr, dass der alte König Melias gestorben war, versammelte er ein größeres Heer und eroberte das ganze Hünenland. Die Fürsten erkannten den kühnen Etzel als neuen König an, und so wurde der bisherige Raubfahrer und Angreifer zum Schirmherrn des Hünenlandes.“
„Wie aus der Blumenkrone süßer Duft wohl steigt empor,
So unter dem grauen Barte des Meisters quillt hervor
Die goldne Flut der Rede von alten Zeiten und Taten;
Wir wollen singen und sagen, wie klug er uns immer beraten.“
So sang Isung, der trefflichste Spielmann seiner Zeit, der, auch wehrhaft und waffenkundig, unter den Gesellen Dietrichs einen Sitz eingenommen hatte. „So ist es, weidlicher Sänger“, nahm Rüdiger wieder das Wort, „doch vernehmt nun, was sich weiter begeben hat. König Etzel begehrte Helche, die schöne Tochter des Wilkinenkönigs Osantrix, zu freien. Ich ging deshalb als Bote zu ihm und wurde wohl empfangen. Als ich aber mein Gewerbe dem König sagte, versicherte er zornig, er werde nimmer das Gesuch bewilligen, da Etzel mit Unrecht das Hünenreich an sich gebracht habe, das ihm als Schwiegersohn des Melias zustehe. Er achtete es auch nicht, als ich mit Krieg drohte, und hieß mich meiner Wege ziehen. Darauf überzog Etzel das Wilkinenland mit Krieg, und als Osantrix mit Heeresmacht anrückte, lagerten beide Könige im Falsterwald einander gegenüber. Ich brach bei nächtlicher Weile mit meinen Mannen in das feindliche Heer ein und tat so großen Schaden, dass die Wilkinenmänner schleunigst den Rückzug antraten. Die Hünen taten das Gleiche, und es trat Waffenruhe ein. Nach Jahresfrist ging ich mit einer Schar tapferer Männer wieder in den Falsterwald und hieß sie daselbst eine starke Burg erbauen und meiner warten. Darauf verstellte ich mein Gesicht durch Färbung und Bartwuchs und begab mich zu König Osantrix. Ich sagte ihm, dass ich, ein treuer Dienstmann des verstorbenen Melias, von Etzel übel misshandelt und meiner Güter beraubt worden sei, und gewann sein Vertrauen, so dass er mich einstmals zu seiner Tochter Helche mit einer Botschaft sandte. Ich erzählte der Jungfrau von der Werbung Etzels, der sie zu sich auf seinen Thron erheben und mit ihr seine große Macht und Herrlichkeit teilen wolle. Wie zornig sie auch anfangs war, so willigte sie zuletzt doch ein. In mondheller Nacht erschien ich mit Pferden vor dem Haus, in welchem sie eingeschlossen war, sprengte den Riegel und entführte sie mit ihrer jungen Schwester. Wir wurden zwar verfolgt, doch erreichten die feste Burg im Wald, wo meine Getreuen meiner warteten. Ich hatte kaum Zeit, Botschaft an Etzel zu senden, da kam schon Osantrix mit zahlreichem Heer. Er umlagerte und stürmte unser Kastell, doch wir erwehrten uns der Feinde, bis Etzel mit großer Übermacht anrückte und die Wilkinenmänner zum Abzug zwang. Seitdem ist Kriegsnot zwischen den Reichen, viele Äcker liegen unfruchtbar, und der Hungerwurm frisst mehr Menschen, als hundert Linddrachen vermöchten. Gerade jetzt ist Osantrix wieder mit unzählbarem Heer eingefallen. Er hat auch die grimmigen Riesensöhne Nordians mit sich geführt, die ein Schrecken der Hünen sind. Da meint nun Etzel, wenn du, edler König von Bern, ihm Beistand leisten wolltest, dann würde er wohl in dem Kriegssturm bestehen.“ - „Wenn mein lieber Heergeselle Wildeber mit mir ist“, rief Wittich, „so gedenke ich, dass wir zwei allein der Riesen mächtig werden.“ Daraufhin sagte der Berner seine Hilfe zu und befahl die Rüstung für die Heerfahrt. Die Berner Helden gelangten zur rechten Zeit an, denn beide Heere standen sich bereits kampfbereit gegenüber.
Die Schlacht begann. Im Mitteltreffen der Hünen hatten die Berner ihre Stellung genommen. Hoch flatterte das Banner mit dem rotgoldenen Löwen in Hildebrands starker Hand, aber Wittich stürmte allen voran in die feindlichen Reihen. Er begegnete zuerst dem grimmigen Riesen Widolf, der ihn sogleich mit seiner Eisenkeule auf den Helm traf. Der Wurm, der den Helmkamm bildete, bog sich unter der Wucht des fürchterlichen Streiches, und obgleich Wielands Werk nicht zerbrach, so stürzte doch der Held vom Ross und lag ohne Besinnung am Boden. Vorüber brauste der Zug im wilden Schlachtgetümmel, niederwerfend, was Widerstand leistete. Heime kam mit genügend Abstand hinterher und nahm sich das Schwert Mimung aus der Hand Wittichs, den er für tot hielt. Nach mörderischem Kampf räumten die Wilkinenmänner das Feld, aber die Hünen verfolgten sie und gewannen reiche Beute. Zu spät gelangte Hertnit, ein Brudersohn des Osantrix, auf dem Schlachtfeld an. Er konnte die Niederlage seines Onkels nicht mehr verhindern. Doch fand er Wittich, der sich nur langsam von seiner Betäubung erholte, und führte ihn als Gefangenen mit zu Osantrix.
Die Sieger saßen zu Susat in Etzels Burg beim festlichen Mahl und freuten sich ihrer Taten. Aber Dietrich war nicht froh, denn er hatte sechzig seiner Mannen verloren, und was ihn am meisten betrübte, unter den Gefallenen war auch sein Geselle Wittich. Man hatte ihn nicht auf dem Schlachtfeld gefunden, und niemand wusste, wo er geblieben war. Als sich die Berner, reich beschenkt, zur Abfahrt rüsteten, trat Wildeber vor den König und bat um Erlaubnis, Wittich zu suchen, weil er ohne seinen Gesellen nicht heimkehren wollte. Dietrich gab willig seine Zustimmung, denn er hoffte selbst, der mächtige Recke werde Kunde von dem werten Freund erhalten.
Folgenden Tages erlegte Wildeber auf der Jagd einen Bären von ungewöhnlicher Größe. Er zog dem Wild das Fell ab, ging damit zu dem Spielmann Isung, der gerade von Bern an Etzels Hof gekommen war, und beriet mit ihm einen Plan, Wittich zu befreien, wenn derselbe, wie er vermutete, etwa bei Osantrix in Gefangenschaft sei. Er ließ sich nämlich vom Spielmann den Zottelpelz über die Rüstung ziehen, geschickt befestigen und folgte ihm dann als abgerichteter Tanzbär nach der Burg des Königs der Wilkinen.
Spielleute sind überall willkommene Gäste und ziehen frei durch aller Herren Länder. Daher wurde Isung auch auf der Burg wohl aufgenommen. Er vertrieb durch Spiel und Gesang, noch mehr durch die Künste seines Wunderbären, den Unmut, der seit jener Niederlage über den König gekommen war. Er lachte herzlich über den Tanz und die Sprünge des Tieres zum Klang der Fiedel, sogar Widolf, der grimmige Riese, der von seinem Bruder Awentrod an der Kette geführt wurde, lachte zum ersten Mal in seinem Leben, und das Haus zitterte von dem Gelächter, das wie aus der Hölle zu kommen schien. Da kam der König auf den Einfall, er wolle seine zwölf Hunde auf den Bären hetzen, um zu sehen, wie stark er sei. Vergebens bat Isung, das grausame Spiel zu unterlassen, weil ihm sein Petz mehr wert sei als alles königliche Gold, doch der König beharrte darauf und löste die grimmigen Hunde. Sie wurden sämtlich erwürgt, oder durch Tatzenschläge erlegt.
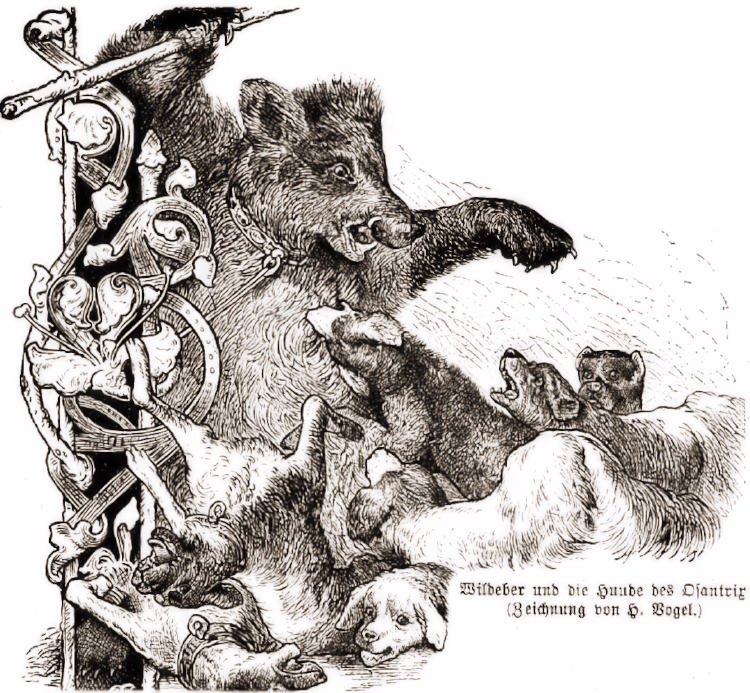
Da zog Osantrix zornig sein Schwert und hieb den Bären über den Nacken durch den Zottelpelz, aber die Klinge sprang von dem darunter verborgenen stählernen Halsberg zurück. Im Nu erfasste der Bär das Schwert, entwand es dem König und spaltete ihm den Kopf. Mit einem zweiten Streich traf er den schrecklichen Widolf zu Tode, dann auch dessen Bruder Awentrod. Desgleichen zog nun der Spielmann blank und hieb wacker drein, als die Wilkinenmänner ihr Oberhaupt zu rächen suchten. Bald nahmen alle Hofleute die Flucht vor Isung und seiner Bestie mit dem Schwert. Nun warf Wildeber die Bärenhaut ab, stülpte den Helm eines der Riesen auf sein Haupt und stand nun gepanzert als Recke neben seinem Wehrgenossen. Beide Helden durchsuchten das Königshaus, fanden Wittichs Hengst Skemming und seine Rüstung, nur Schwert Mimung und ihn selbst konnten sie nicht entdecken. Sie kamen aber endlich an eine eiserne Tür, und wie sie daselbst seinen Namen riefen, antwortete er von innen mit schwacher Stimme. Die Riegel wurden zurückgeschoben, die Tür aufgerissen, und da lehnte der Held in Ketten bleich und harmvoll an der niedrigen Wand. Sobald aber die Bande gesprengt waren und Wittich hinaustrat und die frische Luft atmete, gewann er Farbe und den gewohnten Mut zurück. Ein Becher Wein und ein Imbiss aus des Königs Küche vollendeten die Genesung. Er legte seine Rüstung an, ergriff ein anderes Schwert, obgleich er Mimung ungern vermisste, und bestieg sein Ross. „Nun fort!“ mahnte Isung: „Ehe die Wilkinenmänner in Überzahl anrücken!“ Er sowie Wildeber hatten sich aus dem Marstall des erschlagenen Königs beritten gemacht, und nun jagten die drei Helden eilends aus der Burg.
„Auf Treue“, sprach König Etzel, als sie vor ihn traten: „Ihr seid tüchtige Männer. Ihr habt mir guten Dienst geleistet und den Kampf allein zu Ende geführt. Der König von Bern ist reicher als ich, da er Gesellen hat, die ihr eigenes Leben wagen, um den Wehrgenossen aus der Not zu erlösen.“ Nach manchem festlichen Tag entließ er die Helden mit reichen Gaben nach Bern.
Als Dietrich die kühnen Helden wiedersah, war seine Freude groß. Er ehrte sie auf mancherlei Weise, aber dem starken Wittich wollte der Wein nicht munden, und er blieb meist schweigsam, wenn die anderen Gesellen den goldenen Becher und die fröhliche Rede kreisen ließen. Dietrich fragte ihn, warum er so harmvoll sei. Er antwortete, ihn gräme der Verlust Mimungs, der besten Gabe seines Vaters, und er wolle durch alle Länder fahren, um es wieder zu gewinnen. „Du brauchst nicht so weit zu fahren“, versetzte der Berner, „mich will bedünken, das Schwert, das Heime dort umgegürtet hat, ist dem Werk Wielands so ähnlich, wie ein Tropfen Blut dem andern.“
Dietrichs Heerfahrt gegen Rimstein
Die Rede wurde durch eine Botschaft unterbrochen, welche zwei schön gerüstete Recken vom Kaiser Ermenrich aus Romaburg brachten. Er war der Onkel von Dietrich und ließ seinen Neffen einladen, dass er ihm Hilfe leiste gegen den mächtigen König Rimstein, der sein Lehnsmann war, aber nunmehr im Vertrauen auf seine eigene Macht und die feste Burg Gerimsheim dem Lehnsherrn hatte entbieten lassen, er solle sich den Zins selber holen, denn er, der König, zahle nur mit scharfen Schwertern. Der Berner sagte seine Hilfe zu und entbot seine Gesellen und Dienstmannen. Als Dietrich seine Gesellen um sich versammelt hatte, erklärte Wittich, er werde an der Heerfahrt nicht teilnehmen, wenn ihm Heime nicht sein gutes Schwert Mimung zurückgebe, das er ihm als ungetreuer Heergenosse auf dem Schlachtfeld entwendet habe. „Ich nahm die scharfe Waffe als Kriegsbeute“, rief Heime trotzig, „als dich Widolf wie einen Buben mit dem ersten Schlag zu Boden fällte. Deshalb gehört es mir, denn es wäre sonst in Feindeshand gefallen. Bist du ein kühner Recke, dann versuche, es mir aus der Faust zu reißen! Ich denke aber, du wirst großen Schaden davon haben.“ Wittich fürchtete die scharfe Klinge in Heimes Hand. Er schwieg und warf nur dem Gegner grimmige Blicke zu. Da sprach Dietrich gütlich zu den Recken und bewog Heime, dem Gesellen das Schwert für die eine Heerfahrt zu leihen. Darauf bestiegen die Recken ihre Pferde und ritten mit allen aufgebotenen Mannen zu Ermenrich, der schon ein großes Heer versammelt hatte. Man rückte in das Gebiet des widerwilligen Königs ein, und dieser wich mit seiner schwächeren Macht unter manchen Kämpfen zurück, bis er seine feste Burg erreichte, die mit Kriegsvorrat reichlich ausgestattet war. Sofort wurde die Feste umlagert, man wagte Stürme, wandte Sturmböcke, Bliden (Katapults) und andere Wurfmaschinen an, doch alles vergeblich. Rimstein, ein kriegserfahrener Mann, vereitelte alle Versuche, und an den felsenfesten Mauern brach sich auch die Heldenkraft der kühnen Berner.
Wochen und Monde vergingen, ohne dass man weiterkam. Der Herbst nahte heran, wo die Dienstzeit des Kriegsvolkes abgelaufen war. Es wurde unmutig und drohte unverrichteter Sache an den heimischen Herd zurückzukehren. In einer mondhellen Nacht ritt Wittich auf Erkundung und hoffte, eine Stelle zu entdecken, wo man etwa die Mauer ersteigen könne. Er gewahrte sechs wohlgerüstete Männer, die er sogleich an den Schildzeichen als Feinde erkannte. Sie hatten ihn gleichfalls bemerkt und griffen ihn an, vermeinend, der einzelne Mann könne ihnen nicht entrinnen. Ihre Schwertschläge klirrten ihm auf Helm und Schild, aber er tat mit seiner starken Hand einen Streich auf den, der vorankämpfte, und Mimung spaltete dessen Helm, Haupt und Brünne bis auf den Gürtel. Bei diesem Anblick suchten die fünf übrigen Gesellen voll Entsetzen ihr Heil in den Sporen und jagten nach der Burg zurück. Wittich stieg ab, untersuchte den Gefallenen und fand, dass es Rimstein selbst war. Als der Held am Morgen Dietrich mit den anderen Gesellen antraf, sagte er: „Der Krieg ist zu Ende, der Urheber desselben tot, die Burg wird nun leicht zu erobern sein.“ Er erzählte darauf, was sich zugetragen hatte. „Er ist wirklich ein kühner Recke!“, rief Heime mit Hohn: „Er hat den altersschwachen Rimstein totgeschlagen, den auch ein altes Weib fällen konnte. Aber nun begehre ich Mimung zurück, das ich dem Schwätzer für diese Fahrt geliehen habe.“ - „Zuerst will ich es an deinem Tollkopf versuchen, ob es noch die Probe hält, ungetreuer Geselle! Du hast dort im Wilkinenland den Heergenossen in Todesnot wie ein Verräter verlassen und ihn noch seiner Waffe beraubt. Nun sollst du blutige Buße tun für deine Ruchlosigkeit!“ So sprach Wittich und stürzte mit gezogenem Schwert auf den Widersacher los. Auch Nagelring blitzte in der Hand Heimes, und schon klirrten die Waffen der beiden Gesellen auf Helm und Schild, aber der König sprang dazwischen und zwang die hadernden Männer zum Frieden, wie unmutig, wie kampfbegierig sie auch waren.
Das Gerücht von dem, was geschehen war, verbreitete sich im Heer, und Ermenrich selbst kam zu den Bernern und rühmte laut Wittichs kühne Tat. Darauf mahnte er zum Sturm auf die Festung. Den ganzen Tag dauerte der Kampf, und es wurden besonders viele Feuerpfeile in die Burg geschleudert, wodurch gegen Abend ein großer Brand entstand. Die lodernden Flammen im Innern, der unaufhörliche Hagel von Geschossen, der donnernde Anschlag der Mauerbrecher, dies alles erfüllte die Besatzung mit Schrecken. Sie öffneten die Tore und zogen Mann für Mann barhäuptig und barfuß, ihre bloßen Schwerter auf den Nacken gebunden, heraus, um die Gnade des siegreichen Lehnsherrn anzuflehen. Ermenrich verzieh dem Volk, weil der Anstifter des Abfalls schon seinen blutigen Lohn empfangen hatte. Er zog darauf mit seinen Recken und denen von Bern nach Romaburg, wo die Tapferen beschenkt und nach Gewohnheit der Sieg gefeiert wurde. Nach einigen Tagen rüstete sich Dietrich mit seinen Gesellen zur Heimkehr. Ermenrich dankte ihm für seine geleisteten Dienste und fügte hinzu, er betrachte ihn, den Neffen, wie seinen Sohn und die tüchtigen Gesellen als solche, die auch ihm angehörig seien und die er sämtlich mit Erbgütern belehnen wolle. Er bat auch den Berner, dass er dem kühnen Wittich Urlaub gebe. Derselbe sei nämlich seiner Mündel, der schönen Bolfriana, in Liebe zugetan, und er wolle ihm, wenn er ihre Huld gewinne, die reiche Herrschaft Drachenfels, die der edlen Frau eigen sei, als Lehen geben. Dietrich machte keinen Einwand, doch erinnerte den Gesellen noch an seine Treue, und der Held gelobte sie erneut mit feierlichem Eid.
Es dauerte nicht lange, so hatte Wittich, der in allen Kampfspielen den vornehmsten Preis erhielt, auch die Gunst Bolfrianens erlangt und feierte mit ihr fröhliche Hochzeit. Zu dem Fest belehnte ihn der Kaiser mit allen Ländern von Drachenfels bis Fritilaburg und noch weit jenseits der östlichen Berge. So wurde Wittich ein großer König, wie er einst seinem Vater gesagt hatte. Auch Heime kam an Ermenrichs Hof und musste ihm den Lehnseid leisten, da er nach dem Tod seines Vater Studas dessen Hof erbte, der unter der Herrschaft des Kaisers stand. Er erhielt aber noch andere Besitzungen und viel rotes Gold von seinem Oberherrn, der den Wert des Helden wohl zu schätzen wusste.
Der Fall von Kaiser Ermenrich
Ermenrich war ein mächtiger Herrscher und hatte seine Herrschaft durch Kriegsfahrten ansehnlich erweitert. Seine Ratgeber waren sehr kluge und listige Männer, deren Anschläge dem Oberhaupt von großem Nutzen waren. Sibich, sein Marschalk (Verwalter), kannte die Beschaffenheit und Natur aller Länder und Völker, und dessen vornehmster Diener und Helfer Ribestein verstand nicht weniger der Menschen Meinung und Gesinnung zu erspähen und sie durch kluge Rede dahin zu leiten, wohin es ihm am nützlichsten dünkte. Sie hatten ihren Herrn bewogen, mit dem wehrhaften Berner und seinen Gesellen gute Freundschaft zu halten, weil ihm derselbe ein allezeit hilfreicher Genosse war. Desgleichen suchten sie, die einzelnen Helden von Bern für ihr Oberhaupt zu gewinnen, damit sie auch ohne den guten Willen ihres alten Herrn die Schwerter im Dienst des Kaisers ziehen könnten. Es kam aber die Zeit, da eine große Veränderung in diesem Verhältnis eintrat.
Sibich hatte eine junge und sehr schöne Ehefrau, die ihm über alles lieb und hold war. Als er einstmals im Dienst seines Herrn eine weite Fahrt tun musste, ließ Ermenrich die Frau zu sich gebieten und tat ihr Gewalt an, weil er, wie schon viele Kaiser, meinte, einen Mann, der die höchste Macht in den Händen habe, binde weder Gesetz noch Sitte. Als der Marschalk von der weinenden Frau erfuhr, was sich begeben hatte, griff er nach seinem Dolchmesser, um sogleich Rache zu nehmen, aber besann sich eines Besseren. Er beschloss, durch kluge List den kaiserlichen Übeltäter langsam ins Verderben zu stürzen, dass er ein langes Leben hindurch die Qualen eines Verbrechers auf der Folterbank erdulde. Er wollte ihn zum Mörder seines eigenen Geschlechts machen, ihn aller seiner Bundesgenossen berauben und endlich den Dolchen der von ihm gekränkten Menschen überliefern. Es war ein Plan, wie ihn die Mächte der Hölle nicht besser ersinnen konnten, und solche Mächte schlummern in der Menschenbrust, bis irgendeine unbezähmbare Begierde sie wachruft und ans Tageslicht treten lässt.
Sibich versuchte vorerst den verschlagenen Ribestein für sein Vorhaben zu gewinnen. Er wusste, dass sich derselbe mit dem unsichtbaren Gericht, das man Gewissen nennt, glücklich abgefunden hatte, dass er aber der Geldgier und der Wollust dienstbar war. Er gab ihm Gold in Fülle, verschaffte ihm Gelegenheit, seine Gelüste zu befriedigen, und lockte ihn durch glänzende Versprechungen. Ribestein wurde ihm dadurch ein untertäniger Gehilfe und meinte, das Vorhaben seines Gebieters sei leicht auszuführen, weil der Kaiser argwöhnisch, eifersüchtig auf seine Macht und habsüchtig nach anderem Gut geworden sei. Er fügte noch hinzu, er habe sich mit viel Sorge und Mühe die Wappen und Siegel aller Heerfürsten des Reiches angesammelt und könne daher in ihrem Namen Briefe schreiben, wodurch der Kaiser getäuscht werde. Das dünkte dem Marschalk von Nutzen, denn er beschloss, zuerst den ältesten Sohn seines Herrn, den klugen und kühnen Friedrich, durch die Hand seines Vaters zu verderben.
Die beiden Genossen verfassten sofort Briefe vom Herzog von Tuskan, dem Grafen von Ankona, dem Fürsten von Milan und anderen, worin diese den Kaiser vor seinem Sohn warnten, weil derselbe daran denke, seinen Vater der Herrschaft zu berauben und gefangenzunehmen. Er habe bereits, so hieß es in den gefälschten Schriften, viele Burgherren, wie auch die jungen Herlungen zu Breisach, für sich gewonnen, und diese alle würden für den Verräter die Waffen ergreifen, wenn man ihn öffentlich gefangennehmen lasse. Diese Briefe gelangten nacheinander an, alle mit Wappen und Siegel der Fürsten versehen. Der argwöhnische Herrscher zweifelte nicht, war in schwerer Sorge und wusste keinen Rat. „Herr“, sagte der Marschalk, „da hilft kein Erbarmen. Sende den kühnen Verräter alsbald zum König Randolt ins Wilkinenland, dass er den Zins fordere. Gib ihm aber einen Brief mit, worin dem König befohlen wird, er solle den Boten sogleich töten.“ Der ratlose Kaiser handelte nach den Worten des falschen Dieners, und der junge Recke starb also nach dem Willen und auf Befehl des Vaters. Die Tat wurde durch die Verräter selbst als Gerücht verbreitet. Ein Schrei des Entsetzens und der Abscheu gegen den grausamen Herrscher ging durch das ganze Land und machte den Kaiser mehr und mehr verhasst. Auf etwas andere Weise kam Ermenrichs zweiter Sohn Reginbald durch ein morsches Fahrzeug (Schiff) auf einer Fahrt nach England um.
Noch war Randwer, der dritte und letzte Sohn, übrig, ein blühender Jüngling, an dem kein Falsch war. Die mörderischen Ratgeber erregten in dem Kaiser den Verdacht, er habe verbotenen Umgang mit seiner schönen und makellosen Stiefmutter Swanhild, welche der alternde Herrscher noch zu sich auf den Thron erhoben hatte. Als einstmals Ermenrich mit Gefolge von der Jagd heimkehrte, sah er am Saum des Waldes, wie Randwer der edlen Frau einen Blumenstrauß reichte. Nun wurde sein Verdacht zur Gewissheit. Er geriet in eine solche Wut, dass er nicht mehr wusste, was er sprach und tat. Er befahl, Swanhild vor die Pferde zu werfen und den Sohn an den Galgen zu hängen. Die Rosse scheuten vor den sonnenglänzenden Augen der Frau, als aber ihr Angesicht verhüllt wurde, musste sie unter den Hufen der heftig angetriebenen Pferde sterben. Harmvoll saß nun Ermenrich in seinem reichverzierten Gemach und gedachte, wie er bei aller Fülle doch so arm an Freude sei. Da flatterte ein Vogel an sein Fenster, als ob er Einlass begehre. Er öffnete und erkannte an dem roten Halsband Randwers Habicht. Derselbe setzte sich auf ein Gesims und fing an, sich die Federn auszuraufen, die zu den Füßen des Kaisers fielen. Darin erkannte dieser sein eigenes Schicksal, denn er hatte sich ja wie seiner Kinder auch seiner Kraft beraubt. Er sprang auf, sandte Gegenbefehl und gebot, dass man den Sohn eilends vor ihn führen solle. Dann wartete er voller Angst. Endlich brachte man ihn, aber nur seine Leiche. Er war nun in seinem Reichtum ein kinderloser und darum armer Mann. Die ganze Nacht hindurch fand er keine Ruhe auf seinem weichen Lager. Er irrte durch die Prunkgemächer, aber überall sah er das bläuliche Totengesicht seines erwürgten Sohnes und den zertretenen Leib der einst geliebten Swanhild.

„Weißt du, Ribestein“, sagte der Marschalk zu seinem Ratsgenossen, „dass wir ein gutes Stück vorwärtsgekommen sind! Der Kaiser hat keine Freude und keine Erben mehr, als die Herlungen Imbreke und Fritele, die mit ihrem Pfleger Eckehart zu Breisach am Rhein sitzen, und dann den Berner Dietrich. Die beiden sind wie Dietrich die Kinder seiner Brüder. Du bist ein Fremdling in Romaburg, daher will ich dir die Geschichte erzählen: Der Vater Ermenrichs hinterließ außer ihm noch zwei Söhne, nämlich Dietmar, den Vater des Berners, der das Lombardenland erhielt, und Diether, genannt Herlung, dem der Vater noch zu Lebzeiten zwar nur Breisgau am Rhein zuerkannte, aber dazu noch seinen unermeßlichen Schatz roten Goldes. Wenn wir nun die Herlungen und den Berner zu Fall bringen, dann - mach die Augen und Ohren weit auf! - sind wir die Erben.“ Ribestein schnalzte wie ein Fisch, der sich vor Wohlbehagen aus dem Wasser emporschnellt, denn zu solcher Höhe war er mit den Fledermausflügeln seiner Gedanken noch nicht aufgestiegen. Er begriff aber schnell und wusste den richtigen Weg zu finden.
Zunächst wurden die Herlungen verdächtig gemacht. Man überbrachte dem Kaiser Briefe und Urkunden von Imbreke und Fritele, sowie von ihrem Pfleger Eckehart, worin zum Abfall von dem mordsüchtigen Lehnsherrn aufgefordert wurde. In einem solchen Schreiben hieß es: „Zumal unser übler Lehnsherr auch seine eigenen Kinder umgebracht hat, muss er selbst an den höchsten Galgen gehängt werden.“ Dies versetzte den Kaiser in solche Wut, dass er sogleich beschloss, mit Heeresmacht gegen die ungetreuen Neffen vorzurücken. Recken und Dienstmannen wurden aufgeboten, ohne dass man wusste, gegen wen die Heerfahrt gerichtet war. Der Zug ging nach dem Rhein gegen die Treueburg. Sie gehörte den Herlungen, und beide Brüder hatten daselbst ihren Sitz. Zwei Reiter hielten am Fluss Wache, und als sie das Kriegsvolk erblickten, argwöhnten sie einen Überfall, saßen ab und schwammen, die Rosse nachziehend, über das Wasser. Sie riefen die Fürsten, die Wehrmänner zu den Waffen, die Mauern wurden besetzt und die Geschosse aufgestellt. Kaum war die Rüstung hergerichtet, so rückte das feindliche Heer vor die Burg. Imbreke und Fritele waren zwar des Kampfes kundig, aber noch sehr jung an Jahren, und Eckehart, ihr treuer Pfleger, saß unkundig der drohenden Gefahr zu Breisach, wo er mit der Landesverwaltung beschäftigt war. Noch hofften die Herlungen ein gütliches Abkommen, da sie die Banner ihres Onkels erkannten, aber dieser ließ zur Übergabe auffordern, und als die Tore nicht geöffnet wurden, sogleich den Sturm beginnen. Wittich und Heime waren als Lehnsmänner bei diesem Heer, aber sobald sie des Kaisers Absicht erkannten, ritten sie fort nach Breisach zu dem getreuen Eckehart, um ihm die Geschichte zu berichten, und wurden auf dem Weg wieder gute Gesellen.
Der Sturm dauerte indessen den ganzen Tag, und Sibich ließ Brandgeschosse in die Gehöfte schleudern, und wie zu Gerimsheim erzwangen die lodernden Flammen die Übergabe. Ohne die Neffen vor sich zu lassen, befahl Ermenrich, einen Galgen zu errichten und beide Brüder daran aufzuhängen. Das Wort eines ungezügelten Machthabers ist ein scharfes Messer, das den Tod bringt, und so war es auch hier. Darauf nahm der Kaiser ganz Herlungenland in Besitz und ließ eifrig nach dem reichen Schatz forschen, den die ermordeten Fürsten von ihrem Vater ererbt hatten. Man fand ihn nach langem Suchen in einem hohlen Berg. Mit dem Gold belohnte das Oberhaupt seine Dienstleute reichlich und behielt doch noch einen großen Teil für sich. Heime war inzwischen wieder zu dem Heer gekommen. Er wollte dem gekrönten Übeltäter seine Untat vorhalten, ihm die Treue kündigen, als er aber einen reichlichen Anteil an der Beute erhielt, vergaß er sein Vorhaben. Er wurde auch mit Überführung des Schatzes nach Romaburg betraut. Als er dann die Menge roten Goldes und viele Kleinodien vor sich sah, sorgte er dafür, dass nicht alles nach Romaburg, sondern ein reichlicher Teil in des Studas Gehöfte gebracht wurde.

Wiederum fluchte man in allen Landen dem ruchlosen Kaiser, der sein eigenes Geschlecht nicht schonte. Am meisten aber geschah dies in Bern, wohin Eckehart die Botschaft brachte. Dietrich wollte sogleich Buße für die an den Herlungen begangene Übeltat fordern, aber Hildebrand riet ab, indem er an die große Macht des Kaisers erinnerte. Eckehart schwur, er wolle an dem ungetreuen Kaiser Rache nehmen, noch mehr aber an seinen bösen Ratgebern Sibich und Ribestein, die an allen Gräueltaten Schuld trügen. Diese wolle er an den Galgen bringen oder eigenhändig hängen. Dazu drängten auch seine beiden Gesellen, der junge feurige Held Alphart und sein Bruder Sigestab, die den Herlungen wohlbefreundet gewesen waren. Sie forderten augenblicklichen Aufbruch gegen die Mordgesellen und waren entschlossen, auch ohne Kriegsmannschaft nach Romaburg zu fahren und mit Eckehart die Rache zu vollstrecken. Amelolt, ihr Vater, schalt sie Tollköpfe, und da Hildebrand verständig und liebreich zuredete, ließen sie sich den Aufschub endlich gefallen. „Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“, sprach Alphart zu seinem Bruder, indem er an sein Schwert schlug.
„Wieder ein Steinchen aus dem Weg geräumt!“, sagte Sibich zu seinem Gesellen Ribestein: „Nun liegt noch ein Felsen auf unserer Straße, der beiseite zu schaffen ist. Ich meine den Berner mit seinen Kämpfern. Könnten wir seine Gesellen einen nach dem andern für unsere Genossenschaft gewinnen, dann würden wir auch den grimmigen Löwen samt dem Wolf Hildebrand bewältigen. Mit Wittich und Heime ist der Anfang gemacht. Die sind durch den Köder des Goldes und das Versprechen fürstlicher Ehren und Länder ganz zu unserem Dienst. Wir haben noch mehr rotes Gold, Güter und Ehren in der Tasche. So berücken wir die Recken, bis sie, wie die Fische an der Angelrute, in unseren Netzen zappeln.“ - „Mich will bedünken“, antwortete Ribestein, „als sei dies keine leichte Sache. Es gibt Leute, die nicht anbeißen wollen, Dümmlinge mit harten Köpfen. Von dieser Art scheinen mir die Berner Gesellen der Wölflinge und Amelungen zu sein.“ - „Wohl“, schloss der Marschalk, „dann brauchen wir Gewalt. Kein Fels ist so hart, dass ihn nicht der Zwerg mit seinen Geräten aushöhlt. So ist auch kein Schädel so fest, dass ihn nicht das Schwert zerspalte. Dann gibt es auch noch Zankäpfel, die man unter die Narren wirft, und endlich Gift, Dolch und andere Mittel, die ein kluger Mann zu handhaben weiß. Unser Oberhaupt liegt auf der Folterbank und sieht Tag und Nacht seine Neffen am Galgen zappeln. Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen, dass er mit Neid auf die Macht des Berners blickt und fürchtet, der Held könne ihm selbst noch Gefahr bringen. Dann kommen wir Schritt für Schritt weiter.“
Das Werk, welches Sibich so klug in seiner Schmiede geglüht und hergerichtet hatte, gedieh doch nicht nach seinem Wunsch. Denn er wollte langsam voranschreiten, zuerst die kühnen Gesellen des Berners in Ermenrichs Dienst ziehen, dann durch allerlei Trugspiel Dietrich selbst gefangennehmen oder auch meuchlings ermorden. Als er aber am Morgen zu Ermenrich eintrat, war dieser unwirschen Mutes. Er hatte wieder die ganze Nacht mit den Gespenstern der von ihm Ermordeten gekämpft, und wenn er solche Pein erlitt, war er immer sehr zornmütig. Nun redete der Marschalk von dem guten Recht des Kaisers auf das ganze Reich seines Vaters, wie er von allen Ländern Zins erhalte, nur nicht von dem kühnen Berner, der sich sogar mit seinen Gesellen berate, wie er den Mord der Herlungen rächen wolle. Da rief Ermenrich, der Marschalk solle sogleich alle Dienstmannen aufbieten, Söldner anwerben und zur Heerfahrt nach Bern rüsten. Sibich wagte, zum Aufschub zu raten, aber der zornige Herrscher schlug ihn mit der Faust zu Boden und hieß ihn seinen Befehl vollziehen. Der geduldige Hofmann erhob sich wieder demütig vor seinem Herrn, obgleich ihm Blut aus Mund und Nase floss. Er versprach Treue und Gehorsam ohne Einrede, und dies brachte den zornigen Herrscher zur ruhigen Besinnung. Er meinte nun selbst, es sei wohlgetan, wenn man vorerst Schatzung von den Landherren im Amelungenland fordere, und wenn diese verweigert werde, Fehde ansage, und mittlerweile zum Krieg mit aller Macht rüste. Für diesen Zweck wurde Reinhold von Milan (Mailand) in das Amelungenland entsandt, um den Zins zu erheben.
Nach einigen Wochen kehrte der Sendbote mit leeren Händen zurück und berichtete, die Landherren hätten sich der Steuer geweigert, weil sie solche schon an den König von Bern entrichteten. Dann sei Dietrich selbst gekommen und habe ihm gesagt, er solle zu dem Mörder der Herlungen fahren und ihm Botschaft bringen, dass er sich den Zins selber holen möge, wenn er noch nicht genug an dem Herlungengold habe. Der Zins werde ihm dann mit Speerspitzen und scharfen Schwertern bis auf die letzte Mark reichlich bezahlt.
Der Kaiser wurde abermals so zornig, dass er schier den Boten erwürgt hätte. Da trat nun gerade Heime ein, der dem Oberhaupt von dem Abfall des Herzogs von Spoleto berichten wollte. Ermenrich ließ ihn nicht reden, sondern befahl ihm, ohne Aufschub nach Bern zu ziehen und dem Berner anzusagen, er solle entweder Zins zahlen, oder das Land eilig räumen, wenn er nicht am Galgen hängen wolle. Der sonst unverzagte Recke wagte gegen den ergrimmten Oberherrn keinen Widerspruch, obgleich er ungern die Botschaft übernahm.
Heime wurde in Bern wohl aufgenommen, und Dietrich glaubte, er wolle ihm seine Treue beweisen. Als er darauf des Kaisers Forderung ansagte, rief ihm der Berner seinen Eid und die gelobte Treue ins Gedächtnis zurück. Er entschuldigte sich, indem er sagte, er habe ihm für das, was er empfangen hatte, gute Dienste geleistet. Aber nun sei er Lehnsmann des Kaisers, der ihm Geld und Gut zur Miete gegeben habe. Er sei demselben jetzt ehrlichen Dienst schuldig. Damit nahm er seinen Abschied.
Heime war noch nicht lange fortgeritten, da erschien Wittich und jagte durch die Tore von Bern, so schnell Skemming laufen konnte. „Seid wacker und säumt nicht, tapfere Gesellen!“, rief er, ohne vom Ross zu steigen: „Ermenrich ist schon mit unzählbarem Heer auf dem Weg hierher. Ich bin vorausgeritten, euch die Botschaft zu bringen. Der ungetreue Sibich vermeint, euch ungewarnt zu überfallen, und wer dem in die Hände gerät, der hat nicht weit zum Grab.“ Auch ihn erinnerte Dietrich an seine gelobte Treue, aber er entschuldigte sich wie Heime und trabte wieder seines Weges zurück.
Die Nornen (Schicksalsgöttinnen), von denen man damals noch viel zu erzählen wusste, schienen ihre dunklen Gespinste über das Haupt des Berner Helden geworfen zu haben, denn es traf ihn ein Schlag nach dem anderen. Von Wittich eilte er fort zu der kranken Königin Virginal. Er hielt sie die lange Nacht hindurch in den Armen, doch am Morgen verschied sie, und der Schmerz um die teure Lebensgefährtin raubte ihm die Besonnenheit, in der herandringenden Not mit rascher Entschlossenheit zu handeln. Es kam eine schlimme Botschaft nach der andern. Der Kaiser war, wie Wittich gesagt, in schnellem Anzug. Er hatte den Herzog von Spoleto samt seiner unzulänglichen Mannschaft erschlagen, das Land ausgeraubt, desgleichen die Mark Ankona, und stand mit unzählbarem Heer bei Milan (Mailand). Indessen war Meister Hildebrand nicht untätig gewesen. Nach seiner Weisung waren die Landherren und Dienstmannen in Rüstung aus ganz Amelungenland versammelt. Boten waren zu den verbündeten Fürsten in der Nähe und Ferne geritten, und in der Nacht vor dem Tod der Königin rückten Berchtung von Pole (Pula in Istrien) und der treue Heergeselle Dietleib von Steiermark mit zahlreichem Kriegsvolk ein. Am Morgen forderte der alte Meister den König auf, für Hab und Gut, für Land und Leute in den ehrlichen Kampf zu ziehen. Der Held von Bern ermannte sich. Noch einen Kuss drückte er auf den bleichen Mund der geschiedenen Gattin, dann bestieg er Falke und befahl den Aufbruch. Er hatte seine geliebte Frau sterben sehen, nun waren ihm Kampf und Tod willkommen.
Die Fahrt ging eilends nach Milan. Späher verkündigten, das feindliche Heer lagere unbesorgt einige Meilen entfernt auf offenem Feld. Weil der Abend nahe war, wurde der Angriff auf den nächsten Morgen verschoben. Mit Anbruch der Nacht ritt Hildebrand, begleitet von einigen Recken, auf die Spähe. Er fand die kaiserliche Macht ohne Wächter in vermeintlicher Sicherheit gelagert und blieb im Versteck, bis sich das feindliche Kriegsvolk dem Schlaf überlassen hatte. Dann trabte er um das ganze Lager und spähte, wie und wo der Angriff gelingen könne. Nach Mitternacht kehrte er zurück, berief die vornehmsten Recken zur Beratung und sagte ihnen, sie müssten alle zum Sterben bereit sein, denn das feindliche Heer sei dreifach überlegen, und man könne nur hoffen, durch nächtlichen Überfall einen Sieg zu gewinnen. „Wohlan, tapfere Männer!“, rief der Berner: „Wer nicht todesmutig ist, der weiche aus unserem Kreis und spare sein Leben für eine bessere Zeit.“ Nicht einer der Helden entzog sich der Gefahr. Sie gelobten alle, treu zusammenzustehen in Not und Tod. Auch Eckehart sagte, er wolle Leib und Leben gern lassen, wenn er nur Sibich und Ribestein zuvor fangen und aufhängen könne.
Die Hörner weckten die schlummernden Krieger, und bald war das Heer geordnet und unter der Führung des alten Meisters auf dem Marsch. Im ersten Morgengrauen kam man an die feindliche Lagerung, wo das Kriegsvolk noch in tiefem Schlaf ruhte und mancher Held von Siegesbeute träumte. Aber mancher wurde durch Speer und Schwert in den ewigen Schlaf versenkt. Der schallende Kriegsruf „Hie Bern! Hie der rote Löwe!“ schreckte das ganze Lager auf. Die nächsten Haufen suchten sich durch Flucht zu retten, aber die entfernteren wappneten sich und stürmten in den Kampf. Es waren schlachtkundige Männer, um welche sich die Flüchtlinge wieder sammelten, so dass die Berner durch die große Übermacht hart ins Gedränge kamen. Doch Dietrich und seine Gesellen waren nicht so leicht zu bewältigen. Er selbst, der kühne Berner, kämpfte allen voran, und seine Stimme schallte wie der rollende Donner durch die Heerhaufen, die Seinen ermutigend, die Feinde schreckend, und vor dem blitzenden Eckesachs bestand kein Kämpfer. Wolfhart rief: „Da wir doch sterben müssen, so werft die Schilde auf den Rücken und fasst die Schwerter mit beiden Händen!“ Wie er gesprochen, so tat er, und ihm folgten Sigestab und Eckehart. Wittich und Heime stritten zwar ihres alten Ruhmes würdig, aber vermieden ihren vorigen Herrn und wurden endlich in die allgemeine Flucht mit fortgerissen. Meister Hildebrand hatte nämlich mit einem Heerhaufen die Feinde umgangen, und als er ihnen nun in den Rücken fiel, wandte sich die ganze kaiserliche Macht zur Flucht. Fahnen und Banner, Rosse und Rüstungen und achtzehnhundert Gefangene waren die Beute der Sieger. Sibich und Ribestein waren bei guter Zeit auf ihre Sicherheit bedacht gewesen und dadurch dem Schicksal entgangen, das ihnen Eckehart angedroht hatte. Auch Ermenrich entkam der Verfolgung und gelangte in der übelsten Laune zu Romaburg an, wo er mit jenen wieder zusammentraf. Er hatte große Lust, an Eckeharts Stelle die beiden Ratgeber hängen zu lassen, aber Sibich wusste ihn zu beruhigen. Er versicherte, er wolle in wenigen Wochen ein noch zahlreicheres Heer auf die Beine bringen, da die kaiserlichen Schätze und das Herlungengold unerschöpflich seien. Es war dies auch kein eitles Vorgeben, denn zu jener Zeit trieben sich in allen Ländern Tausende von streitbaren Abenteurern umher, die für Geld ihre Haut zu Markte trugen.
Dietrich nahm infolge des Sieges Milan in Besitz. Das war aber auch das einzige Ergebnis der blutigen Schlacht, denn es fehlte an dem, was der Feind im Überfluss hatte, an Geld. Das ausländische Kriegsvolk wurde schwierig und meuterisch, da ihm der Sold nicht gereicht wurde. Des Königs Schatzkammer war aber übel beschaffen, denn sie herbergte wegen Dietrichs Freigebigkeit niemals große Reichtümer und war jetzt durch die nötigen Rüstungen völlig geleert. Der Berner klagte den Gesellen seine Not. Da rief Berchtung von Pole: „Sei guten Mutes, kühner Held! Mit solchem Ballast kann ich ganze Schiffe befrachten! Gib mir Bedeckungsmannschaft mit, dann schaffe ich dir fünfhundert mit Erz, Silber und Gold beladene Lasttiere in kürzester Frist zur Stelle. Du hast oft deinen Schildbrecher gegen die Riesen flammen lassen, die mein Reich bedrängten. Nun ist es mir Wonne, der Not zu Bern abzuhelfen.“ Sofort bestiegen elf tüchtige Gesellen nebst hundert Kriegsknechten ihre Hengste und ritten mit Berchtung nach Pole.
Das Gewerbe wurde gut zu Ende geführt, und fünfhundert Lastrosse trugen den Schatz, behütet von blanken Schwertern gegen Raub. Die Beschützer gönnten sich auf der Fahrt nur kurze Rast, als sie aber an den Gardensee (Gardasee) kamen, wo der Wasserfall rauschte und sich die Sterne in den Fluten spiegelten, meinte Hildebrand, hier in seinem Reich der Wölflinge (Wölfinge) sei kein Raubüberfall mehr zu befürchten, da könnten sie friedlich rasten. Den wegmüden Männern war das eine gute Botschaft. Sie schmausten reichlich von den mitgebrachten Vorräten und sanken bald auf dem weichen Rasen in Schlaf. Hildebrand wollte zwar mit den zehn Recken wachsam bleiben, aber die rauschenden Wellen sangen auch ihnen ein Schlummerlied, dem sie nicht widerstanden. Ehe der Tag graute, wurden sie unsanft geweckt. Wilde Gesichter starrten sie an, starke Hände knebelten sie, als sie schlaftrunken aufzuspringen versuchten. Hohngelächter betäubte sie, vier der Recken, die ihre Schwerter zur Hand hatten und Widerstand versuchten, wurden niedergeschlagen und mit den übrigen samt den beladenen Lasttieren fortgeführt. Der das alles veranstaltete, ritt dem Zug voran, und die Gefangenen erkannten in ihm den ungetreuen Sibich, ihren Todfeind. Der Marschalk, der überall seine Späher hatte, war von der Geldnot in Bern und der Fahrt nach Pole unterrichtet worden. Er hatte sich mit Kriegsvolk am See in Hinterhalt gelegt und den Überfall ausgeführt. So waren die tapfersten Helden der List des tückischen Mannes erlegen.
Nur ein Recke war dem Unglück entronnen, und das war Dietleib, der kühne Held von Steiermark. Er ruhte seitwärts unter dichtem Gebüsch, als der Hinterhalt hervorbrach. Er hieb aufspringend einige Angreifer nieder, bestieg sein Pferd und entrann nach Bern, um die traurige Botschaft zu überbringen. Er fand daselbst große Unruhe, denn Ermenrich war mit Heeresmacht wieder ins Land eingefallen, hatte Milan, Raben (Ravenna) und Mantua eingenommen, während die unbesoldeten Kriegsknechte ihren Dienst verweigerten. Als nun der Steierer seine Botschaft ausrichtete, verließ ein weiterer Teil des Kriegsvolkes die Banner Dietrichs, und viele Kämpfer traten sogar zum Feind über. Die Recken und Kämpfer, welche Treue bewahrten, waren freilich entschlossen, mit ihrem Herrn in den Tod zu gehen, aber die Schar war gering gegen die kaiserliche Macht. Es wurde sofort Botschaft an Ermenrich gesandt, dass der Berner die in der Schlacht gefangenen Kriegsleute gegen Lösung seiner Recken freigeben wolle. Die Antwort war, der Berner möge mit dem Volk verfahren, wie er wolle, die Recken in kaiserlicher Haft würden gehängt. Das war die schlimmste Botschaft, die Dietrich jemals erhalten hatte. Da erhob sich Frau Ute, die hochherzige Ehefrau Hildebrands, begab sich mit anderen Edelfrauen in das feindliche Lager und trat vor Ermenrich. Sie bot für die Lösung der Gefangenen ihr Geschmeide und das aller Frauen und Jungfrauen zu Bern. Doch Ermenrich ging sie hart an: Was sie böte, sagte er, sei ihm schon verfallen. Wolle der König seine Gesellen lösen, dann müsse er mit denselben ohne Rüstung, Waffen und Rosse zu Fuß mit dem Bettelstab in der Hand das Land verlassen. Das ertrug Hildebrands Frau nicht. Sie hatte sich vor dem Thron auf die Knie niedergelassen, doch jetzt erhob sie sich mit den Worten, die Helden würden wie ihre Frauen zu sterben wissen, nicht aber wehrlos am Bettelstab durch das Land wandern! Auf Sibichs Rat gab darauf der Herrscher den Bescheid, der Berner dürfe mit seinen Gesellen und wer ihm noch anhänge, mit Waffen und Rüstung, aber zu Fuß und die Rosse am Zügel geführt, das Land verlassen, sonst würden die Gefangenen ohne Gnade am Galgen erhängt. Das wäre sein letztes Wort, und die Frauen entfernten sich in tiefer Trauer.
Als Dietrich die schlimme Nachricht erhielt, kämpfte er lange mit sich selbst. Er hatte schon oft mit geringer Macht Sieg erlangt, und es war auch jetzt noch möglich, aber sollte er den lieben Meister Hildebrand, den edlen Berchtung, die kühnen Recken Hornboge, Helfrich, Ruotwin, Wolfhart, Wildeber, Eckehart, Alphart und Sigestab dem schmählichen Tod am Galgen preisgeben? Er rang mit sich in schwerem Seelenkampf, und endlich beugte sich sein stolzes Haupt unter der Notwendigkeit: Er gab seine Zustimmung zu dem Vertrag. Die gefangenen Gesellen erhielten Waffen und Hengste zurück und begleiteten ihren Herrn nebst anderen Getreuen, in allem dreiundvierzig Mann, auf dem traurigen Zug. In Bern war viel Weinens um den geliebten König, der selbst sein edles Ross führte und die Verwüstungen sah, welche der Feind bereits angerichtet hatte. In allen Landen aber sprach man mit Betrübnis von der Flucht Dietrichs und seiner Gesellen.
Auch außerhalb des kaiserlichen Gebiets wollten die Helden ihre Hengste nicht besteigen, denn der König, der auf dem Weg über das wilde Gebirge kein Wort sprach, verweigerte es. So zogen die Männer auch durch das schöne Donauland und näherten sich der Burg Bechelaren, wo Markgraf Rüdiger, der Milde und Gütige, seinen Sitz hatte. Frau Gotlinde, die Ehegattin des Markgrafen, stand mit ihrem lieblichen Töchterchen auf dem Söller und sah mit Verwunderung die Recken von ferne, deren Rüstungen in der Sonne glänzten. Sie erkannte auf Dietrichs Schild den rotgoldenen Löwen und auf dem Hildebrands die drei Wölfe, das Wappen der Wölflinge von Garden. Eilends ging sie zu ihrem Eheherrn und sagte ihm, dass der Berner mit seinen Gesellen bei ihnen Einkehr nehmen wolle. Das war eine frohe Botschaft. Beide Ehegatten bestiegen die Rosse und ritten mit Gefolge den werten Gästen entgegen. Als Rüdiger die Helden zu Fuß daher wandern sah, stieg er ab und wollte den Führer als König begrüßen, aber der wehrte ab und sprach: „Du siehst, lieber Rüdiger, einen armen, hilflosen Flüchtling vor dir, der keine Lagerstätte mehr für sein müdes Haupt hat.“ Er sprach nicht weiter, und daher ergriff Hildebrand das Wort und berichtete die ganze Begebenheit. „Wohlan, edler Held von Bern, und ihr, tüchtige Gesellen!“, sagte Rüdiger: „Was mein ist, das ist euer: Gewänder, Rüstzeug, Rosse und Kriegsknechte. Kehrt in mein gastliches Haus ein und nehmt es zur Herberge nach den bestandenen Mühsalen.“
Dietrich folgte mit seinen Gesellen dem Markgrafen und fühlte sich bald heimisch in den Sälen und Gemächern des Burgsitzes zu Bechelaren. Da war keine kaiserliche Pracht wie zu Romaburg, aber alles erschien schmuck, heiter und wohlgeordnet, die Eichentische blank gescheuert und mit Decken belegt, die Wände mit allerlei Bildwerk geschmückt, die Sitze mit Polstern bedeckt. Die Hausfrau lud zum Mahl ein. Das Töchterchen, noch ein Kind an Jahren, füllte die Becher und reichte sie, wenn sie mit dem rosigen Mund genippt hatte, den wegmüden Recken. Rüdiger führte folgenden Tages die Gäste in dem weitläufigen Gehöft herum und gab ihnen, was er verheißen hatte und was sie begehrten, auch achthundert Mark roten Goldes und Miete für die Knechte, die sie sich aus seinen Mannen auswählen mochten. Nachmittags ritt er mit ihnen durch Feld und Flur. Da waren die Äcker wohl bestellt, und das Landvolk grüßte freundlich den wohltätigen Rüdiger und seine Gäste. Man sah keine Spur von Kriegsnot, von feindlichen Riesen und Raubvolk. Wie anders wohnte hier der Frieden mit seinen Segnungen, als in dem verwüsteten Amelungenland! „Das ist eine Stätte des Friedens, der Liebe und Eintracht.“, sagte der Berner: „Könnte ich doch für immer hier Wohnung nehmen und Ermenrich samt seinen ungetreuen Gesellen Sibich und Ribestein vergessen!“ - „Auch unser zertretenes Bern? Und die gelobte Rache?“, rief Wolfhart: „Dann kehre ich allein zurück und führe den Kampf fort, bis ich den letzten Blutstropfen vergossen habe.“ - „Nicht so stürmisch, junger Held!“, versetzte der Markgraf: „König Etzel ist euch für geleistete Dienste Dank schuldig. Ich geleite euch an seinen Hof und bin Bürge, dass er euch mit Heeresmacht Hilfe bringt, damit euch Amelungenland wieder zugewandt wird.“
Über die Herrschaft von König Etzel
Am Abend saßen die Helden zu Bechelaren beim Gelage, der edle Markgraf Rüdiger zur Rechten von Dietrich und Meister Hildebrand zur Linken im Kreis der übrigen Gesellen und Recken. Der goldene Becher ging herum, man erzählte von bestandenen Abenteuern, und nachdem Hildebrand von Kriemhilds Rosengarten und seinem Kampf gegen König Gunther geschwärmt hatte, ergriff Rüdiger das Wort und erzählte eine Geschichte von König Etzel, in dessen Reich er nun glücklich lebte:
Als Etzel das Reich der Hünen mit tapferer Hand gewonnen hatte, war er der mächtigste König in allen Landen. Da gedachte er, noch andere Reiche zu erobern. Er fuhr daher mit unzählbarem Heer aus und rückte bis an die Grenze von Frankenland. In Worms am Rhein traf er auf einen fränkischen König, den man aufgrund seiner Freigebigkeit auch Gibich nannte. Er verfügte zwar über mächtige und berühmte Recken, doch seine Schatzkammer war wegen seiner Großzügigkeit nur mäßig gefüllt, weshalb an kostspielige Kriege nicht zu denken war. So beriet er sich mit den Seinigen und folgte ihrem Rat, dass ein Bündnis mit den Hünen das Beste wäre. Dafür wollten sie reiche Schätze und Königszins zahlen und auch eine Geisel stellen, die als Pfand des Friedens zu Etzel ziehen sollte. König Etzel war mit diesem Friedensvertrag einverstanden, doch forderte er natürlich ein Königskind als Geisel. Weil aber der junge Gunther noch nicht von der Mutterbrust entwöhnt war, übergab man Hagen von Tronje, einen sechsjährigen Knaben aus des Königs Verwandtschaft. Und alle freuten sich, in diesem ungleichen Kampf Land, Leben und Frieden in Burgund am Rhein gerettet zu haben.
Danach zog König Etzel mit seinem Heer weiter ins Frankenland. Sie durchschwammen die Saône und kamen nach Chalon (heute Burgund in Frankreich), wo König Herrich seine feste Burg hatte. Sein einziges Kind war die junge Hildegund, im weiten Reich von Burgund an der Saône das schönste aller Mägdelein, die nach Gotteswillen einst seine Erbin sein sollte. Als die übermächtigen Hünen mit Etzel an der Spitze näherkamen, hatte der König durch Boten bereits erfahren, wie der Frieden im rheinischen Burgund bewahrt wurde, obwohl sie über mächtige und weitberühmte Recken verfügten. Da wollte er kein Narr des Krieges werden, sondern lieber sein einziges Kind als Unterpfand für den Frieden opfern. Barhäuptig und ohne Waffen schickte er seine Gesandten König Etzel entgegen, der sie höflich empfing und sprach: „Mehr als Krieg taugt Bündnis. Auch ich bin ein Mann des Friedens, nur wer sich meiner Macht töricht entgegenstemmt, wird die Leiden des Krieges erfahren. Darum gewähre ich gern die Bitte eures Königs.“ Darauf schritt der König selbst durch das Tor seiner Burg und übergab die vierjährige Königstochter mit reichen Schätzen. So wurde der Frieden beschworen, und er wünschte der schönen Hildegund alles Gute.
Nachdem Vertrag und Treuebündnis geschlossen waren, ging die Heerfahrt von König Etzel weiter nach Westen. Im Land Aquitanien (heute im Südwesten Frankreichs an der Grenze zu Spanien und der Atlantikküste) herrschte König Albhard mit starker Hand, der mit König Herrich gut befreundet war. Sein junger Sohn hieß Walther, und die beiden Könige hatten sich mit Eid geschworen, dass ihre Kinder Hildegund und Walther später heiraten sollten. Als das übermächtige Heer anrückte, kämpfte Alphard mit sich selbst im Herzen, doch folgte er schließlich dem Beispiel der Könige Gibich und Herrich und schickte Gesandte, um den Frieden zu erbitten und dafür seinen fünfjährigen Sohn als Friedenspfand zusammen mit reichen Schätzen anzunehmen.

Walther und Hildegund reiten mit den Hünen in ihr Reich
Froh des Gewinnes kehrte König Etzel mit reicher Beute wieder heim an die Donau. Dort pflegte der König die verpfändeten Knaben, als ob sie seine eigenen Kinder wären, und so auch Königin Helche das Mägdelein. Die Pfleglinge wuchsen unter solcher Obhut trefflich heran. Hagen und Walther wurden in den Künsten von Krieg und Frieden gelehrt, ihr Arm bezwang bald den stärksten Gegner und ihre Klugheit den klügsten Gelehrten. So liebte der König die beiden heranwachsenden Helden sehr und stellte sie bald an die Spitze seiner Heere. Die erblühende Hildegund wurde ein Liebling der Königin, wuchs an Tugend reich und bewies bald so viel Geschick und Treue, dass ihr sogar die Aufsicht über die Schatzkammer der Königsburg anvertraut wurde. Nur wenig fehlte, und sie wäre die Höchste im Reich geworden, denn was sie wünschte, wurde sogleich erfüllt.
Nach einiger Zeit erkrankte und starb Gibich, der großzügige König zu Worms, und sein Sohn Gunther folgte ihm auf den Thron, der im jugendlichen Übermut und Stolz auf seine mächtigen Recken das Bündnis mit den Hünen kündigte und weiteren Königszins verweigerte. Als Hagen davon erfuhr, floh er aus dem Hünenland heimlich zu seinen Landsleuten nach Worms. Andere berichten, dass er mit Geschenken für seine Dienste vom König entlassen wurde. Königin Helche war darüber betrübt und befürchtete, dass auch Walther bald fliehen würde, der mittlerweile der stärkste Held im Reich war. Sie versuchte, den König zu überreden, dass er ihn im Hünenland sesshaft mache und durch Heirat mit einer edlen Hünendame binde. Der König sprach mit dem jungen Walther, doch der wollte sich auf diese Weise nicht binden lassen und antwortete: „Oh König, dies ist eine zu große Würde und Bürde. Werde ich an Frau, Haus und Hof gebunden, kann ich Euch nicht mehr mit ganzer Kraft dienen. Darum bitte ich Euch, mir die Freiheit zu lassen.“ Das gefiel dem König, er war damit zufrieden und wusste nun, dass er Walther niemals verlieren würde.
Bald darauf wurde das Hünenreich von einem feindlichen Volk angegriffen. Der König stellte ein angemessenes Heer zusammen und ernannte Walther zum Heerführer. Dazu verlieh er ihm eine vorzügliche Rüstung, die Wielands Werk gleichkam, und ein Schwert, das Mimung überlegen war. Beide bewährten sich in der wilden Schlacht, so dass der Feind in die Flucht geschlagen wurde und Walther als Sieger mit reicher Beute in den königlichen Palast zurückkehrte. Da wurden Siegesfeste gefeiert, und er selbst diente am letzten Festtag als Wirt, während Hildegund die Becher füllte und den Zechern freundlich reichte. Auf Wunsch des Königs sang sie darauf zur Harfe:
»Von dem Lande tönet, Lieder,
Wo die Treue wohnt,
Wo die Liebe, rein und bieder,
Kühne Recken lohnt.
Heilige Heimat, teure Erde,
Wo mich einst die Mutter lehrte.
Meine Gedanken ziehen fort
Ewig hin nach diesem Ort.
Hören dort den Waldbach rauschen
Unter lebendigem Erlengrün,
Sehen am See die Sterne lauschen,
Wo die süßen Rosen blühn
Und die Lieben einsam weilen,
Freudig jetzt entgegeneilen
In den friedumfangnen Raum;
Ach, es ist ein Traum!
Wüsten, Klüfte, wilde Banden,
Blanker Schwerter Blitz
Trennen grausam die Verbannten
Von der Ahnen hohen Sitz;
Doch die Maid in ihrem Harm,
Sie vertraut dem starken Arm
Eines Helden. Sieh ihr Leid,
Guter Held, und sei bereit!«
Die hünischen Recken und Etzel selbst waren schon trunkenen Mutes und begriffen nicht den Sinn des Liedes. Nur Helche verstand die Jungfrau, und war traurig, dass Hildegund durch die liebevolle Pflege ihr nicht ganz zu eigen geworden war, und beschloss, ihre Fürsorge zu vermehren, aber zugleich ein wachsames Auge auf sie zu richten, damit sie nicht mit Walther entweiche. Denn dieser war nunmehr der tapferste Held im Hünenland, dessen Schwert man ungern entbehrte.
Es war aber noch ein anderer im Saal, der den Gesang gehört und verstanden hatte, und der war eben der junge Walther. Er fand Gelegenheit, sich mit der Sängerin heimlich zu beraten, da er ja wusste, dass sie einander versprochen und auch tief im Herzen in Liebe zugetan waren. „Schlafe nicht diese Nacht!“, sagte er zu ihr: „Schleiche in die dir anvertraute Schatzkammer und nimm aus der siebenten Truhe alles Gold und Silber, so viel du tragen kannst. Es ist der Schatz, den unsere Väter den Hünen zahlten. Fülle das reiche Gut in zwei Kisten und schaffe sie unter die Torhalle. Daselbst findest du mich mit gesattelten Rossen bereit zur Flucht. Wir werden schon weit genug sein, ehe die trunkenen Hünen erwachen.“ So taten die Beiden und entkamen aus dem Palast, da der König niemals die Tore schließen ließ. Als die Morgensonne aufging, verließen sie die vielbefahrene Heerstraße und nahmen ihren Weg durch die wilden Wälder. Nur ungern trieb Hildegund ihr Ross weiter, denn hier war es so schön, der sanfte Wind trug liebliche Düfte heran, die mächtigen Bäume rauschten wie Meereswellen, und die Vöglein sangen fröhliche Lieder. Nur das Heimweh drängte sie weiter. Auch des nachts kehrten sie in keine Herbergen ein, sondern lagerten in Klüften und unter Bäumen. Sie fanden reichlich Nahrung an jagdbarem Wild, Vögeln und Fischen, welche Walther mit Speeren, Netzen und Angeln zu erbeuten wusste.
Spät am Morgen erwachte der König als erster, hielt seinen Kopf und fluchte dem würzigen Wein. Dann ahnte er, was geschehen war, und rief nach Walther, doch die Diener fanden ihn nicht. Bald darauf erschien die Königin und beklagte, dass Hildegund verschwunden war. Da wussten sie, was geschehen war. Der König wurde von Unruhe ergriffen und berief seine Recken, um die beiden zu suchen und zurückzubringen. Doch so viel er auch Gold und Gut bot, keiner war bereit, sich mit Walther im Kampf anzulegen. Da fanden sich König und Königin damit ab, dass nun die beiden ihre eigenen Wege gingen.
Nachdem die Sonne vierzigmal auf- und untergegangen war, kamen die beiden Flüchtlinge bis zum Rhein, nicht weit von Worms entfernt, wo sie einen Fährmann fanden, der sie übersetzte. Walther bezahlte ihn mit den prächtigen Fischen, die er zuletzt in einem Quellteich im tiefen Wald gefangen hatte, aber kehrte nicht in Worms bei König Gunther ein, weil er demselben misstraute. Der Held tat klug daran, dass er sogleich weiter nach Wasgengau eilte, der Heimat zu. Denn als der Fährmann dem König die goldschimmernden Fische brachte, erkannte dieser, dass sie nicht aus dem Rhein, sondern anderwärts herkamen. Er fragte, von wem er sie bekommen hatte, und wie der Mann die Flüchtlinge beschrieb, sagte Hagen, der zugegen war: „Das ist der kühne Walther, mein lieber Heergeselle bei den Hünen, und die schöne Hildegund, die mit ihm aus dem Hünenreich geflohen ist.“ Der Fährmann sprach ferner von zwei schweren Kisten, die nach Gold- und Silbermünzen klangen und die Flüchtlinge mit sich führten. „Vorzüglich!“, rief Gunther: „Das ist die Schatzung, die voreinst mein Vater den Hünen geben musste. Die soll der Held uns erstatten oder das Leben lassen!“ Vergebens riet Hagen ab und erklärte, er werde nicht gegen seinen Heergesellen streiten. Der König ließ sogleich elf mächtige und kampferfahrene Krieger auf die Pferde steigen, setzte Hagen an ihre Spitze und verfolgte mit ihnen die Spur der Entflohenen, wie ein König mit zwölf Jägern ein Wild.
Indessen gelangte Walther mit der geliebten Jungfrau in das Gebirge des Wasgengaues (Vogesen) und zu der höchsten Kuppe, dem Wasgenstein, wo er zwischen zwei Felsen eine Kluft fand, deren Zugang so eng war, dass er Jungfrau, Schatz und Rosse auch ganz allein gegen viele verteidigen konnte. Hier wollte er ausruhen und eine Weile schlafen, da er sich während der Flucht nur selten eines friedlichen Schlafes erfreut hatte. Er bat die Jungfrau mit ihren weitsichtigen Augen, zu wachen und achtzuhaben, ob nicht etwa feindliche Gesellen sie überfallen und berauben wollten. Er hatte noch nicht lange geruht, da sah Hildegund Schilde und Helme blinken. Sie rief den Helden wach und sagte erschrocken, die Hünen seien gekommen, sie wieder in Gefangenschaft zu führen.

„Hier sind keine Hünen“, sagte er, „hier sind die Burgunden vom Rhein.“ Er stand auf und trat gerüstet an den Eingang der Schlucht. Hildegund fürchtete sich vor den vielen blinkenden Lanzen der Angreifer und bat: „Oh mein Held, ich flehe dich an, bevor ich in feindliche Hände falle und mich ein anderer Mann raubt, schlage mir das Haupt ab!“ Doch Walther antwortete: „Fürchte dich nicht! Fern sei es mir, mit schuldlosem Blut mein Schwert zu beflecken. Es hat mir bisher sicher gedient und wird uns auch heute bewahren.“
Als König Gunther mit seinen Recken den Hufspuren gefolgt war und den jungen Helden dort erblickte, sprach Hagen noch einmal: „Das geht nicht gut aus! Zu oft habe ich Walther im Kampf erblickt, wie er manch wackeren Recken ins Grab brachte. Ich weiß, wie gut er Speer und Schwert handhabt, und dazu noch im Schutz dieser Felsenburg.“ Doch der gierige Gunther ließ sich nicht warnen, sondern sprach stolz: „Wahrlich, du redest wie mein Vater! Auch der kämpfte viel lieber mit der Zunge als mit dem Schwert.“ Daraufhin entsandte er einen Recken mit der Forderung, die Schätze und auch die Jungfrau auszuliefern. Walther erbot sich, einen ganz mit Gold und Silber gefüllten Schild zu übergeben, wenn man ihm freie Reise vergönne. Aber der König beharrte auf seiner Forderung, und daher musste der Kampf entscheiden. Doch die Kämpfer konnten nur einzeln in die Kluft hinaufsteigen. Sie griffen mit unterschiedlichen Kampfarten und Waffen an, je nach ihrer Neigung und Fähigkeit, mit Lanzen, Spießen und Speeren, mit Pfeil und Bogen, Schwert, Streitaxt, Enterhaken, Schlinge und Steinen. Doch wie man ein lautes Wort gegen einen mächtigen Felsen ruft und dessen Echo zurückkehrt, so kehrten auch ihre tödlichen Waffen zurück, und dazu gebrauchte Walther noch Speer und Schwert nach hünischer Weise, so dass einer nach dem anderen vor den gierigen Augen des jungen Königs durchbohrt, geköpft oder erschlagen wurde. Sie konnten dann zwar den Enterhaken in Walthers Schild bohren und zogen zu dritt mit aller Kraft am Seil, aber der junge Held stand festverwurzelt wie die Weltenesche. Da ergriff auch König Gunther das Seil, und die Burgunden vom Rhein zerrten, dass ihnen der Schweiß lief, bis sie ihm den Schild entreißen konnten. Doch auch ohne Schild besiegte er die letzten drei Recken, die sich in ihr eigenes Seil verwickelten und auch in die Schlinge, mit der sie ihn binden wollten.
Der starke Hagen stand immer noch seitwärts und kämpfte nicht mit. Zwar zuckte seine Hand nach dem Schwert, als er Freunde und Verwandte unter den Streichen des furchtbaren Helden fallen sah, aber er zog es nicht. Der König befahl ihn darauf selbst in den Kampf, doch er weigerte sich, warf ihm seinen gierigen Übermut vor und riet zum Rückzug. Nun war Gunther angesichts der zehn toten Recken so verzweifelt, dass er seinen Helm abnahm, sich weinend vor Hagen niederkniete und flehentlich bat, ihm zu helfen, weil er lieber sterben als sieglos heimkehren wollte. Das gefiel dem Tronjer Recken, er überlegte und machte den listigen Vorschlag: „Wir sollten uns zum Schein zurückziehen, und am Morgen, sobald die Flüchtlinge ihre Reise fortsetzen, können wir gemeinsam auf offener Heide den kühnen Helden angreifen. Dann kannst du unter meinem Schutz mit dem Schwert kämpfen und deine ganze Macht zeigen. Denn solange Walther seine Felsenburg hat, könnte er wohl allein das ganze Heer der rheinischen Burgunden schlagen.“ Das deuchte dem König wohlgeraten, und er legte sich mit Hagen in den Hinterhalt.
Die beiden Flüchtlinge brachten die Nacht, abwechselnd Wache haltend, ohne Störung zu. Walther hatte keine Angst vor den Burgunden vom Rhein, nur vor Hagen scheute er sich, denn er kannte dessen hinterlistige Macht aus manchem Kampf und fürchtete, er habe sich nur zurückgezogen, um frische Krieger zu holen. Als auch am frühen Morgen kein Feind in Sicht war, schaute sich Walther um und sah die zurückgelassenen Leichen liegen. Er wandte sich ihnen zu, und fügte jedem Rumpf das Haupt wieder an. Danach sank er im Licht der aufsteigenden Sonne knieend zur Erde und betete mit dem blanken Schwert in der Hand:
»Oh Schöpfer dieser Welt, der alles lenkt und richtet,
Nach dessen Gebot sich hienieden alles schlichtet,
Hab Dank, dass ich heute mit deinem Schutz bezwungen
Der ungerechten Feinde Waffengewalt und böse Zungen!
Oh Herr, der du die Sünden austilgst mit starken Armen,
Doch nicht den Sünder selbst - dich fleh' ich um Erbarmen:
Lass diese Toten hier zu deinem Reich eingehen,
Dass ich am Himmelsthron sie möge wiedersehen.«
Dann dachte er über sich nach und beschloss, noch bis morgen in dieser Felsenburg zu warten, damit der König nicht prahlen könne, er sei wie ein feiger Dieb bei Nacht und Nebel aus ihrem Land entflohen. Er legte Rüstung und Waffen ab, stärkte sich am Zuspruch der Jungfrau sowie an Trank und Speise, lagerte sich auf sein Schild und erholte sich im wohlverdienten Schlaf, um für weitere Kämpfe gestärkt zu sein, während Hildegund Wache hielt. Bis weit in die Nacht saß und wachte Hildegund am Haupt ihres Geliebten und verscheuchte mit Gesang den Schlaf von ihren Augen. Dann erwachte Walther mit neuer Kraft, ließ die Jungfrau schlafen, rüstete sich und wachte mit dem Speer in starker Hand. Doch es kam niemand. Die Nacht war verflossen, der Morgen dämmerte, leichter Tau fiel auf Büsche und Blätter, und bald drangen die ersten Sonnenstrahlen durch den Wald. Da ging er zu den Toten, um die sich offenbar niemand mehr kümmern wollte, zog ihnen die Rüstungen aus und begrub sie, so gut er konnte, mit den herumliegenden Steinen. Dann trieb er die übriggebliebenen Rosse der Toten zusammen, belud sie mit Rüstungen, Waffen und sonstiger Beute, und bald verließen sie auf sechs Rossen die sichere Wasgenstein-Burg und ritten mutig hinunter ihres Weges.
Sie waren noch nicht weit gekommen, da wurden sie plötzlich auf offenem Feld von zwei gewappneten Männern angegriffen. Walther erkannte die Wegelagerer. Er dachte nicht an Flucht, sondern schickte Hildegund zum Schutz in ein nahgelegenes Wäldchen, sprang vom Pferd und bereitete sich zum Kampf. Als die beiden näherkamen, fragte er Hagen: „Warum kommst du mir jetzt als Feind entgegen? Waren wir nicht Freunde in Etzels Reich?“ - „Ja“, erwiderte Hagen, „doch nun hast du in meiner Gegenwart Freunde und Verwandte getötet, die Treue gebrochen, und dafür musst du sterben!“ Mit diesen Worten hob er seinen eisernen Speer und schleuderte ihn mit ganzer Kraft gegen Walther, der nicht ausweichen konnte, doch seinen Schild schräg entgegenhielt, womit er ihn ablenkte, so dass er tief in die Erde drang. Daraufhin warf auch König Gunther seinen schweren Eschenspeer, so gut er konnte, aber Walther ließ ihn mit Leichtigkeit am Schild abprallen. Nach diesem unglücklichen Anfang schwangen sich Gunther und Hagen von ihren Rossen und zogen gemeinsam die blanken Schwerter zum Angriff. Sie griffen den jungen Helden von zwei Seiten an, aber er war gewandt, wich aus, sprang bald zur Rechten, bald zur Linken, und zerhieb endlich dem König die Beinrüstung, so dass die Klinge tief bis auf den Schenkelknochen drang. Der König fiel, doch als Walther den Todesstreich tätigen wollte, fuhr Hagen mit seinem Kopf dazwischen, und das Schwert traf funkensprühend seinen Helm. Der Helm hielt stand, aber Walthers Schwert zerbrach daran in zahllose Trümmer, von denen ein scharfer Splitter tief in das rechte Auge von Hagen fuhr. Dieser bäumte sich im Schmerz auf, und schwang halbblind sein Schwert wütend im Kreis. Da war nun Walther einen Moment unachtsam, denn in ihm regte sich der Zorn über sein zertrümmertes Schwert und er überlegte, den goldenen Griff wegzuwerfen. Als er dann seine rechte Hand zum Wurf ausstreckte, wollte es das Schicksal, dass Hagens Schwert mit wütender Kraft den Arm traf und durch die Rüstung hindurch bis auf den Knochen schlug.
So waren die drei Recken kampfunfähig und konnten nichts Besseres tun, als sich vertragen. Denn keiner hatte in diesem Kampf etwas gewonnen, sondern nur verloren: Ohne sein rechtes Bein, konnte König Gunther nicht mehr stehen, ohne sein rechtes Auge, war Hagen halbblind, und ohne seinen rechten Arm, konnte Walther nicht mehr fechten. Nun trat Hildegund hinzu, die bisher ängstlich dem Kampf zugesehen hatte, und verband die Verwundeten. Gemeinsam hoben Walther und Hagen den König auf sein Ross, und die rheinischen Burgunder zogen wieder nach Worms. Walther und Hildegund erreichten ohne weitere Hindernisse das Burgund an der Saône, feierten in Aquitanien ihre Hochzeit, vereinten die beiden Reiche, und nachdem die väterlichen Könige gestorben waren, regierten sie als deren Nachkommen das Volk weitere dreißig glückliche Jahre. Denn Walthers rechter Arm wurde von Hildegund wieder geheilt, die von Königin Helche die Macht der Heilung empfangen hatte, während Gunther bis an sein Lebensende auf dem rechten Bein hinkte und Hagens rechtes Auge blind blieb.
So erzählte der edle Markgraf Rüdiger aus vergangenen Zeiten, wie das Reich von König Etzel gewachsen war und sich verbreitete hatte. Alle hörten aufmerksam zu, und Dietrich tröstet sich, in diesem Reich der Hünen zu sein, wünschte, den ruhmreichen König selbst zu besuchen, und hoffte, hier die nötige Hilfe zu finden, um sein Vaterland wiederzugewinnen.
Frau Sälde und der Wunderer
Groß und weitherrschend war König Etzels Macht, nachdem die Wilkinenmänner überwunden und Osantrix unter Wildebers Schwert gefallen war. Jetzt saß er im reichgeschmückten Königssaal inmitten seiner fürstlichen Helden, und Königin Helche, die treue Gefährtin in seinem vielbewegten Leben, an seiner Seite. Er hatte durch Botschaft alles erfahren, was sich mit seinem hilfreichen Genossen, dem Berner Dietrich, begeben hatte, und erwartete ihn unter Rüdigers Geleit. Er wusste die Macht der Berner Helden wohl zu schätzen, und deswegen empfing er sie mit großen Ehren, als sie reich gerüstet in blanken Rüstungen eintraten. Dietrich erhielt einen Sitz neben der Königin. Was ihn aber am meisten tröstete, war das Versprechen, dass die ganze Macht der Hünen ihm zu Gebote stehen solle, damit er sein geliebtes Bern wiedergewinne. Dies war nach der Flucht der erste Freudenstrahl, der in die Nacht seines Kummers drang.
Die Becher wurden gefüllt und fleißig geleert, die Harfen der Sänger erklangen, die Recken waren frohen Mutes. Da erschien an der Pforte eine Frau in reichem Gewand, das Haupt verschleiert. Sie blickte sich im Saal um und trat alsbald vor König Etzel. Als sie nun den Schleier zurückschlug, erschien keine irdische Frau, sondern eine himmlische Erscheinung, denn ihr holdseliges Angesicht erstrahlte von überirdischem Glanz. „Frau Sälde (die Selige, Beseligende)!“ riefen mehrere Stimmen. Und sie war es, die oft den Helden in ihrer Not erschien und Hilfe brachte. Sie erhob flehend die Hände zum König und bat ihn, ihr einen Helden auszuwählen, der sie gegen ihren Verfolger, den schrecklichen Wunderer, beschütze. Ehe der König antworten konnte, vernahm man grässliches Geheul von Rüden. „Sie kommen!“, rief die Frau: „Verschließt alle Tore! Der Wunderer ist nah!“ Etzel versuchte, sie zu beruhigen und versicherte, in seinem Haus würden die Tore niemals verschlossen, weil Bittende immer Zutritt hätten und kein Feind einzutreten wage. Indessen möge sie unter den anwesenden Recken einen Kämpfer auswählen, der ihren Verfolger bestehen könne. „Ich habe die Gabe, das innerliche Wesen und Denken der Menschen zu erkennen. Da sehe ich nur zwei Männer, die so kühn sind, dass sie vor dem Unhold nicht erschrecken.“ Indem Frau Sälde diese Worte sprach, trat sie zuerst auf Rüdiger zu, aber der weigerte sich höflich, denn es sei im Saal noch ein anderer anwesend, der dazu würdiger und mächtiger ist. Da wandte sie sich an Dietrich.
Während der Berner seine Bereitwilligkeit erklärte und von dem Hochsitz herunterstieg, hörte man bereits das schauerliche Geheul ganz in der Nähe. Gleich darauf stürmte der Wunderer mit seinen Bestien in den Saal, und letztere stürzten sogleich auf die Frau los, wälzten sich aber alsbald, von des Helden Schwertstreichen getroffen, in ihrem Blut. Der Unhold berührte mit dem Scheitel fast das Gewölbe. Sein weites Maul glich einem Löwenrachen und war blutrot, wenn er es aufsperrte und die langen Zähne zeigte. Er führte mit seinem ungeheuren Streitkolben einen Streich nach dem Helden und zerschmetterte eine eherne Säule, als derselbe auswich. Der Kampf war entsetzlich anzusehen, aber endlich gelang es dem König, den Riesen zu fällen. Mit zerspaltener Brust stürzte er brüllend zu Boden und verendete. „Mein Segen ruht auf dir, tapferer Kämpfer“, sagte Frau Sälde: „Du wirst immer siegreich sein, wie schwere Kämpfe du auch noch zu bestehen hast.“ Nachdem sie diese Worte gesprochen hatte, verschwand sie vor allen Augen wie ein Sonnenstrahl, wenn die Königin des Tages niedergeht.
Auf das Toben des Kampfes folgte tiefe Stille. Erst der Schrecken, dann die Freude über den Sieg des unbezwinglichen Helden und das Staunen über das Verschwinden der wunderbaren Frau machte die ganze Versammlung stumm. Nur allmählich erholte man sich und beglückwünschte den Berner, dass er die kühne Tat vollbracht hatte. König Etzel umarmte ihn und versicherte abermals, die ganze Macht der Hünen solle ihm zu Gebote stehen, dass er sein Reich wiedergewinne.
Etzel und Dietrich gegen die Reußen
An die dem Berner verheißene Hilfe war vorerst nicht zu denken, im Gegenteil, der König war niemals des Beistandes bedürftiger als in der nächstfolgenden Zeit. Waldemar nämlich, ein Bruder des erschlagenen Osantrix und Beherrscher aller Reußen, bot seine ganze Macht auf und brachte auch die Wilkinenmänner in Waffen, um mit einem Schlag das Reich der Hünen zu überwältigen. Da bedurfte man der Berner Schwerter, und Dietrich verweigerte sie nicht. Auf seinen Rat kam man dem Feind zuvor und rückte in Reußenland gewaltig ein, ehe noch alle Heerhaufen versammelt waren. Man traf bald auf den übermächtigen Feind, die Heerhörner riefen von beiden Seiten und die Schlacht entbrannte. Waldemar stritt gegen Etzel, brachte ihn nach wütendem Kampf zum Weichen und verfolgte ihn, dass die Hünen bald die Flucht ergriffen. Auf der anderen Seite kämpfte Waldemars Sohn, der auch Dietrich hieß, ein kühner und streitbarer Held, gegen die Berner und die ihnen zugesellten Hünen. Beide Anführer trafen in wildem Getümmel aufeinander. Die Schwerter blitzten, das Blut quoll den Kämpfern unter den Panzerringen hervor, doch gelang es dem Berner, seinen Gegner zu fällen. Der tapfere Jüngling jammerte ihn, und er nahm ihn gefangen. Seiner eigenen Wunden nicht achtend, kämpfte er fort, denn Waldemar war von der Verfolgung zurückgekehrt und die ganze Wucht des Gefechtes ballte sich nun um die Berner und ihre Genossen. Dietrich und seine Gesellen bahnten sich einen blutigen Weg durch die Feinde und erreichten, von der Nacht begünstigt, eine feste Grenzburg. Daselbst nahmen sie Herberge, aber des Morgens erblickten sie schon die Banner der Reußen, die sich auch bald um das Kastell sammelten. Die Belagerten fanden innerhalb der Mauern wenig Vorräte, und daher drohte der Hunger ihr gefährlichster Feind zu werden.
Vergebens blickten die bedrängten Krieger von den Türmen herab nach den Feldzeichen der Hünen, das Häuflein schien gänzlich vergessen. Da entschloss sich der kühne Wolfhart, in einer dunklen Nacht das Belagerungsheer zu durchbrechen, um dem getreuen Rüdiger Nachricht zu bringen. Er zündete mit einem Feuerbrand mehrere Zelte und Baracken an und entkam glücklich, während die Reußen den Brand zu löschen versuchten. Sobald der Markgraf die Botschaft vernommen hatte, sammelte er zahlreiche Heerhaufen und rückte schleunigst zum Kampf heran. Die Reußen, von der langen Belagerung ermüdet, zogen ab, und die Besatzung wurde befreit. Die Helden erreichten mit dem gefangenen Reußen-Dietrich die Etzel-Burg, wo sich indessen der kampfmüde König von den Beschwerden erholt und in Freuden gelebt hatte. Mit großen Ehren empfing er die kühnen Helden und tröstete sich beim festlichen Gelage über den unglücklichen Feldzug.
Er wurde indessen bald aus seinem Freudenleben aufgeschreckt, da Waldemar von neuem im Anzug war, um seinen Sohn zu befreien. Während des Feldzugs entkam der Reußen-Dietrich seiner Haft, aber der Berner, der seiner Wunden wegen zurückgeblieben war, setzte ihm nach. Als der junge Held trotz aller guten Worte nicht umkehren wollte, erschlug er ihn im Kampf. Doch hatte er dabei neue Wunden empfangen, welche ihn ans Schmerzenslager fesselten, und Königin Helche („die Heilende“) bemühte sich wieder um deren Heilung. Der Feldzug lief übrigens noch unglücklicher ab als der vorherige. Selbst Meister Hildebrand wurde von einem tüchtigen Recken vom Pferd geworfen, und nur der unverzagte Markgraf, der ihn mit Schild und Schwert bedeckte, rettete ihm das Leben. Der alte Waffenmeister klagte, als er zu Dietrich kam, mit herben Worten über Etzels Fluchtfertigkeit und meinte, man müsse anderwärts Hilfe suchen als bei diesem Feigling von König. Sobald jedoch der Berner völlig genesen war, mahnte er den König, die erlittene Schmach in Feindesblut abzuwaschen, und nicht vergebens.
Ein allgemeines Aufgebot rief die gesamte Reichsmacht zu den Waffen. An der Spitze eines unzählbaren Heeres, darunter Dietrich selbst, seine Gesellen und Dienstmannen, rückte Etzel in Reußenland ein. Felder und Dörfer wurden eingenommen, doch eine starke Burg leistete beharrlichen Widerstand. Dietrich überließ dem König die Belagerung und rückte weiter vor die Festung Smaland. Daselbst erschien Waldemar mit einem Heer zum Kampf, aber der Berner Held wich nicht, sondern griff mit Hildebrand, Wolfhart und Wildeber an der Spitze die Reußen an. Nach wilder Schlacht gelangten sie tief ins feindliche Heer, wo Wolfhart und Wildeber die Ritter niederkämpften, die das Banner beschützten, und Hildebrand schlug dem Bannerträger die rechte Hand ab, so dass das feindliche Banner fiel. Da erhob sich großes Geschrei und Getümmel, und in dieser Verwirrung gelang es Dietrich, den Reußenkönig vom Ross zu stürzen. So fiel Waldemar in der Schlacht, und sein ganzes Heer wurde zerstreut. Da indessen auch Smaland im Sturm genommen war und sich Herzog Iron, der Burgvogt, mit seinem Gefolge ergeben hatte, so stand das Reußenland den Siegern offen. Das Volk war ohne einen König und deshalb unfähig, dem Sieger zu widerstehen. Es unterwarf sich, entrichtete Schatzung, und Etzel ernannte Herzog Iron zum neuen König der Reußen.

Barfuß und barhäuptig schritt Herzog Iron mit seinen Gesellen aus der Burg
Quelle: Germania's Sagenborn, Engelmann, 1890
Nach der Rückkehr wurde zwar Dietrich hoch geehrt, aber von einem Hilfsheer zu seiner Unterstützung war nicht die Rede. Er drang zwar nicht darauf, doch zeigte seine umwölkte Stirne, dass der Unmut in ihm gärte. Nur wenn Herrat, die schöne Nichte der Königin, ihm zusprach, schwanden die Wolken, und er vergaß einige Augenblicke sein geliebtes Bern. Helche, die kluge und wohlgesinnte Königin, beobachtete alles mit scharfem Blick und sprach einstmals zu ihrem königlichen Eheherrn: „Ich weiß wohl, warum du den kühnen Helden von Bern nicht in sein Land zurückführst. Du möchtest ihn gern bei dir behalten, weil dir sein scharfes Schwert Gewinn bringt. Aber sei achtsam, dass du durch den Verzug den Freund nicht verlierst und dir dafür einen schädlichen Feind erwirbst. Wäre es nicht wohlgetan, wenn wir ihn durch Wohltat als treuen Bundesgenossen erwerben könnten! Ich weiß, dass er meine Nichte Herrat liebt und zu heiraten begehrt, und sie scheint ihm gleichfalls zugetan. Wollen wir ihm nicht die Jungfrau und das Land Siebenbürgen übertragen, das sie nun geerbt hat? Denn ihr Vater Rudolf ist im heldenhaften Kampf gegen die Reußen gefallen.“ Dem König dünkte die Rede heilsam, er sprach darüber mit Dietrich, und Helche mit Herrat, und als von beiden Seiten kein Einwand erhoben wurde, feierte man bald Hochzeit. Wenn jedoch der König dachte, er sei nun der Mahnungen zur Hilfsleistung enthoben, so irrte er sich. Denn die junge Frau war hohen Mutes und begehrte, dass der Held von Bern sein Reich wiedergewinne und sein Schwert nicht nur als Dienstmann für die Hünen ziehe. Helche selbst sprach für die Sache mit ihrem Eheherrn, und da musste dieser endlich seine Zusage zur Ausführung bringen.
Die Raben- oder Ravenschlacht
„Auf nach Bern! Nach Bern! Dietrich zieht nach Bern. Heerfahrt ins Lombarden-Land!“ So scholl es im ganzen Hünenreich. „Hei, wie die Banner flattern, die Helme glänzen!“, rief Wolfhart, als die Heerhaufen unter ihren Führern heranzogen und sich um die Etzel-Burg sammelten. „Die Schwerter rasseln in den Scheiden!“, sagte der junge Alphart, sein Schwert ziehend: „Sie wollen heraus und den Rost mit Blut abwaschen.“ Es zogen heran mit ihren Mannen der Markgraf Rüdiger und sein Sohn Nudung, der unverzagte Dietleib mit seinen Steierern, Helfrich nebst seinem Sohn Ruotwin, auch Blödelin, der Bruder von Etzel, mit vielen hünischen Recken, Iring, der Schnelle aus Danland, der schon lange am Königshof heimisch war, Diepold von Bayern mit seinen Rittern, Tybald von Siebenbürgen, ein Verwandter von Frau Herrat, mit zahlreichen Kriegern, der alte Elsan und viele andere Recken in einem mächtigen Heer.
Schon war der Tag zum Aufbruch bestimmt, da traten Etzels und Helches Söhne Erp und Ortwin, kaum dem Knabenalter entwachsen, früh morgens in das Gemach ihrer Mutter. Die edle Frau umarmte und küsste ihre Lieblinge und hielt sie ängstlich in ihren Armen fest. „Gott Lob“, sagte sie, „dass ich euch wiederhabe. Es erschien mir, und ich weiß nicht, ob es nur ein Traum war: Als ihr in Turnieren und anderer Kurzweil spieltet, da verfinsterte sich der Himmel und ein ungeheurer Greif fasste euch mit seinen Krallen und trug euch durch die Luft auf eine Heide, wo ein grimmiger Lindwurm hervorstürzte und euch zerriss. Grässlich klang euer Klageruf durch die Nacht, und ich konnte euch nicht helfen, nicht erretten. Doch nun behalte ich euch bei mir, und weder Greif noch Lindwurm soll euch schädigen.“ Aber die Söhne waren gekommen, um von der Mutter Abschied zu erbitten, weil sie, wie das ganze Volk, den Helden von Bern sehr liebten und nicht zurückbleiben wollten, während der Kriegsruf durch das Land ging und alle mutigen Herzen in den Kampf begehrten. Die Söhne ließen nicht ab zu bitten, und das Mutterherz widerstand mit Mühe. Helche führte die Kinder zu Etzel, der gleichfalls die Bitte streng zurückwies, doch sich über den Mut der jungen Helden freute. Die Söhne baten endlich, der König möge sie wenigstens die Recken auf der Fahrt begleiten lassen, und sie wollten sich von jedem Gefecht fernhalten. Da trat während dieser Reden der Berner Dietrich ein und versicherte, er werde über die Kinder wachen, und verpfände sein Haupt dafür, dass ihnen kein Schaden geschehe. Nach langem Widerstreben willigten Etzel und auch Helche in das Verlangen ihrer Söhne ein und gaben sie in die Obhut von Dietrich. Die Mutter hatte nur ungern, unter vielen Tränen eingewilligt. Sie hielt die Kinder beim Abschied so fest in den Armen, als wolle sie sich niemals von ihnen scheiden. Und als sich die jungen Recken von ihr losrissen und auf ihren schnellen Rossen grüßend fortjagten, weinte sie, als habe sie die Lieben schon verloren.
Die Heerfahrt ging eilends über das Gebirge hinunter in die schöne Ebene des Lombarden-Landes. Am Gardasee verbündete sich Hildebrand wieder mit den anderen Wölflingen und nahm seine Burg in Besitz. Doch konnte der alte Meister nicht allzu lange verweilen, um Frau Ute und seinen Sohn Hadubrand zu sehen, die bei Verwandten in den Bergen waren, denn das Hauptheer rückte unaufhaltsam nach Bern. Man kam zuerst nach Padauwe (Padua), das von Ermenrichs Recken besetzt und verteidigt war. Da stand auf der Zinne Herr Rumolt, der tüchtige Stadthauptmann, der dem Markgrafen Rüdiger höhnend zurief, er möge doch über die Mauer klettern und sich die Schlüssel zu den Toren holen. Daraufhin forderte ihn der Markgraf zornig zum Kampf auf offenem Feld. Der Hauptmann weigerte sich nicht und ritt mit dreißig Recken, nachdem Sicherheit verbürgt wurde, aus der Stadt, und sein Gegner erschien mit einer gleichen Zahl, denn so forderte es damals die ritterliche Ehre. Beide Helden kämpften mit Speer und Schwert, ohne dass einer den anderen überwältigen konnte. Man trug sie beide, aus schweren Wunden blutend, von der Walstatt. Dagegen wurden die Recken Rumolts teils niedergeworfen, teils schimpflich in die Stadt zurückgejagt. Indessen misslang der Angriff auf die festen Mauern, und das Heer zog weiter nach Bern, denn es war Nachricht gekommen, die Burgmannen hätten die Besatzung Ermenrichs ausgetrieben und erwarteten ihren alten Herrn mit Freuden.
Nun endlich war das Ziel erreicht. Der Held zog nach langen Mühsalen in die festlich geschmückte Stadt unter dem Jubel der treuen Burgleute ein. Doch war ihm nicht lange Ruhe vergönnt, denn schon nach wenigen Tagen kam in vollem Galopp der Recke Albert, ein Sendbote des wohlgesinnten Herzogs Friedrich von Raben (Ravenna), und brachte die Botschaft, Kaiser Ermenrich lagere mit unübersehbarem Heer bei der Stadt und erwarte immer noch mehr Hilfsvölker. Man müsse daher ohne Säumnis zum Angriff schreiten. Der Berner zögerte nun nicht länger mit dem Aufbruch, und man kam unaufgehalten in die Nähe des Feindes. Das Lager wurde aufgeschlagen, und Dietrich entsandte Späher, um von der Stellung des kaiserlichen Heeres Kunde zu bringen. Nur wenige kehrten mit blutenden Wunden zurück. Sie berichteten, dass überall in Busch und Strauch feindliches Volk lauere, so dass keine Erkundung möglich sei. Als darauf der Berner seine Helden fragte, wer die Wache dem Feind am nächsten übernehmen wolle, erhob sich der junge Alphart. Umsonst suchte man den kühnen Helden zurückzuhalten, er beharrte auf seinem Vorhaben.
Der unverzagte Held ritt getrosten Mutes nach der gefährlichen Warte. Da schwirrten plötzlich von allen Seiten Speere und Pfeile und klirrten auf Helm und Schild, aber sie bissen nicht ein, denn seine Rüstung war Zwergenwerk. Wie er sich zornig nach den Männern umsah, die solche unliebsamen Grüße sandten, sprangen die Gesellen aus dem Dickicht hervor und umringten ihn in großer Menge. Der Führer derselben ritt auf ihn zu und forderte ihn auf, sich zu ergeben. „Ich bin Herzog Wölfling!“, sagte er: „Du kannst mir ohne Schimpf und Schande dein Schwert reichen. Du scheinst ein tüchtiger Recke, und ich werde dich bis zur Auslösung wohlhalten.“ - „Bist du Herzog Wölfling, der Abtrünnige unseres Geschlechts“, rief der Held, „so sollst du hier von meinen Händen den Verräterlohn empfangen.“ Der Kampf der beiden Männer währte nicht lange. Alphart spaltete den Gegner mit einem furchtbaren Streich von der Schulter bis auf den Gürtel. Um ihren Herrn zu rächen, stürmten die übrigen Krieger in dichtem Gedränge auf den Helden ein, aber er war wie das Wildfeuer bald da, bald dort, und jeder seiner Streiche war ein Todesstreich, während kein Ring an seiner Rüstung zerriss, keine Feder aus seinem Helm zerknickt wurde. Die Leichen häuften sich, und als über die Hälfte der Mannschaft gefallen war, suchten die übrigen ihr Heil in der Flucht, doch erlag noch mancher dem tödlichen Schwert des Verfolgers, der ihnen fast bis an das feindliche Lager nachjagte.
„Ein Geist aus der Hölle hat unseren Herzog erschlagen!“, riefen die erschrockenen Kriegsleute: „Mehr als fünfzig von uns sind gleichfalls unter seinem höllischen Schwert gefallen, und wir sind ihm kaum entronnen.“ Mit Staunen vernahm man in Ermenrichs Lager die seltsame Geschichte. Einige mutige Recken jagten nach der Höhe, wo man den einsamen Krieger auf seinem Hengst erblickte. Aber auch sie fielen entweder auf der Walstatt oder kehrten, aus tiefen Wunden blutend, zurück und bestätigten die Aussage von einem grausigen Dämon, der wohl bald in das Lager einbrechen und das ganze Heer mit Stumpf und Stiel vertilgen werde. „Der Berner ist ein Sohn des Teufels“, meinten andere, „und dieser wird wohl seinem Sprössling zu Hilfe gekommen sein. Mit dem kann kein sterblicher Mensch fechten.“ - „Ich will doch zusehen, ob er nicht von Fleisch und Blut ist“, rief der starke Wittich, „wenn auch die ganze Hölle dort aufgestellt ist, so muss ich einen Gang mit ihr versuchen.“ Er wappnete sich eilends, ergriff ein Schwert, gewahrte aber in der Eile nicht, dass es ein anderes als Mimung war. Heime, der wieder mit ihm in Eintracht war, weil er ihn kurz vorher aus großer Gefahr gerettet hatte, erbot sich, ihn zu begleiten und zu rächen, wenn er fallen sollte. Beide Männer ritten sofort eiligst nach der Warte, wo Alphart, seiner Taten froh, unter einem Baum ruhte, während sein Hengst im saftigen Gras weidete.
Er erkannte sie schon von ferne an ihrem Schildzeichen. „Zwei ungetreue Gesellen!“, rief Alphart ihnen entgegen: „Nun sollt ihr wie Wölfling für die Untreue an eurem Herrn büßen.“ Schon saß er auf seinem Ross und ritt gegen Wittich, der ihm mit vorgestreckter Lanze begegnete. Sie stießen mit den Lanzen kräftig aufeinander, und der starke Wittich musste den Sattel räumen. Sogleich springt der siegreiche Held vom Ross, schwingt das Schwert über dem Haupt des Gefallenen, doch kann den Todesstreich nicht ausführen. Den Wehrlosen zu töten, scheint ihm ein Flecken auf seinem makellosen Schild. Schon ist der kühne Recke wieder aufgesprungen, um mit dem Schwert den Schimpf zu rächen. Die Klingen blitzen im Entscheidungskampf, aber Wittich erkennt nun, dass er Mimung nicht in der Hand hat und seine Streiche nicht wie sonst Schild und Helm spalten. Endlich trifft ihn ein furchtbarer Schlag auf das Haupt, dass er zum zweiten Mal zu Boden taumelt. In seiner Not ruft der gefallene Held seinen Gesellen um Hilfe an, und als dieser zögert, weil es Unehre sei, dass zwei Recken einen einzelnen angreifen, und er Rache, aber nicht Hilfe verheißt, windet sich Wittich unter dem Fuß des Siegers wie ein getretener Wurm und versucht herauszukommen. „Ergib dich, ungetreuer Hund!“, schreit Alphart: „Oder ich haue dir das Haupt ab und hänge es an den Galgen!“ Da blieb Heime nicht länger müßig und deckte seinen Gesellen mit dem Schild, so dass er sich erheben konnte, und beide Recken bekämpften nun den jungen Helden.
Alphart war ebenso gewandt zu Fuß wie stark mit der Hand. Er brachte auch Heime zu Fall, aber da kam Wittich zu Hilfe, und in dieser Weise währte der Kampf lange fort. Die drei Recken bluteten schon aus mehreren Wunden, doch dann ermüdete Alphart, weil gegen Heimes Nagelring seine starke Rüstung nicht immer Schutz gewährte. Ein mit beiden Händen geführter Streich drang ihm durch die Rüstungshosen in den Schenkel und machte ihn fast wehrlos. Noch einige Zeit erwehrte er sich seiner Gegner, doch musste er endlich unterliegen. „Ungetreue Verräter!“, rief er sterbend: „Ihr werdet den Fluch ehrloser Taten mit in die Grube nehmen.“

Alphart wird von Wittich und Heime überfallen
Die Sieger verließen schweigend den Kampfplatz und rühmten sich nicht ihres Sieges. Aber ihre Rüstungen waren blutig, und sie waren verwundet. Da sprachen die Kriegsleute untereinander: „Sie haben mit dem Höllengeist gekämpft, den grausigen Spuk erschlagen. Es sind schreckliche Dinge geschehen.“
In Dietrichs Lager erfuhr man bald die Botschaft von Alpharts Tod, und es entstand große Trauer um den kühnen Helden. Der Berner berief darauf eine Heerversammlung und sprach zu den Recken, welche ihn im Kreis umstanden: „Tüchtige Helden, es ist nicht an der Zeit, Wehklage zu halten um einen Mann, der nach tapferem Kampf gefallen ist. In dieser Schlacht werden noch viele Helden den Tod erleiden. Wer für unsere gerechte Sache unverzagt als tapferer Recke kämpft, der wird, mag er siegen oder fallen, von den Sängern gepriesen werden. Sollen wir aber sieglos sein, dann kehre ich nimmer von der Walstatt zurück, sondern liege erschlagen unter meinen Gesellen, dessen bin ich gewiss. Wer nun sein Leben retten will, der wende sich nach Bern. Dort in der werten Burg habe ich den starken Elsan als Hauptmann bestellt, dass er sie treu bewahre, bis Etzel mit seinem Hünenheer erscheint und die Feinde zum Rückzug drängt, falls wir alle fallen. Dem kühnen Elsan habe ich auch des Königs Söhne Erp und Ortwin anvertraut und ihm befohlen, bei Gefahr seines Hauptes sie treulich zu behüten, wie ich mich selbst für die jungen Königssöhne bei Etzel verbürgt habe. Wer nun aus dem Schlachtgetümmel entrinnt, der helfe, die Kinder zu schirmen, die mir werter sind als Reich und Leben. Nun stärkt euch alle mit Speise und Trank und genießt der Ruhe! Meister Hildebrand wird mit seinen Männern der Wache pflegen.“
Meister Hildebrand war ein treuer Wächter, aber durchspähte auch die Gegend und die Lagerung des Feindes, wie er immer zu tun pflegte. Indessen erhob sich ein dichter Nebel, der das Mondlicht verbarg und die Ausspähung verhinderte. Bald hörte der alte Meister Hufschlag. Er und seine Begleiter zogen die Schwerter, und schon wollten sie die entgegenkommende Schar angreifen, da blickte der helle Mond durch die zerrissene Nebelschicht und sie erkannten Reinhold von Milan, der zwar ein Mann Ermenrichs, aber ihnen befreundet war. Die Schwerter rasselten zurück in die Scheiden, und sie begrüßten sich herzlich. Als Hildebrand nach der Lagerung fragte, erwiderte der fremde Recke: „Wenn ich dem Berner in Treue raten sollte, so zöge er wohl ohne Kampf wieder zu den Hünen, wo er gutes Gemach hat. Denn das Heer des Kaisers ist gar übermächtig. Seht dort, wo die fünf Goldknäufe im Mondlicht glänzen, ist Sibichs Zelt.“ - „Sibich!“, rief Eckehart, der Herlungen Trost, „den fange ich lebendig und bringe ihn an den Galgen.“ - „Er hat die kühnsten Recken um sich“, fuhr der Mann Ermenrichs fort, „und ist oberster Feldhauptmann, weil Wittich und Heime nicht gegen Dietrich vorankämpfen wollten. Seht weiter: Jenes weiße Banner mit dem goldenen Löwen weht über dem gewaltigen König von Danland und seinen zwölftausend Gewappneten. Neben ihm lagert der mächtige Stacher, dann Düring von Hessen, und weiter lagern noch unzählbare Scharen, von streitbaren Recken geführt, die man jetzt bei Mondschein nicht unterscheiden kann. Darum dünkt es mir klüglich, wenn ihr zum Hünenkönig zurückkehrt.“ - „Wir haben drei Bundesgenossen: das Recht, die Treue und den Reckenmut, die wanken nicht und helfen Siegesehre gewinnen.“ Mit diesen Worten nahm Hildebrand Abschied von dem Recken und ritt weiter seines Weges. Er spähte aber sorglich umher und fand einen Pfad, auf welchem er, durch Waldung gedeckt, in den Rücken des kaiserlichen Heeres gelangen konnte. Als er wieder in das Lager kam, redete er mit Dietrich, wie er nach Mitternacht drei Heerhaufen in die erspähte Gegend führen und mit Tagesanbruch in das feindliche Lager einfallen wolle. Wenn der König seine Hörner vernehme, so solle er von vorn einbrechen.
Der Schrecken war groß, als der alte Meister an der Spitze auserwählter Scharen den ersten Angriff tat. Viele Männer wurden im Schlaf erschlagen, andere flohen. Die kühnen Recken drangen bis zu Sibichs Zelt vor. Indessen ermannten sich Ermenrichs Recken, der Kampf wurde mörderisch, und der Meister kam ins Gedränge. Er ließ sofort die Hörner schmettern und hörte alsbald die gleichen Klänge und den Schlachtruf des Königs. Ungeachtet der Verwirrung, welche der doppelte Angriff im kaiserlichen Heer verursachte, ordneten sich doch die zahllosen Heerhaufen unter ihren schlachtgewohnten Führern. Es war ein entsetzliches Gemetzel, Leichen wurden über Leichen gehäuft, tapfere, nie besiegte Helden sanken in wildem Getümmel und auch eine zahllose Menge des Kriegsvolkes.
„Hie Bern! - Hie Romaburg!“ gellte
Der Ruf durch Tälergebreit;
Die Recken auf blut'gem Felde,
Sie stürmen in den Streit.
Der Tod, gebreitet die Arme,
Auf seinem Throne sitzt,
Von hellem Schmuck und Juwelen
Das dunkle Haupt umblitzt.
Sein Schmuck sind blinkende Schwerter,
Juwelen Geschoß und Speer;
Damit den Recken verwehret er
Die süße Wiederkehr
Zur Heimat. Enger und enger
Umschlingen sich grausig die Reih'n;
Ob Freund', ob Feinde, sie müssen
Im Grabe beisammen sein.
Die Blumen der Heide trinken
Begierig blutigen Tau,
Davon ihre Augen blinken,
Die sonst vom Staube grau.
Sie haben gefallenen Recken
Den blühenden Kranz gereicht,
Auf die kein Auge mit Tränen
Sich trauernd niederneigt.
Sie mögen nicht unterscheiden,
Ob ihn das hünische Land,
Ob ihn, den freundlich sie kleiden,
Hat Romaburg entsandt.
Ob er, vom blinkenden Schwerte
Die Stirne gespalten, sank,
Ob eine Schlange, vom Bogen
Geschnellt, sein Herzblut trank.
Die Scharen der kühnen Leute
Zerrinnen wie Frühlingsschnee.
„Ha, traun!“, spricht Mancher, „heute
Tut mir der Harnisch weh;
Den haben beschwingte Schlangen
Zerbissen mit scharfem Zahn;
Will zu dem Busche dort wanken,
Ob ich dort genesen kann.
Voran mit seinem Schlachthaufen stürmte der mächtige Stacher gegen die Krieger von Bern. Er warf Recken und Mannen nieder, bis er auf Wolfhart traf, der Dietrichs Banner führte. Auch ihn streckte ein Speerstoß des gewaltigen Helden in den Staub, und mit ihm sank die Fahne von Bern. Als der König das Feldzeichen nicht mehr erblickte, brach er sich mit siegender Gewalt einen Weg durch die Menge. Er schwang Eckesachs, und Stacher sank, das Haupt gespalten, vom Hengst. Nun flatterte das Banner wieder hoch, rot von Blut, in des Herrn Hand. Stachers Mannen wollten ihren Führer rächen oder mit ihm in den Tod gehen, und ihrer Tausende fielen unter den Streichen Dietrich's und seiner Gesellen. Das sah der kühne König von Danland, warf sich dem Anstürmenden entgegen, aber seine Lanze zerbrach an der Rüstung des Königs in Stücke, und Eckesachs spaltete ihm Schild, Hüfte und Leib. Ein anderer Kämpfer, der starke Morung, drang nun von der rechten, Morolt von Eyerland von der linken Seite vor. Ersterer wurde von Helfrich gefällt, und dem zweiten gab der Berner den Tod.
In einer anderen Gegend des weiten Schlachtfeldes kämpfte Wildeber schäumend vor Kriegsmut, gleich dem Wild, von dem er den Namen trägt. Als Düring von Hessen die Niederlage der Männer von Romaburg erblickte, begegnete er dem wütenden Recken und stieß ihm den Bannerschaft durch Brünne und Brust, dass die Spitze zwischen den Schultern herausragte. Doch wie er an ihm vorüberjagte, traf ihn der Sterbende mit letzter Kraft, und auch er musste den Sattel räumen.
Wittich hatte nun wieder Mimung in der starken Faust, und weder Recken noch Mannen konnten vor ihm bestehen. Ganze Scharen wichen zurück, während er Tod und Niederlage verbreitete. Dietleib, der nie besiegte Held von Steiermark, tritt ihm entgegen, sank aber nach verzweifeltem Kampf zu Boden. Indessen bestanden Ermenrichs Heerhaufen nicht länger in dem blutigen Streit, sie wichen mehr und mehr vor dem siegreichen König und seinen Helden. Da sah Wittich auch den ungetreuen Ribestein unter den Flüchtlingen und wie ihn der getreue Eckehart grimmig verfolgte, ihn erreichte, ihm das Haupt abschlug und den blutigen Rumpf zu sich auf sein Ross schwang. „Hab' ihn!“, rief der Held: „Ich hänge ihn nun, wie gelobt, an den Galgen. Er ist der Henker der Herlungen und schuld an diesem Blutbad.“ Die Flucht der Mannen Ermenrichs wurde nun allgemein, verfolgt von Blödelin und seinem Heer.
Doch der kühne Wittich wollte nicht fliehen, sondern brach sich, Flüchtlinge und Verfolger niederwerfend, den Weg nach einer Anhöhe, wo er weit umherschauen konnte. Er erkannte jetzt, dass es dieselbe Warte war, welche Alphart, der junge Held, so mutig verteidigt hatte. „Wie, wenn hier ein Rächer für den erschlagenen Helden aufstände?!“ So dachte er, und der unehrliche Kampf von zwei gegen einen trat ihm vor die Seele. Was er gedacht hatte, schien nun Wirklichkeit zu werden, denn Herzog Nudung, der Sohn des Markgrafen Rüdiger, griff ihn unversehens an und warf ihm seine Untreue vor. Der Kampf war heftig, aber entscheidend: Nudung stürzte aus vielen Wunden blutend vom Hengst unter die Blumen der Heide. Der Sieger freute sich nicht seiner Tat, denn Rüdiger, den Freund aller Menschen, hatte er nicht schädigen wollen. Er freute sich nur, dass seine Ahnung von einem Rächer nicht in Erfüllung gegangen war. Während er auf den Gipfel der Warte stand, sah er zwei junge Männer in glänzenden Rüstungen die Anhöhe heraufreiten. Sie waren in erster, blühender Jugend, und der Held erkannte an ihnen das Schildzeichen der Hünen.
Tod der Söhne Etzels
Das hatte sich folgendermaßen begeben: Erp und Ortwin, die Söhne Etzels, waren zu Bern unter der Hut des alten und kriegserfahrenen Elsan zurückgeblieben. Sie verhielten sich manchen Tag ruhig, denn der Alte hatte sein Haupt für ihre Sicherheit verpfändet. Ihr angeborener Mut sträubte sich aber gegen diese Abgeschlossenheit. Sie sehnten sich ins Freie und begehrten, den Kampf der Helden zu schauen, ja selbst mit Speer und Schwert in die Schlachtreihen einzutreten. Am dritten Tag ertrugen sie die Gefangenschaft nicht mehr und baten Elsan beharrlich, er möge ihnen nur einen Ritt in der Umgegend gestatten. Der weichmütige Alte gab seine Zustimmung, doch wollte er sie selbst begleiten. Während er sich noch wappnete, jagten die jugendlichen Gesellen schon durch das offene Tor und fröhlichen Mutes weiter auf unbekannten Wegen. Als sie endlich haltmachten, um ihre Rosse verschnaufen zu lassen, gedachten sie des gutmütigen Elsan, der um sie wohl recht in Kummer war. Sie wollten zurückreiten, aber da waren verschiedene Wege, und ein dichter Nebel verhüllte die Gegend. Sie ritten in Sorgen weiter und weiter, der Nebel verzog sich, aber das Land umher war ihnen gänzlich unbekannt. Sie gelangten endlich in die Nähe der verhängnisvollen Warte und sahen dort einen Recken in glänzender Rüstung. Sie lenkten auf ihn zu. Da lag unter Heideblumen ein Erschlagener, dem das Blut noch aus den klaffenden Wunden floss. Sie sprangen ab. „Es ist Nudung, der Sohn des guten Markgrafen“, rief Erp. „Und der Unhold dort auf der Höhe hat ihn ermordet!“, sagte Ortwin mit Zorn: „Ich erkenne das Schildzeichen von Hammer, Zange und Amboss des ungetreuen Wittich, von dem wir gehört haben. Er soll nicht lebendig aus unseren Händen entkommen!“ Die jungen Helden sprangen auf ihre Hengste und jagten nach der Anhöhe. Ortwin hatte ein schnelleres Ross und kam als erster an. „Falscher, ungetreuer Hund!“, rief er dem Recken zu, als er ihn erreichte: „Du musst hier von meinen Händen sterben.“ Wittich erwiderte vergebens, er solle ablassen, er begehre nicht eines Knaben Blut. Der junge Held wurde nur noch mehr ergrimmt. Seine Streiche fielen wie Hagelkörner, und einer drang dem Gegner durch eine Fuge der Rüstung, dass Blut die Ringe färbte. Nun schonte der starke Wittich nicht mehr, und da sank der mutige Ortwin bis auf den Gürtel zerhauen vom Ross. Ein gleiches Schicksal hatte Erp, der den Bruder rächen wollte. „Hab Dank, Vater Wieland!“, sagte Wittich vor sich hin: „Dank für die festen Waffen, Vater! Nun brauche ich den Rächer nicht mehr zu scheuen, denn Mimung widersteht keiner, und wäre es auch König Dietrich.“ Siegesgewiss rief er laut: „Wer wagt es, die Gefallenen zu rächen!“ - „Rächen!“, wiederholte das Echo in den Bergen dreimal. Es kam ihm vor, als hätten die drei Leichen das schlimme Wort gesprochen. Ein Schauer rieselte ihm durch alle Glieder.

Wittich gab Skemming die Sporen und jagte fort, er wusste nicht wohin. König Dietrich rastete auf dem Schlachtfeld mit seinen Gesellen und anderen Recken, so viele das Schwert verschont hatte. Er war nicht froh des ruhmvollen Sieges, denn Dietleib, Wildeber und Alphart lagen erschlagen, Wolfhart und Rüdiger waren schwer verwundet. Vom tapferen Nudung war keine Spur zu entdecken. Die Krieger teilten die reiche Beute, verbanden und pflegten die Verwundeten, Freunde und Feinde. Wer einen guten Gesellen unter den Toten fand, der bereitete ihm ein Grab, denn alle Leichen zu bestatten war wegen der unzählbaren Menge nicht möglich. An einem eilends aufgerichteten Galgen baumelte der kopflose Rumpf des ungetreuen Ribestein, und Eckehart, der Herlungen Trost, stand lachend davor. „Den falschen Sibich“, sagte er, „den fange ich mir lebendig in Raben, wohin er entronnen ist! Er soll neben seinem Gesellen das hänfene Halsband tragen.“
Man fand in Ermenrichs Lager große Vorräte an Speise und Wein, und die Krieger hielten flotte Tafel. Der Sorgenbrecher verscheuchte bald alle Trauer aus den Herzen. Auch Dietrich vergaß seinen Kummer und stimmte in den allgemeinen Jubel ein. Da jagte ein Mann in vollem Rosslauf über die Walstatt, und man konnte nicht zweifeln, es war Elsan, der Hüter von Bern. Er stieg vom Pferd, nahte sich mit bekümmerter Miene dem König und sprach: „Herr, hier bringe ich dir mein Haupt, wenn den jungen Herren ein Leid widerfahren ist. Sie sind mir aus den Händen entronnen.“ Dietrich starrte ihn finster an, und er berichtete, was sich begeben hatte, soweit er es wusste. „Nun, alter Freund“, antwortete der König, „sei getrost, die jungen Recken haben sich zwischen den weiten Gärten um Bern verirrt. Sie werden schon wieder in der Stadt sein.“ Doch kaum hatte er die Worte gesprochen, erschien ein anderer Bote, bleich und von Schrecken entstellt. „Herr“, sagte er zitternd, „zürne mir nicht - die Söhne Etzels und Herzog Nudung wurden dort auf der Warte erschlagen.“ Dietrich erhob sich, zog das Schwert zur Hälfte und stieß es wieder in die Scheide. „Du lügst!“, donnerte er den Unglücksboten an, „und die Lüge kostet dich den Kopf! Doch hast du wahr gesprochen, dann wird mir ein barmherziger Mensch das Schwert durch den Leib stoßen. Auf, nach der Warte!“
Schon jagte der Held auf Falkes Rücken dahin, dass die Recken ihm nicht folgen konnten. Bald sah er mit eigenen Augen, was geschehen war. Eine mitleidige Hand hatte die drei Leichen nebeneinander in die Blumen der Heide gebettet, und die gebrochenen Augen öffneten sich nicht mehr, dem Freund ins Angesicht zu schauen. Der königliche Held kniete neben ihnen, küsste den bleichen Mund eines jeden der früh gefällten Helden, und flehte die umherstehenden Recken an, ihm aus Barmherzigkeit das Leben zu nehmen. Dann sank er auf sein Angesicht und verharrte schweigend. Als er sich wieder erhob, blutete seine rechte Hand, denn er hatte sich ein Fingerglied abgebissen. Und wieder neigte er sich zu den teuren Leichen nieder. Dann sprang er plötzlich empor und schrie: „Rache! Die klaffenden Wunden, die Streiche durch Schild, Rüstung und Brust hat Wittich mit dem scharfen Mimung getan. Auf! Ich suche ihn bis ans Ende der Welt!“ Er blickte wild umher, und siehe, auf der jenseitigen Höhe trabten zwei Reiter daher und der Abendsonnenschein beleuchtete auf dem Schild des einen Recken Hammer, Zange und Ambos. Es war Wittich, den sein böser Stern, oder sein Gefährte Reinhold von Milan, wieder nach der Warte führte. Dietrich schwang sich auf sein edles Ross und jagte über das flache Tal nach der Anhöhe. Die beiden Recken machten Halt und ritten kühn dem einzelnen Mann entgegen. Als aber Wittich dem König in das vom Höllengeist des Zorns entstellte Antlitz blickte, als ihn dessen Atem wie glühende Lohe anwehte, da erfasste ihn ein nie gefühltes Entsetzen. Er wandte den Hengst, er floh, und Reinhold folgte ihm. „Steht, Feiglinge, Mordhunde, steht!“, rief der wütende König, „Zwei gegen Einen, ihr habt leichtes Spiel!“ - „Halt an, Geselle“, mahnte Reinhold, „die Schmach ertrag ich nicht.“ Wittich kehrte sich um, aber wieder sah er das entsetzliche Angesicht, und der Feueratem wehte ihm entgegen. Er trieb Skemming weiter zur Flucht, während Reinhold den Verfolger erwartete, aber nicht hemmen konnte, denn ein furchtbarer Streich spaltete ihm Helm und Haupt.
„Feige Memme!“, rief Dietrich dem Flüchtling nach: „Du führst Mimung und hast mich einst in Bern bestanden. Wage den Kampf!“ Doch Wittich trieb den edlen Skemming bald mit Schmeichelrede, bald mit den Sporen vorwärts. So tat auch der König. „Falke“, rief er, „zeige jetzt, dass du Skemming überlegen bist. Nur dieses eine Mal hilf mir, den feigen Mörder zu erreichen.“ Falke griff mächtig aus und kam dem Flüchtling auf Speerwurfweite nahe. Da hörte man das Brausen der Meereswellen, die Brandung, die donnernd ans Ufer schlug. Der flüchtige Recke erreichte eine Klippe am Wasser, und da war kein Raum mehr zu entrinnen. Doch welch Wunder, aus den Fluten erhoben sich zwei weiße Arme und ein Frauenhaupt, von Locken umwallt wie von flockigem Schaum. „Wachilde, Ahnfrau, rette, birg den Verfolgten vor dem Höllengeist!“, ruft er, und wagt den Sprung auf Leben und Sterben. Und Wachilde, die Meerfrau, einst in Liebe seinem Ahnherrn Wilkinus verbunden, fasst ihn in die Arme und trägt ihn sanft in ihren Kristallpalast auf dem Grund des Meeres. Auch Dietrich säumt nicht, Falke zum Sprung zu spornen. Das Wasser schlägt über dem Ross zusammen, aber es arbeitet sich empor und schwimmt mit dem königlichen Helden durch die tobende Brandung. Doch wie weit auch der König umherspäht, ob Wittich wieder auftauche, er sieht nur schäumende Wellen, die wie Nixen auf- und niedersteigen, wie die Wellen der Zeit im Ozean der Ewigkeit. Traurig lenkt der König nach dem Strand zurück. Er hatte weder die Rache noch den Tod, den er suchte, gefunden.
Der Held kam wieder auf den Wartberg. Dort sah er Rüdiger bei der Leiche seines Sohnes und die hünischen Fürsten im Kreis um die erschlagenen jungen Recken versammelt. Er hörte, wie die Hünen erklärten, dass sie nun den Söhnen ihres Königs die Leichenfeier halten und dann heimfahren wollten. Dietrich blieb von den Reden unbewegt. Er saß wieder bei den Gefallenen und verharrte schweigend. Dagegen suchte Meister Hildebrand die Fürsten zur Verfolgung des Sieges zu bewegen. Er stellte ihnen vor, wie alle Arbeit, alles vergossene Blut vergeblich, alle Beute, aller Gewinn verloren sein würden, wenn sie auf ihrem Entschluss beharrten. Doch sie blieben unbeugsam bei ihrem Vorhaben.
In Bern wurde die Leichenfeier mit großem Gepränge begangen. Als man die Leichen einsenkte, zerschnitten sich viele Hünen nach ihrer hünischen Sitte Gesicht und Brust und heulten, um den Totenhügel schreitend, ein schauerliches Grablied. Als dann das Heer schon auf der Heimfahrt war, saß der Berner Held immer noch am Hügel. Da trat Markgraf Rüdiger zu ihm, sprach von seinem eigenen Verlust und versicherte ihm, die gute Königin Helche werde ihm wieder ihre Huld zuwenden, wenn sie den Hergang erfahre. Sie sei so mild und gütig, dass sie ihm auch den König versöhnen werde. Auch Meister Hildebrand war zugegen und schalt den Helden, dass er gleich einem Klageweib Mut und Kraft verloren habe. Er solle an Bern denken, das Ermenrich und der ungetreue Sibich wieder unter ihr Joch bringen würden, das aber wieder befreit werden müsse. Darauf erhob sich der Held und sprach: „Es ist nicht Trauer und Klage, was mir die Kraft raubt. Es ist die vereitelte Rache. Schafft mir den Sohn Wielands zur Stelle, dann werdet ihr an meinen Schwertstreichen erkennen, dass ich den oft bewährten Mut noch nicht verloren habe.“ So sprach der Held. Doch ließ er sich endlich bereden, mit seinen Gesellen sich dem heimkehrenden Heer anzuschließen.
Rückkehr zu Etzel und Nibelungenschlacht
Zu Bechelaren wurde haltgemacht, um den Mannen und Rossen Zeit zur Erholung zu lassen. Hier verbreitete die Nachricht vom Tod der jungen Recken große Wehklage. Die Stätte des beglückenden Friedens wurde eine Stätte des Jammers. Man brach daher früher auf, als man Willens war, und erreichte nach mancher mühseligen Tagesfahrt die Etzel-Burg. Dietrich blieb mit Hildebrand in einer Herberge, das Heer aber zog am Palast vorüber nach der jenseitigen Ebene zur Lagerung. Königin Helche sah vom Fenster herab auf die zusammengeschmolzenen Scharen, denen zum Teil die fürstlichen Führer fehlten. Sie erkannte aber auch die Hengste, welche ihre Söhne geritten hatten, sah an Sattel und Decken Spuren von Blut, und eine Ahnung vom geschehenen Unglück stieg in ihrer Seele auf. Da trat Rüdiger in den Saal. Sein Antlitz verriet den Schmerz über seinen und ihren Verlust, bevor er die unglückliche Botschaft in Worten aussprach. Sie weinte und klagte bald sich selbst, bald den Gemahl an, dass er die Heerfahrt vergönnt hatte. Sie fluchte dem Mörder, begehrte sein Herzblut und wollte zu Etzel eilen, dass er von dem Berner das verpfändete Haupt einfordere. Mit Mühe bewog sie der Markgraf, dass sie auf seinen Bericht hörte. Als sie nun alles erfahren hatte, da siegte ihr Edelmut über den Schmerz. Sie ging an Rüdigers Hand in die Herberge, wo Dietrich, in sein Leid versunken, sie nicht eintreten hörte. Sie schlang die Arme um den trostlosen Mann, küsste ihn wie eine Mutter den Sohn und weinte mit ihm um die Verlorenen.
Es gelang der Königin, auch Etzel zur Versöhnung mit dem unglücklichen Berner Helden zu bewegen, so dass dieser wieder am Hofe erscheinen durfte. Die Zeit, die so viele Wunden heilt, linderte auch das Leid des Königs, und Dietrich gewann durch hilfreiche und kühne Taten wieder die Gunst seines Schirmherrn. Nur Helche genas nicht von der Wunde, welche ihr der Tod ihrer geliebten Söhne geschlagen hatte. Sie erkrankte und siechte langsam dem Grab zu. Als sie fühlte, dass die Stunde des Abschieds von aller irdischen Herrlichkeit nahe war, ließ sie Etzel zu sich kommen. „Mein Herr und Gemahl“, sagte sie, „wir haben in unserem ehelichen Leben manche Freude und auch manches Leid gemeinsam bestanden. Nun ist die Zeit gekommen, dass ich von dir gehen muss. Heute nacht, als ich das alles überdachte, hatte ich ein Traumgesicht, das mir ebenso deutlich die Zukunft offenbarte, wie jener Traum vor der Heerfahrt unserer Söhne, den wir aber nicht beachteten. Ich sah unsere Halle reich geschmückt, wie am Tag unserer Hochzeit. Eine schöne, aber blasse Frau saß an deiner Seite. Doch als ich sie recht betrachtete, gewahrte ich, dass nur Haupt, Brust und Arme menschlich, ihr Leib dagegen eine ungeheure Schlange war. Ihr Gewand, das den Schlangenleib zum Teil verhüllte, war nach Weise der Burgunden, so auch die Krone auf ihrem Haupt und das Wappenschild über der Krone. Sie erhob sich vom Thron und winkte mit der Hand. Da fiel ein Feuerstrahl von der Wölbung unter die versammelten Helden, und sie bekämpften und mordeten sich gegenseitig. Die flammende Lohe ergriff den ganzen Saal, und die Helden und sie selbst gingen darin unter. Du aber bliebst mit Dietrich und Hildebrand allein unter Leichen und Trümmern. Höre nun die Deutung des Traumes aus dem Mund der sterbenden Gattin: Du wirst dich nach meinem Abscheiden wieder vermählen. Wählst du eine Frau aus dem Königshaus der Burgunden, dann werden durch sie in dieser Halle deine Recken außer Dietrich und dem alten Meister untergehen.“ Die Königin sprach nicht weiter. Sie reichte dem Gemahl die Hand und verschied.
Etzel war untröstlich über den Verlust der langjährigen, treuen Lebensgefährtin. Das ganze Volk trauerte mit ihm, denn Helche war eine wahre Landesmutter gewesen. Ein ganzes Jahr gab es weder Festlichkeiten am Hofe noch Heerversammlungen. Indessen wurden Wünsche laut, der König möge sich wieder eine Ehegenossin wählen, damit das Land nicht verwaist sei, wenn er ohne rechtmäßige Erben sterbe. Die Wünsche kamen ihm zu Ohren, und vielleicht sehnte er sich selbst, des Witwerstandes überdrüssig, nach einer häuslichen Wirtin. Er beriet sich mit seinen Räten und mit dem geehrten Gast von Bern. Der Letztere meinte, es sei keine Frau in der Welt würdiger, den Thron mit dem großen König zu teilen, als Kriemhild, die Witwe des ruhmvollen Nibelungenkönigs Siegfried. Alle Räte stimmten dem Berner bei, weil die edle Königin jede andere Frau an Schönheit, Tugend und klugem Rat übertreffe. Der König war anfangs wenig geneigt, dem Vorschlag zuzustimmen. Er sprach von dem Traum der sterbenden Helche, aber man erwiderte, Kriemhild sei durch ihre Heirat mit Siegfried aus dem Geschlecht der Burgunden geschieden, und auf sie beziehe sich die Warnung nicht. Sofort wurde Rüdiger mit der Werbung betraut, und er erhielt mit einiger Mühe das Jawort.
Wie danach durch Kriemhild alle Recken, auch die Gesellen des Berner Helden, im furchtbaren Kampf umkamen, wird ausführlich in der Nibelungensage erzählt, auch wie Siegfried geboren wurde, wie er Lindwurm und Drachen erschlug und dadurch unverletzbar wurde, wie er den Schmied Mimer besiegte, der sein Lehrer werden sollte, und sein Schwert selbst schmiedete, wie er den Zwergenkönig Alberich besiegte, den Nibelungenschatz gewann und wieder den Zwergen überließ, wie in Burgund König Gunther herrschte und Hagen als Berater regierte, wie Siegfried dem König Gunther diente und für ihn Brünhild zur Ehefrau gewann, wie Siegfried um Gunthers Schwester Kriemhild warb, wie er sie aus den Fängen des Drachens befreite und heiratete, wie es zum Streit zwischen Brünhild und Kriemhild kam, wie Hagen hinterhältig Siegfried tötete und sich dessen Schwert Balmung aneignete, wie Kriemhild zur Witwe wurde und Rache schwor, wie Markgraf Rüdiger im Auftrag von Etzel um Kriemhild warb, wie Etzel und Kriemhild heirateten und ihr Sohn Ortlieb geboren wurde, wie König Gunther zur Sonnenwendfeier ins Reich von Etzel eingeladen wurde, wie er mit seinen Brüdern Gernot und Giselher und vielen mächtigen Burgundern unter der Führung von Hagen in das Reich der Hünen kam, wie sie dort von Markgraf Rüdiger wie gute Freunde ehrenvoll empfangen wurden, wie er seine Tochter Dietlinde mit Giselher verlobte, Hagen mit dem Schild von seinem getöteten Sohn Nudung beschenkte und Gernot ein mächtiges Schwert verlieh, wie die Burgunder mit Rüdiger zur Etzel-Burg zogen, und wie sie von König Etzel und Kriemhild empfangen und auch von Dietrich ehrenvoll begrüßt wurden.
Danach ist von der großen Nibelungenschlacht ausführlich zu lesen, wie Kriemhild Blödelin, den Bruder von Etzel, für ihre Rache an Hagen gewann und damit die Schlacht begann, in der zuerst Blödelin fiel, wie daraufhin der unschuldige Ortlieb, der kleine Sohn von Etzel und Kriemhild, von Hagen vor aller Augen enthauptet wurde, wie die Schlacht im Königssaal der Etzel-Burg immer grauenvoller entbrannte, wie Kriemhild nur Hagen als Geisel forderte, um die Schlacht zu beenden, aber ihn die Burgunder nicht preisgeben wollten, wie sich nun Rüdiger und Dietrich nicht mehr aus dem Kampf heraushalten konnten, wie Rüdiger von Gernot mit der verliehenen Waffe getötet wurde und seine Gefolgsleute fielen, wie nach und nach alle Burgunder bis auf Hagen und Gunther, sowie alle Gesellen von Dietrich bis auf Hildebrand im wilden Kampf starben, wie Dietrich schließlich selbst in den Kampf zog, Hagen und Gunther überwältigte und gefangennahm, wie Kriemhild Hagen freisprechen wollte, wenn er ihr das Geheimnis vom versenkten Nibelungenschatz in der Tiefe des Rheins preisgebe, wie sich Hagen weigerte, solange sein König Gunther lebt, wie sie daraufhin ihren Bruder Gunther köpfen ließ, aber Hagen trotzdem stolz blieb und sich weiter weigerte, wie sie schließlich selbst das Schwert Balmung ergriff und Hagen vor den Augen von König Etzel enthauptete, wie dies Waffenmeister Hildebrand nicht ertragen konnte und Kriemhild erschlug, wie am Ende von allen Helden neben dem König nur noch Dietrich und Hildebrand übrigblieben, wie die zahllosen Leichen im Hünenreich beklagt und begraben wurden, und wie Siegfrieds Schwert nach Burgund zurückgebracht und in Siegfrieds Totenhügel mit der Botschaft von Hagens Blut zurückgegeben wurde.
Dort steht auf hoher Warte noch immer die alte und doch ewig junge Sage. Sie winkt uns, sie deutet nach Osten der Donau entlang, nach dem Land der Hünen, wo die Etzel-Burg mit ihren goldenen Zinnen emporragt. Wir folgen auf den Flügeln der Phantasie ihrem Fingerzeig und erblicken zur Rechten der Burg einen Hügel, von einer mächtigen Säule aus schwarzem Marmor gekrönt. Das Morgenrot spiegelt sich in seiner glatten Fläche und beleuchtet auch die Blumen, die eine sorgsame Hand dahin gepflanzt hatte. Ein Mann im grauen Trauergewand schreitet wankenden Schrittes nach der einsamen Stätte, und wie er da steht, ist es, als wolle er mit seinen starren Blicken bis in das Innere des Hügels dringen. Es ist König Etzel, ohne Krone, ohne Perlenschnur, ohne den goldenen Gürtel um die Hüften. Er war jählings gealtert, denn seine Haare und sein Bart sind in wenigen Tagen eisgrau geworden. „Ja“, murmelt er, „da haben wir sie hingebettet, und mit ihr, mit meiner Königin Kriemhild, ist alle meine Freude und Wonne zu Grabe gegangen. Unser Söhnchen Ortlieb schläft bei ihr, in ihrem Arm, und ich selbst werde wohl bald mit ihnen vereinigt sein. Aber das hat nicht sie getan, die man die Unheilstifterin nennt, das haben die finsteren Nornen so gefügt, die im Verborgenen die Geschicke der Menschen weben.“ Er lässt sich auf einem Rasensitz nieder und versinkt in düsteres Schweigen.
Auf der anderen Seite des Palastes erhebt sich ein größerer, noch umfangreicherer Hügel, und dort steht ein Mann in glänzender Rüstung. Es ist Herr Dietrich, der König von Bern, der, so scheint es, seine Heergesellen aus dem Todesschlaf erwecken möchte. „Sie hören mich nicht“, murmelt er wie Etzel vor sich hin, „sie vernehmen nicht mehr die Stimme ihres verlassenen Herrn, mit dem sie in Freud und Leid verbunden gewesen waren. Sie schlafen mit den anderen, die sich feindlich bekämpften. Jetzt hat sie alle das Grab versöhnt und vereint. Aber warum habt ihr mich allein und hilflos zurückgelassen? Wer soll mir nun zur Seite stehen, dass ich mein Amelungenland, mein geliebtes Bern wiedergewinne? Hei, du gutes Schwert, bist mir nun unnütz geworden. Ich will in die weite Fremde gehen und Bettelbrot heischen, bis mich der Tod mit euch zusammenführt. Brich, unnütze Klinge, dein Dienst ist zu Ende!“
Er zieht sein Schwert, um es zu zerbrechen. Aber da legt sich ein weicher Arm um seinen Nacken, und wie er sich umwendet, blickt er in das Angesicht seiner treuen Gattin Herrat. „Held von Bern“, spricht sie sanft mahnend, „hast du den alten Mut verloren? Wo ist dein gewohnter Heldensinn hingeschwunden? Raste nicht länger rat- und tatenlos im Hünenland, wo König Etzel gebrochenen Mutes keine Heerfahrt mehr rüstet. Zieh ohne seine Hilfe ins Lombarden-Land! Gedenke des Segens der guten Frau Sälde, dass du niemals sieglos sein sollst. Vertraue auf dich selbst, auf dein Recht, auf dein Schwert und nicht mehr auf andere Menschen.“ - „Doch aber auf den getreuen Hildebrand!“, rief der Meister, der ungesehen genaht war. „Der Alte steht zum König von Bern“, fuhr er fort, „und auch der rät zur Heerfahrt, gleichwie die edle Frau hier an der Totenstätte.“ „Herr“, setzte er hinzu, als der Berner seine hochherzige Gattin in die Arme schloss, „Herr, wer solch eine Frau sein eigen nennt, der hat, bei meinem Graubart, einen größeren Schatz, als der Nibelungenschatz ist. Nun aber bringe ich gute Nachricht: Der getreue Eckehart harrt mit seinen Gesellen auf unsere Ankunft in Lombarden, und mein lieber Junge Hadubrand, den ich als Knäblein bei Frau Ute zurückließ, ist ein stattlicher Recke geworden und führt Befehl zu Garden. Er und noch andere Recken werden zu uns stehen. Darum auf nach Lombarden, mag auch der Kaiser Ermenrich zu Romaburg seine Heere aufbieten!“
„Auf nach Lombarden!“, wiederholte der Berner Held, richtete sich auf, blickte seiner hochherzigen Frau ins Angesicht und sprach: „Ich fahre mit Hildebrand nach Bern, mein Amelungenland zu gewinnen oder ruhmvoll zu sterben.“ - „Und ich fahre mit euch“, sagte sie, „um euch zu pflegen auf der mühereichen Fahrt.“ - „Du bleibst in Etzels Hut, bis ich zurückkehre, um dich als Königin heimzuführen. Eine Frau kann nicht mit uns im wilden Schlachtgetümmel das Schwert führen. Sie würde bei unglücklichem Ausgang Schmach erdulden.“ - „Ist es denn das Schwert allein, das den Sieg gewinnt?“, versetzte sie: „Bedarf der Held nicht des klugen Rates, und wenn ihn die Wunde lähmt, der Pflege? Eine Frau führt zwar nicht das Schwert in den Reihen der Kämpfer, aber sie duldet keine Schmach und weiß zu sterben.“ Ein Dolch blitzte in ihrer Hand. „Verstehst du mich?“, fügte sie hinzu: „Es ist der treueste Helfer, der vor Schmach bewahrt.“
Er nahm seine traute Liebe in den Arm:
„Du bist der kühnste Held,
Verscheuchst mir Sorg' und bittren Harm;
Nun trotz ich einer Welt.“

Dietrichs Auszug mit Herrat und Hildebrand
Der Bund auf Leben und Sterben war geschlossen, und Dietrich nahm Abschied von König Etzel, der in seiner Verdüsterung wenig Teilnahme zeigte. Er fragte nur, ob der Berner seine Mannen im Grabhügel wachgerufen habe? Dann winkte er ihm, zu scheiden, denn er wollte allein sein.
Dietrichs Sieg und Kaiserkrönung
So bereiteten sich die drei Verbündeten zur Reise nach Amelungenland, wo der König von Bern vor vielen Jahren vom mächtigen Kaiser Ermenrich mit großer Gewalt aus seiner Herrschaft vertrieben worden war. Jetzt wollte der kühne Held mit Meister Hildebrand und Herrat sein Land wiedergewinnen. Der Meister hatte viel von Helfern im ersehnten Land gesprochen, und daher erschien die Hoffnung auf Erfolg nicht eitel. Zwei Lasttiere begleiteten den Zug, das eine mit Mundvorrat und Rüstzeug, das andere mit Gewandung und Schätzen der edlen Frau beladen. Der Ritt über das Gebirge war beschwerlich und ging langsam voran. Der Berner, von Ungeduld getrieben, war oft eine weite Strecke voraus. Als er auf eine Hochebene gelangte, über welche aus steilem Felsen eine Burg emporragte, jagte der alte Meister hinter ihm her und rief: „Herr, haltet Speer und Schwert bereit, denn in dem Felsennest haust ein grimmiger Wolf, der starke Elsung, ein Wegelagerer und Feind der Amelungen.“ Die Warnung war nicht vergeblich, denn der Raubritter brach plötzlich mit seinem Gefolge an Recken aus einer Schlucht hervor. Er forderte höhnisch als Wegegeld Rosse und Rüstungen, desgleichen die rechte Hand und den rechten Fuß der Wanderer. „Rüstzeug, Hände und Beine können wir nicht gut missen“, versetzte Hildebrand, „wir benötigen sie zum Kampf im Amelungenland.“ Da indessen auch Herrat angelangte, so begehrte der Wegelagerer auch die schöne Frau, die ihm wohlgefalle, und die er zur Kurzweil als Ehegenossin auf seine einsame Burg führen wolle. „Auch der herrlichen Frau sind wir bedürftig“, erwiderte der Meister, „dieweil sie auf der Reise für unsere Leibespflege sorgt.“ Der Berner Held hatte indessen den Speer ergriffen und rannte den Wegelagerer kopfüber vom Pferd. Sogleich begann der Kampf mit den Recken, der mit ihrer Niederlage endigte. Der Burgherr selbst wurde gebunden und sollte auf einem der erbeuteten Pferde mitgeführt werden. Da sprach er grimmigen Mutes: „Habt ihr mich geschädigt, so will ich euch üble Nachricht melden. Denn ich erkenne euch wohl, ihr seid Ermenrichs Mannen und kommt aus fernen Landen. Vernehmt denn: Der Kaiser Ermenrich, euer Herr, hatte einst auf Ratschlag seines ungetreuen Marschalks Sibich die schöne Swanhild, seine Gemahlin, von Rossen zertreten lassen. Dafür wurde er nun von deren Brüdern an Händen und Füßen verstümmelt und liegt todkrank darnieder. Wenn ihr nach Romaburg kommt, ist er vielleicht schon gestorben, und der Marschalk wird euch in einem dunklen Verließ Unterkunft verschaffen.“ - „Hei, unverzagter Mann“, rief Dietrich, „du rennst dem Galgen zu, wenn du dein Raubgeschäft nicht aufgibst! Aber uns bist du gegen deinen Willen ein glücklicher Bote. Daher löse man dem Strolch die Bande und lasse ihn laufen.“ - Der frei gelassene Räuber sah verwundert mit offenem Mund den Reisenden nach, die lachend ihres Weges zogen.
Die Straße führte nach einem anderen Burgsitz, wo der mit Hildebrand befreundete Graf Ludwig mit seinem tapferen Sohn Konrad bisher seine Freiheit gegen den Kaiser Ermenrich behauptet hatte. Die Reisenden wurden mit großen Ehren empfangen. Doch verweigerte Dietrich die Einkehr ins Schloss, weil er gelobt hatte, nicht eher unter ein Dach zu treten, bis er sein geliebtes Bern wiedergewonnen habe. Deswegen wurde das festliche Mahl im Freien hergerichtet, und da mundete den werten Gästen und Gastgebern die leckere Kost unter dem grünen Gezweig trefflich, wo die befiederten Sänger ihre Lieder dazu sangen. Frau Herrat selbst füllte den tüchtigen Helden fleißig die Becher mit rotem Südwein. Da gab es fröhliche Reden, heitere Trinksprüche und mancherlei Kurzweil. Das Gelage wurde unterbrochen durch einen Boten vom getreuen Eckehart, der eilends auf schweißtriefendem Ross daher jagte. Er berichtete, Ermenrich sei seinen Wunden erlegen, und der falsche Sibich habe sich der Herrschaft bemächtigt. Derselbe stehe an der Spitze eines zahlreichen Heeres von Söldnern, das er mit den kaiserlichen Schätzen geworben habe, aber alles Volk begehre den König von Bern zum Herrscher in Romaburg. „Das ist gute Nachricht!“, sprach Frau Herrat: „Nun lasst uns wacker sein, dass sich der Spruch von Frau Sälde erfülle. Vernehmt meinen Rat: Der König von Bern, mein Eheherr, reitet mit dem jungen Recken Konrad und begleitet von mir nach der Stadt seiner Ahnen, während der alte Meister mit Ludwig, unserem edlen Gastgeber, nach Garden reitet, wo die Wölflinge, sein Geschlecht, heimisch sind. Wie werden sich seine Frau Ute und sein Sohn Hadubrand der Heimkehr des teuren Mannes freuen! Am großen Heerstrom finden wir uns dann wieder zusammen, und dorthin bescheiden wir auch den getreuen Eckehart mit seinem kühnen Gesellen Hache (Rache). Dann ziehen wir gemeinsam nach Romaburg, um den üblen Marschalk, der sich jetzt Kaiser nennt, zu züchtigen.“ Der Rat der klugen Frau deuchte den Recken heilsam, und sie brachen am folgenden Tag auf, um das große Werk zu vollbringen.
Fröhlichen Mutes trabte der alte Meister mit Ludwig und seinen Mannen nach Garden am glänzenden See. Er erzählte viel von seinen Abenteuern, insbesondere vom schrecklichen Ende der Burgunder. Schmetternde Hörner unterbrachen seine Rede. Als er sich umkehrte, erblickte er wehende Banner, die er wohl kannte. Es waren die Feldzeichen der Hünen, und bald sah er sich inmitten einer Heerschar hünischer Krieger, die des Stillsitzens müde und den Spuren des Berners gefolgt waren. Sie begrüßten jubelnd den alten Meister und schlossen sich dem Zug an. Der Marsch ging weiter durch das Ledrotal an starren Felswänden vorüber, dem Ponalbach entlang, der aus finsterer Schlucht hervorbrechend, brausend und schäumend dem Spiegel des Sees zueilt, wo er Ruhe findet, wie der Held nach mühereicher Bahn in Odins Halle. Da sah man zu beiden Seiten der Straße Aloe aus Felsspalten hervorstarrend, bald auch Oliven- und Maulbeerpflanzungen und das dunkle Laub der Zitronen und Orangen. „Dort“, rief der Alte freudig bewegt, auf die glänzenden Zinnen deutend, „dort ist Garden, meiner Ahnen, der Wölflinge Sitz. Da warten meine liebe Frau Ute und mein Sohn Hadubrand auf mich, den ich als zartes Knäblein vor vielen Jahren verlassen musste. Da werden wir freudig empfangen werden.“
Er hatte das Wort kaum ausgesprochen, da sah man einen gerüsteten Heerhaufen herantraben, dem der feuerrote Heerschild, das Wahrzeichen des Kampfes, voranleuchtete. Ein Recke in glänzender Rüstung sprengte vor. „Heda!“, rief er, „Kommt ihr Hünen, um unser Feld zu verwüsten? Aber ihr findet uns zur Wehr bereit. Ist nun ein unverzagter Recke unter euch, der mit mir das Schwertspiel Stirn gegen Stirn versuchen will, der trete hervor!“ Von dem nun folgenden Zweikampf sangen die Barden lange Zeit, denn es war ein Kampf zwischen Vater und Sohn.
Das Lied von Hildebrand und Hadubrand
Ich hörte von Leuten, die der Länder kundig waren, dass sich einst im Feld zum blutigen Kampf zwischen zwei Heeren Hildebrand und Hadubrand mit zornigem Mut herausforderten, herrlich gerüstet, Vater und Sohn, nach Siegesruhm begierig. Um breite Brust schnürten sie die Brünne, dass stark im Streit die Rüstung schirme. Die scharfen Schwerter gegürtet, strebten sie zum Streit. Hildebrand, der greise Krieger, an Weisheit groß, sprach: „Welches Vaters rühmst du dich, junger Recke? Oder welches Geschlechts? Gib schlichte Antwort! Nenne einen der Männer, so weiß ich auch die andren alle. Der Könige kenne ich viele, kund ist mir das Erdenvolk.“ Darauf sprach Hadubrand, Hildebrands Sohn: „Mir sagten Leute, die längst dahingeschieden sind, dass mein Vater in ein fernes Land fuhr. Vor Sibichs Zorn wich der Recke mit Dietrich und wenigen Gesellen weithin ostwärts. In der Fremde darbte er, ein freudloser Mann, der sonst im Kampf vor allen voran stritt, die Fahne zum frohen Sieg führend. So war er kund den kühnen Männern. Doch sie sagten, er sei im Sieg gefallen, die Feinde verfolgend auf feurigem Ross. Ich glaube nicht, dass er noch im Leben weilt.“
Da sprach Hildebrand, Herbrands Sohn: „Ein Verwandter scheinst du mir, mutiger Recke. Nenne deinen Erzeuger, wie sich der Jugend ziemt!“ Mit Hohn antwortete Hadubrand dem Alten: „Wenn du im Staub hingestreckt von meinen Streichen liegst, trugsinnender Dränger, dann trägst du die Geschichte hin nach Helheim, die ich nicht länger hehle.“ Antwort gab Hildebrand, Herbrands Sohn: „Oh Gott im Himmel, du weißt, dass du mich niemals zur Walstatt sandtest, um mit so nahen Verwandten das Schwertspiel zu wagen.“ Er wand vom Arm eine gewundene Spange, die kunstvoll aus Kaisergold geschmiedet war: „Die gab mir gütig der hehre König, der Hünen Herrscher, und sprach huldvoll, dass ich sie dem werten Recken reiche, dem trauten Sohn sendet er die Gabe.“
Darauf sprach Hadubrand, Hildebrands Sohn: „Mit scharfem Speer empfängt man solche Gabe, Spitze gegen Spitze, das ist Sitte, alter Hüne! Listig spähend und mit Rede umspinnend sinnst du, mir den Speer in die Seite zu bohren. Trug sinnst du, Unseliger, so alt an Jahren! Mir sagten Seeleute, die westwärts im Wind weit gesegelt waren, dass der werte Vater fiel, gefällt im Kampf. Tot ist der starke Held!“ Antwort gab Hildebrand, Herbrands Sohn: „Dich zwang in Zwietracht niemals ein Tyrann, als elender Flüchtling der Heimat zu entfliehen. Mir sandte der waltende Gott solches Leiden ohne Verschulden. Ich wurde im Heervolk an die vorderste Front im Kampf gestellt. Bisher fällte mich nicht der Tod im Toben des tödlichen Streites. Doch nun soll das geschwungene Schwert des Sohnes im Blut des Vaters schwelgen! Wie verblendet bist du?! Willst starrenden Stahl mir ins Herz stoßen. Oder ich muss dich morden mit tödlicher Waffe. Versuch es, Geselle, und wirf den Speer! Wenn kriegerische Kraft dich zur Untat kräftigt und es dich recht dünkt, dem verwandten Recken mit raffenden Händen das Rüstzeug zu rauben. Der Feigste im Volk verschmäht ein solches Gefecht. Und du strebst lüstern zum Kampf, um Gewand und Wehre eines Greises zu gewinnen. Doch nur der Allwaltende weiß, wer die Beute gewinnt.“
Da schossen sie in schirmende Schilde die scharfen Speere, Schwerter krachten mit geschwungener Kraft, und zerspaltene Schilde verloren ihren Glanz. Des Meisters Helm klaffte zerhauen, da wandte sich ab, wankend der Held, der nicht morden wollte den jungen Recken. Doch dreht sich nur, und schlägt ihn mit einem harten Schirmschlag anrennend rücklings zu Boden. Mit erhobenem Schwert droht er nun dem gefällten Feind den Tod, wenn er nicht Geschlecht und Namen nenne. Da spricht Hadubrand, Hildebrands Sohn: „Des Sieges ledig durch den listigen Kämpfer, doch nimmer bin ich der Ehre bar, so dass du mir deinen Willen aufzwingen kannst. Hei, gebrauche dein Recht! Schneide mir die Todes-Rune in die Brust, ich schaudre nicht. Oh großer Gott, lass Frau Ute genesen, die harmvoll wartet auf Gatten und Sohn!“ Darauf spricht Hildebrand, Herbrands Sohn: „Du selbst, kühner Recke, bist Sieger geworden. Denn ich, der Alte, nenne mich zuerst. Schau hier, das Ringlein reichte mir Ute als liebliche Jungfrau zur Feier der Vermählung. Du warst und bist unser einziger Sohn, ein herrlicher Held und Herrscher zu Garden.“ Da hob er den Hochgemuten von der Erde, zog ihn an seine Brust und umarmte ihn wie eine Rüstung.
„Bei Gott, Frau Ute, sollst eilends niedersteigen vom Söller, zu schauen den lieben Sohn! Heim kehrt der kühne Held als herrlicher Sieger. Einen Gefangenen führt er, dessen Helm er zerhauen hat, einen alten Krieger mit langem Graubart.“ So mahnte die sorgliche Magd die Herrin. Als Vater und Sohn in den Saal eintraten, freute sich die Frau, des Fremdlings nicht achtend, küsste den Liebling und lobte ihn immer wieder. Dann setzen sich die Männer freundschaftlich an die Tafel, zuoberst der Alte, wie dem Edlen geziemt. Dessen zürnte Frau Ute, und zornigen Mutes begann sie zu schelten, zu schmähen den Sohn, weil er den Gefangenen mit Fülle von Ehren vor anderen Helden im Sitz erhoben hatte.
„Mutter Ute!“, ruft der Recke: „Der Alte bezwang mich im Zweikampf voller Kraft, und doch ist er uns ein Freund, auch zu deiner Freude. Ich denke, du kennst den mächtigen Helden. Hei, biete ihm den Becher, mit neuem Wein gefüllt.“ Frau Ute schaute ihn genauer an: Wie schäumende Wellen floss ihm der graue Bart bis zum Gürtel hinab, und tiefe Narben, vom Schwert gerissen, durchfurchten das Antlitz des furchtlosen Recken. Doch den angetrauten Gemahl konnte sie nicht erkennen. Sie bot ihm den Becher mit zarten Händen, und er leerte ihn mit leuchtenden Augen bis zur Neige. Dann ließ er ungesehen das Ringlein hineinfallen und gab den Becher zurück. Da erblickt und erkennt sie die Gabe der Liebe, die sie einst dem geliebten Gatten verliehen hatte. Nun umfängt sie ihn und hält fest in ihren Armen, den lange Verlorenen und verlassenen Helden, der in friedloser Fremde ein freudloser Mann war. Da sitzen nun beisammen in seliger Wonne die Wölflinge, Vater, Mutter und Sohn. Sie feierten ein großes Fest, dem Alten zu Ehren, der viel Leid erlitten hatte und doch den Sieg gewann.

Wohlgemut zog indessen der Berner Held nach seiner lieben Vaterstadt. Er wurde von den Burgmannen festlich empfangen. Sie hatten die Söldner Sibichs aus ihren Mauern vertrieben und schwuren ihrem alten Herrn freudig den Eid der Treue. Bald kamen viele Könige und Fürsten mit ihren Mannen aus Burgen und Städten des Amelungenlandes. Sie brachten Gold und Rüstzeug und gelobten Beistand gegen den ungetreuen Sibich, der sich zu Romaburg die Kaiserkrone aufs Haupt gesetzt hatte. Auch Meister Hildebrand fand sich mit seinem Sohn ein, verstärkte nicht nur das Heer, sondern erhob auch durch seine Zuversicht das Vertrauen der Kämpfer auf Ruhm und Sieg. Auch die mutige Herrat erinnerte an den Segensspruch von Frau Sälde und begleitete ihren Gatten auf der Fahrt. Sie entdeckte einen Sendling Sibichs, der mit viel Geld aus der kaiserlichen Schatzkammer die Kämpfer zum Treubruch und Verrat verleiten wollte. Dazu kam der tapfere Ludwig, der sich wieder mit seinem Sohn Konrad vereinte, auch der getreue Eckehart mit seinem Gesellen Hache (Rache), und sogar Heime, der in einem Kloster Buße getan hatte, war nach der Kunde von Dietrichs Heimkehr zu ihm geritten, weil er seines Lehnseides durch Ermenrichs Tod ledig war.
Die Heere trafen bald aufeinander, doch wie groß auch die kaiserliche Übermacht war, und wie gewaltig die streitbaren Söldner des ungetreuen Mannes stritten, sie bestanden nicht vor Dietrich und seinen Helden. Sie lösten sich auf, wie der Nebel in der Sonne, und ergossen sich in allseitige Flucht. Eckehart und Hache (Rache) spähten nach dem ungetreuen Sibich und erkannten ihn unter den Flüchtlingen, obgleich er den Schild und alle Abzeichen seiner angemaßten Würde von sich geworfen hatte. Eckehart ergriff ihn, schwang den Feigling auf sein Ross und jagte nach dem Lager. „Gedenke der Herlungen!“, rief er ihm zu, während eilig ein Galgen errichtet wurde. Wohl dachte der tückische Verräter an die Herlungen, die Kinder, die er auf dem Gewissen hatte, an Ermenrich, an alle Opfer seiner hinterlistigen Bosheit, wie auch an die gerechte Strafe, die ihn jetzt mit tödlichem Schlag treffen sollte. Er flehte um das nackte Leben, bot Geld, mehr und immer mehr, nur für einen kurzen Aufschub. Ein Hohngelächter war die Antwort, und der Ruf „Gedenke der Herlungen!“ scholl ihm in den Ohren, bis er am Galgen der Rache baumelnd sein ruchloses Leben endete.
Die Schlacht war gewonnen. Das siegreiche Heer zog mit dem Helden von Bern an der Spitze unaufgehalten weiter bis nach Romaburg. Überall kamen dem König von Amelungenland die Herrscher und das Volk freudig entgegen. Sie begrüßten ihn als Oberhaupt, und in Romaburg empfing er die Kaiserkrone. Bei dem Gastmahl saß Herrat, die hochherzige Ehegenossin des vielgeprüften Helden, neben ihm auf dem Thron und teilte mit ihm die Ehre, wie sie die Gefahren mit ihm geteilt hatte. Die Spielleute besangen die Taten der Helden zum Saitenklang, die goldenen Becher wurden fleißig geleert, Freude und Jubel rauschten durch den weiten Raum der Halle. Als aber ein Sänger den edlen Rüdiger pries, wie auch Wolfhart, Dietleib, Alphart und andere kühne Helden, da glänzte eine Träne im Auge des Kaisers und rann in den goldenen Becher. Es war der Wermutstropfen, der in den Freudenkelch rinnt, damit sich der Sterbliche nicht seines Glücks überhebe. Die gefallenen Gesellen konnte der Berner Held nicht mehr mit Gütern belohnen, doch die lebenden, die mit ihm gesiegt hatten, beschenkte er großzügig mit Land und Burgen.

Weit gebietend stand die Macht des ruhmvollen Herrschers aufgerichtet, unangetastet von äußeren Feinden oder böswilligen Lehnsträgern über viele lange glückliche Jahre. Die Felder waren fruchtbar, es regnete zur rechten Zeit, und es gab keine Missernten, Hungersnöte und Seuchen, keine verheerenden Kriege und keine schrecklichen Verwüstungen. Die Menschen achteten sich untereinander, sie erfüllten ihre Pflichten im Leben, je nach Stand und Beruf, ließen sich nicht von Hass und Neid beherrschen und starben nicht vor ihrer Zeit. So schien sich der Segen von Frau Sälde im ganzen Kaiserreich auszubreiten. Noch im hohen Alter bewies Dietrich seine Kühnheit und Kraft im Einzelkampf. Als nämlich Altrian, ein räuberischer Riese, ins Reich eindrang und große Verwüstungen anrichten wollte, versuchte ihn Heime, der alte Geselle, zu besiegen, wurde aber erschlagen. Nun zog der Herrscher selbst aus und erlegte den Unhold nach hartem Kampf. Es war der letzte Streit, den der gealterte Held ausfocht.
Seine Lebensgefährtin, die edle Herrat, die treue Gehilfin in drangvoller Zeit, kam ebenfalls ins Alter, erkrankte und starb. Dies trübte die Heiterkeit seines Gemüts. Er wohnte nicht mehr den fröhlichen Gelagen der Helden bei, selbst die Feste zu Ehren seiner Siege waren ihm gleichgültig. Nur die Jagd machte ihm noch Vergnügen. Wenn die Hörner schallten, die munteren Rüden anschlugen, wenn er selbst zu Ross dem flüchtigen Wild nachjagte, mit dem kurzen Jägerspieß den wilden Keiler fing, da war er wieder frisch und fröhlich wie in heiterer Jugendzeit.
Einstmals badete Dietrich im Fluss. Da trabte ein Sechszehnender mit goldenem Geweih vorüber, wunderbar anzusehen, dem grünen Wald zu. Er sprang aus dem Wasser, warf sein Gewand um und rief nach Ross und Hunden. Ehe die Diener das Verlangte herbeischaffen konnten, erblickte Dietrich einen rabenschwarzen Hengst, der ihm entgegenwieherte. Schwert und Jagdspieß ergreifend schwang er sich auf das edle Tier und jagte dem Hirsch nach. Vergebens folgten ihm die mit Pferden herzueilenden Knappen. Der Held ritt fort, schneller und immer schneller und kehrte nicht wieder. Man wartete umsonst Wochen, Monate und Jahre auf seine Rückkehr. Das Reich war und blieb ohne Oberhaupt. Blutige Kriege waren die Folge dieses Verlustes. Man wünschte den Herrscher zurück, dass er richte und schlichte, aber keine Sehnsucht, kein frommes Gebet brachte ihn dem zerrütteten Reich wieder. Sein Ahnherr Wodan (der Allvater Odin) hatte ihn zu sich emporgehoben, dass er mit ihm nächtlich in der wilden Jagd über Berge, Täler und Heiden dahinbrause. Da hat ihn mancher einsame Wanderer auf dem schwarzen Ross gesehen, und das Volk in der Lausitz und in anderen Gegenden kennt ihn noch jetzt als Dietherbernet (Dietrich von Bern) im Geleit des nächtlichen Heeres.

Weiter zur Hageling- und Gudrunsage
