| Home | Bücher | News⭐ | Über uns |
Hugdietrichsage
Deutsche Überarbeitung nach dem Text von Wilhelm Wägner (1878/1882) mit vielen Abbildungen
Ausgabe:
Inhaltsverzeichnis
Nibelungensage und Nibelungenlied
Hugdietrichsage
Hugdietrich und HildburgDietrichsage
Wolfdietrich und seine Dienstmänner
Wolfdietrich und Siegminne
Wolfdietrich und der Messermann
Wolfdietrich und Bramilla
Die Geschichte von Kaiser Ortnit
Wolfdietrich und Liebgart
Wolfdietrichs Weg der Befreiung
Kaiser Dietwart
Hageling- und Gudrunsage
Beowulf-Sage
Quellenverzeichnis
Hugdietrichsage
Hugdietrich und Hildburg
Zu den Zeiten, da der Ahnherr Ortnits im Lombarden-Land waltete, herrschte in Konstantinopel der mächtige Kaiser Anzius über die Länder der Griechen, Bulgaren und vieler anderer Völker. Er empfahl sterbend seinen Sohn Hugdietrich dem getreuen Berchtung, Herzog von Meran, den er selbst erzogen und mit Würden begabt hatte. Der Herzog war bisher schon der Führer des jungen Fürsten gewesen und fuhr nun fort, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Zunächst handelte es sich darum, ihm eine ebenbürtige, schöne und verständige Gemahlin auszuwählen. Berchtung, der auf seinen Fahrten viele Höfe und Völker kennengelernt hatte, wusste nur eine Jungfrau, die er seinem Zögling und Lehnsherrn vorschlagen konnte, aber diese sei schwer zu erlangen. Sie heiße Hildburg, sagte der Herzog, Tochter des Königs Walgund von Salnecke. Ihr Vater, der sie über alles liebe, wolle sie keinem Freier geben und halte sie daher in einem festen Turm eingeschlossen, zu dem niemand Zutritt habe, als der alte Wächter, er selbst und ihre Mutter.
Der junge Hugdietrich hörte die seltsame Geschichte mit Begierde. Er sann darüber nach, wie er wohl die schöne Jungfrau von Angesicht sehen könne, und erfand eine List, die seinen Meister in Verwunderung setzte, als er ihm dieselbe mitteilte. Er wollte nämlich weibliche Künste, besonders Weben und Sticken, erlernen und dann in Frauentracht an den Hof zu Salnecke gehen. Seine zierliche Gestalt, sein langes goldblondes Haar, sein bartloses, ganz mädchenhaftes Antlitz waren wohl geeignet, den listigen Plan auszuführen. Er berief daher die berühmtesten Meisterinnen in Gold- und Seidenstickereien zu sich und arbeitete heimlich mit ihnen länger als ein Jahr, bis er es ihnen in Kunstfertigkeit gleichtat, ja in vielen Stücken sie übertraf. Mittlerweile suchte er auch in Gang und Haltung edle Frauen nachzuahmen, und wenn er in langem Gewand, das Haupt vom Schleier umwallt, mit einem Gefolge von Frauen durch die Säulenhallen lustwandelte, ahnte niemand unter dieser Hülle den Kaiser oder überhaupt einen Mann. Nach länger als Jahresfrist fuhr er mit einem zahlreichen weiblichen Gefolge, geleitet von Berchtung und einer auserlesenen Schar von Kriegern, nach Salnecke.
Es wurden vor der Königsburg prachtvolle Zelte aufgeschlagen und kunstreiche Stickereien zur Schau ausgelegt. Die Bürger und noch mehr ihre Frauen und Töchter kamen begierig, die kostbaren Stoffe und die kunstreichen Arbeiten zu beschauen. Bald fanden sich auch die Hofleute ein, die manches Stück zu kaufen begehrten. Sie erhielten aber schöne Gewänder und Teppiche als Geschenk, indem man ihnen sagte, dass hier kein Kaufgeschäft betrieben werde. Die kunstreichen Gewebe und Stickereien von glänzenden Seiden-, Gold- und Silberfäden mit eingeflochtenen Perlen und Edelsteinen wurden auch bei Hofe besprochen, und als der König und die Königin davon hörten, ließen sie die vornehme Fremde zu sich einladen. Sie leistete Folge und gab auf Befragen an, sie sei Hildgunde, die Schwester des Kaisers Hugdietrich, und wegen Zerwürfnisses von ihrem Bruder aus dem Land verwiesen. Sie bat den König um Schutz gegen Verfolgung und um eine Freistätte während ihrer Verbannung. Da sie zugleich der Königin eine kostbare Stickerei als Zeichen ihrer Huldigung überreichte, so wurde ihre Bitte huldvoll gewährt und ihr samt ihrem Gefolge Räumlichkeiten im königlichen Schloss überwiesen. Zugleich ersuchte sie die Königin, sie möge auch einige Frauen aus ihrer Umgebung in ihrer Kunst unterrichten. Hildgunde war dazu gern bereit. Sie bezog die angewiesenen Gemächer und entließ, wie verabredet, Berchtung mit seinen Mannen.
Das Gerücht von diesen Ereignissen verbreitete sich im Land und gelangte auch in den Turm zu den Ohren der schönen Hildburg. Diese kam bald, von Neugierde getrieben, mit Erlaubnis ihres Vaters in den Palast, sah die Wunderwerke der Kunst, sprach öfters mit der Künstlerin und wünschte, von ihr Unterricht zu erhalten. Letztere hatte kurz vorher dem König eine prachtvoll gestickte und mit Edelsteinen reichverzierte Mütze überreicht. Daher fand die Bitte der Tochter geneigtes Gehör. König Walgund glaubte, es sei unverfänglich, die fremde fürstliche Künstlerin den einsamen, wohlbewachten Turm beziehen zu lassen, da er sie für eine sehr passende Gesellschafterin seiner geliebten Tochter hielt. Er täuschte sich auch nicht, denn Hildburg fand bald an der vermeintlichen Lehrerin großes Wohlgefallen und schloss mit ihr eine recht herzliche Freundschaft, ohne ihr Geschlecht zu ahnen. Erst nach Wochen wurde die Entdeckung gemacht, und nun wurde die Verbindung der beiden jungen Leute um so inniger. Kein Priester sprach den Segen über ihr Verlöbnis, aber die gegenseitige feurige Liebe, die nur der Tod trennen konnte, heiligte es, und der Mond blickte freundlich wie ein Gottesauge auf sie herab, und die Nachtigall sang aufjauchzend ihr Brautlied, als sie Hand in Hand noch in später Nacht beisammensaßen.
Die Folgen des heimlichen Ehebundes blieben nicht aus. „Wie soll es nun werden?“, fragte Hildburg den teuren Freund: „Mein Vater wird keine Schonung kennen, der Tod ist mir und dir gewiss.“ - „Dann soll er uns beide Arm in Arm ermorden.“, erwiderte Hugdietrich: „Doch ich habe bessere Zuversicht. Schon sind die Wächter und Pförtner des Turmes und auch deine Zofe durch reiche Spenden und noch reichere Verheißungen für den äußersten Fall gewonnen und uns in Treue ergeben. Ich selbst werde in kurzer Frist von Meister Berchtung mit ansehnlichem Gefolge abgeholt, weil, wie man vorgeben wird, mein Bruder in Konstantinopel versöhnt sei. Ich lasse daraufhin durch Boten um deine Hand anhalten, und dein Vater wird, wenn er zugleich unser Geheimnis erfährt, nicht Nein sagen.“
Wie der junge Kaiser gesprochen hatte, so geschah es. Berchtung holte seinen verkleideten Lehnsherrn ab, aber die Werbung konnte nicht sogleich erfolgen, weil ein feindlicher Einfall den Kaiser zwang, statt der Nadel das Schwert zu ergreifen. Er führte es aber mit gleicher Meisterschaft und siegreichem Erfolg. Unterdessen war Hildburg auf dem Turm in größerer Not, als ihr Gatte im Schlachtgetümmel. Sie gebar einen Knaben, ohne dass man es auswärts erfuhr. Denn die drei Personen, die mit ihr den Turm bewohnten, waren treu wie lauteres Gold. Erst nach Monaten ließ die Königin-Mutter der Tochter ihren Besuch anmelden und erschien auch alsbald an der Pforte. Während der Pförtner absichtlich unter den Schlüsseln kramte und endlich aufschloss, hatte der Wächter das Kind wohl verwahrt in den Burggraben hinabgelassen. Es war schon Abend, und die Königin blieb über Nacht bei der Tochter. Als sie am Morgen schied, eilte der treue Diener nach dem Graben, aber er fand das kleine Wesen nicht mehr, so viel er auch suchte, es war spurlos verschwunden. Er kam endlich mit leerer Hand zu seiner Gebieterin zurück und gab vor, er sei mit dem Knaben zu einer Amme gegangen, und die habe ihn sorglich in Pflege genommen.
Um diese Zeit war Meister Berchtung wieder an den Hof zu Salnecke gekommen. Er überbrachte den Dank des Kaisers der Griechen für die gastliche Aufnahme, welche dessen erlauchte Schwester bei dem König gefunden hatte, aber auch mit dem geheimen Auftrag, je nach Möglichkeit im Namen seines Lehnsherrn um die Hand der schönen Hildburg anzuhalten. Er wurde mit großen Ehren empfangen und zu einer fröhlichen Jagd für den folgenden Tag eingeladen. Nach einem kräftigen Frühstück setzte sich der Zug in Bewegung. „Trara! Trara!“ klang das Jagdhorn, die Rüden wurden gelöst, und die Waidleute folgten durch Büsche und Sträucher, über Höhen und durch anmutige Wiesengründe. Der König und Berchtung kamen, nachdem mancher Edelhirsch erlegt war, von der Jagd ab. Sie gelangten unversehens in die Nähe des einsamen Turmes, wo Hildburg in großen Sorgen manche Träne vergoss. Daselbst entdeckten die beiden Jäger die frische Fährte eines starken Wolfes. Sie folgten ihr vorsichtig und entdeckten ganz nahe bei einem Brunnen, im Dickicht versteckt, das Lager einer Wölfin. Hier bot sich ihnen ein seltsames Schauspiel dar.

Mitten in dem Wolfsnest lag oder saß vielmehr ein kleines schönes Kind, um welches mehrere noch blinde junge Wölfe spielten. Es zupfte bald den, bald jenen von seinen wilden Kameraden an den zottigen Ohren und lallte und kicherte dabei. Die alte Wölfin sah, auf den Hinterpfoten kauernd, dem Spiel zu, doch die beiden Jagdgenossen fürchteten, sie könnte jeden Augenblick über das menschliche Wesen herfallen, zumal auch noch der alte Wolf herbeigeschlichen kam. Da verständigten sie sich schnell durch einen Blick und schleuderten ihre Wurfspeere so geschickt, dass beide Raubtiere lautlos niederstürzten. Sie traten nun zu dem Lager, und der König hob den furchtlos lächelnden Knaben auf seinen Arm und liebkoste ihn, wie ein Vater sein Kind. „Ist mir doch“, sagte er, „als sei der Kleine mein eigen Fleisch und Blut. Aber wir müssen auf seine Ernährung bedacht sein. Der Turm meiner Tochter ist nicht weit abgelegen. Da findet sich wohl frische Milch, den Kleinen zu laben, und sie wird auch ihre Freude an ihm haben, denn sie herzt und küsst gern kleine Kinder.“ Berchtung rief noch einen Jäger herzu, und der nahm sich der kleinen Wölfe an, wollte sie gern großziehen und wie Hunde abrichten. Der König selbst trug das Kind sorglich in seinen Armen und schritt mit Berchtung nach dem einsamen Turm. Der betrachtete unterwegs die Wolfsspur und sagte nachdenklich zu seinem Begleiter: „Es will mich fast bedünken, als habe die Wölfin hier irgendwo das Kind geraubt, denn die Fährte geht vom Burggraben aus.“
Die schöne Hildburg war nicht wenig verwundert, als sie von dem Abenteuer hörte und den Knaben vor sich sah, der jetzt durch Schreien sein Verlangen nach Nahrung kundtat. Der Ruf war ihr bekannt, und er glich ihrem eigenen Kind. Sie schaute unter das umhüllende Tuch und erblickte in der Tat das Muttermal, ein rosenrotes Kreuzchen, das er mit auf die Welt gebracht hatte. Nun war kein Zweifel mehr, und sie hatte Mühe, ihr mütterliches Gefühl zu verbergen. Sie erbot sich mit möglichster Ruhe, das Kind in Pflege zu nehmen, und bat nur den Vater, eilends für eine Amme zu sorgen. Das fortwährende Geschrei des Kindes ließ den alten Herrn nicht lange hier rasten. Er nahm Abschied und entfernte sich mit seinem Begleiter. Im Palast erzählte er der Königin die Begebenheit. Diese war begierig, das Wunderkind zu sehen. Sie ließ sogleich eine Amme aussuchen, in deren Begleitung sie sich zum Turm begab. Sie fand die Tochter mit dem Kleinen beschäftigt, der jetzt gesättigt die mütterliche Pflegerin anlächelte. Die Königin nahm das liebliche Kind auf den Schoß, und es lächelte auch ihr entgegen und breitete die Ärmchen aus, als wolle es sie umfassen. „Wüsste ich nur“, sagte die Frau, „wer des Knaben Mutter ist. Sie wird in großem Kummer sein.“ - „Gewiss“, versetzte Hildburg, „aber er ist fürstlicher Abkunft, das zeigt das Leinen, in welches es gehüllt war.“ - „Ich würde mich glücklich preisen“, versicherte die Königin, „könnte ich jemals ein solches Enkelchen in die Arme schließen.“ Bei diesen Worten der geliebten Mutter konnte die Tochter ihr Gefühl nicht mehr zurückhalten. Sie warf sich ihr in die Arme und gestand unter vielen Tränen, was vorgefallen war. Die Königin erschrak und zürnte, aber das Geschehene war nicht zu ändern, und der Vater des Kindes war der mächtige Kaiser der griechischen Reiche und geliebt von ihrer einzigen Tochter. Da musste Rat geschafft werden, und wurde von der klugen Frau geschafft.
Auch König Walgund fühlte sich, wie seine Ehefrau, auf unerklärliche Weise zu dem Kind hingezogen. Er kam fast täglich in den Turm und herzte seinen kleinen Schützling, der fast mit jedem Tag an Kraft und Schönheit zunahm. Da stellte ihm nun oftmals die Königin vor, wie wünschenswert es sei, wenn sie einen fürstlichen Schwiegersohn und ein solches Enkelkind hätten, und wie traurig einst ihr Alter wäre, wenn er selbst kraftlos und den Angriffen der barbarischen Nachbarn preisgegeben sein werde. Dann lenkte sie das Gespräch auf Hugdietrich, der durch neue Siege seinen Ruhm vermehrt hatte. „Wenn ich wüsste…“, sagte Walgund nachdenklich. „Warum blieb denn der edle Herzog Berchtung so lange an unserem Hofe?“, fuhr die Königin fort: „Glaube nur, eine Frau hat in solchen Dingen einen schärferen Blick als der Mann.“ Auf diese Weise bereitete die kluge Frau alles vor, und als darauf Berchtung förmlich und feierlich seinen Antrag vorbrachte, gab der König nach einigem Zögern seine Zustimmung, doch unter der ausdrücklichen Bedingung, dass Hildburg einwillige. „Das hat keine Not!“, rief die Königin erfreut und entdeckte dem Gemahl das ganze Geheimnis. Sie fügte auch noch hinzu, der Turmwächter habe eingestanden, dass er aus Furcht unzeitiger Entdeckung das Kind in den Burggraben hinabgelassen hatte, und dass es die Wölfin dort gefunden und in ihr Lager getragen habe. „Wundersam! Man sollte es nicht glauben…“, murmelte der König. - „Ganz recht“, versicherte Sabene, der listige Ratgeber und Vertraute seines Herrn, als ihm dieser das Geschehene entdeckte: „Hagedisen (Hexen) gehen als Wölfinnen um und schieben ihre Wechselbälge den Menschen unter.“ - „Und lassen sich dann vom Speer durchbohren! Das war der Einfall eines Narren, nicht des weisen Sabene.“, schloss der König die Unterredung.
Der Günstling schwieg bestürzt. Er kam aber um so mehr auf andere Gedanken, als bald nachher Hildburg ihren Turm verließ und im fürstlichen Schmuck und im Glanz der Schönheit zum ersten Mal bei Hofe erschien. Bald stellte sich auch, von Berchtung in Kenntnis gesetzt, Hugdietrich selbst mit kaiserlichem Gefolge ein, denn die Vermählung wurde zu Salnecke gefeiert. Als ihn König Walgund empfing, sagte er nach feierlicher Begrüßung: „Du hast dir, lieber Schwiegersohn, mit Nadel und Stickrahmen eine Frau und mit dem Schwert Völker und Reiche untertänig gemacht.“ - „Dafür bin ich selbst meinem gütigen Schwiegervater untertänig geworden“, versicherte der junge Held verbindlich, „und ich werde an seiner Seite stehen, wenn sich jemand gegen ihn erheben wollte.“ Die Vermählung wurde mit großer Pracht vollzogen. Dann fuhr der glückliche Kaiser heim, mit seiner schönen Gattin und dem Kind, das man zum Andenken an sein erstes Abenteuer Wolfdietrich nannte.
Im Gefolge der Kaiserin befand sich auch Sabene, den ihr der Vater als Ratgeber in das fremde Land mitgegeben hatte. Der Mann hatte viele Länder durchreist und kannte die Sitten und Gewohnheiten der Völker. Er wusste seiner Gebieterin in allen Dingen guten Rat zu geben, sich ihr nützlich und fast notwendig zu machen. Er gewann auch das Vertrauen des tüchtigen Herzogs Berchtung in so hohem Grad, dass ihn derselbe während einer Heerfahrt des Königs sogar zum Reichsverwalter vorschlug, weil er selbst genötigt war, seinen Herrn zu begleiten. Die hohe Stellung, in welche ihn die Fürsprache des Herzogs gerückt hatte, machte den falschen Mann noch kühner, und er begehrte nach der Gunst seiner Gebieterin, deren Schönheit großen Eindruck auf den Lüstling gemacht hatte. Er wagte es sogar, ihr seine unlauteren Wünsche zu entdecken. Als ihn die edle Frau mit scharfen Worten zurückwies, flehte er fußfällig, sie möge ihm verzeihen, da er sie nur auf die Probe stellen wollte. Sie möge ihm nicht den Zorn des Kaisers zuziehen, dessen treuester Diener er sei. Sie versprach es, befahl ihm aber, nicht mehr vor ihr Angesicht zu kommen.
Als Hugdietrich siegreich von seiner Heerfahrt zurückkehrte, kam ihm Sabene zuerst entgegen, stattete ihm Bericht von seiner Reichsverwaltung ab, zeigte ihm vielerlei Anlagen, die er zum Wohl des Volkes hergestellt hatte, und bemerkte ihm auch, wie zufällig, es sei einige Unruhe unter den Leuten, weil sich das Gerücht verbreitet habe, Wolfdietrich, der künftige Thronerbe, sei nicht des Königs Kind, sondern der Sohn eines Teufels oder vielleicht ein Wechselbalg einer Hagedise. Wie früher Walgund, so lachte auch Hugdietrich über das Ammenmärchen und dachte nicht mehr daran, als ihn die Königin mit offenen Armen empfing. Er nahm aber seinen Sohn aus der Aufsicht Sabenes weg und übergab ihn dem treuen Berchtung, dass er ihn mit seinen sechzehn Söhnen zu allen ritterlichen Übungen und Künsten anleite. Die Königin schenkte indessen ihrem Gemahl noch zwei Söhne, Bogen und Wachsmuth, die Berchtung gleichfalls in Beaufsichtigung und Unterweisung erhielt. Der alte Meister wandte indessen alle Sorgfalt seinem Liebling Wolfdietrich zu, und dieser übertraf seine Erwartungen, denn er wuchs ungewöhnlich kräftig heran und nahm es bei den Übungen mit allen seinen Gespielen auf. Er lernte Reiten, Speerwerfen, Schwertschwingen und auch den Messerwurf, eine Kunst der orientalischen Heiden, die Berchtung in jungen Jahren von Kaiser Anzius erlernt hatte. Es gehörte dazu eine große Gewandtheit, um durch Sprünge der mörderischen Waffe des Gegners auszuweichen, selbst aber das Körperglied und die Stelle desselben zu treffen, nach welcher man zielte. Unter solchen Übungen reifte er früh zum kräftigen Jüngling heran, so dass selbst die waffenkundigsten Männer seinem Speerwurf und Schwertstreich nicht zu bestehen vermochten. Indessen kam der vielbeschäftigte Kaiser nur selten nach Lilienporte, der stattlichen Burg zu Meran, und Hildburg wegen der weiten Entfernung noch seltener. Wolfdietrich gewöhnte sich, Berchtung als seinen Vater und dessen Gattin als seine Mutter zu betrachten. Seine Brüder Bogen und Wachsmuth dagegen waren längst wieder nach Konstantinopel zurückgekehrt, wo sich der falsche Sabene ihrer gar freundlich annahm. Ihre Mutter war darüber wenig erfreut, und weil sie irgendeine Tücke ahnte, so entdeckte sie ihrem Gemahl, was der ungetreue Diener ihr zugemutet hatte. Hugdietrichs Zorn entbrannte darüber, und kaum entging Sabene dem Tod, aber er musste eilends Stadt und Land räumen und bei seiner Sippe der Heunen Zuflucht suchen.
Hugdietrich war unter Mühen und Kämpfen früh gealtert. Als er nun in Siechtum sein Ende herannahen fühlte, ordnete er seinen letzten Willen an. Er bestimmte, sein ältester Sohn solle zunächst unter Vormundschaft seiner Mutter und Berchtung Konstantinopel nebst dem größten Teil des Reiches erhalten, die zwei jüngeren Söhne aber einige südliche Reiche. Kaum aber war das Oberhaupt im Tod verblichen und die Gruft über ihm geschlossen, so versammelten sich die Landesherren zur Beratung über die Wohlfahrt des Reiches. Sie verlangten, Sabene solle zurückgerufen werden, weil er drohte, die wilden Heunen ins Reich zu führen. Die verlassene Kaiserin konnte dem Andringen nicht widerstehen, und so eröffnete sie dem Verräter von neuem des Reiches Pforten.
Wolfdietrich und seine Dienstmänner
Sobald Sabene zurückgekehrt war, begann er wieder sein falsches Spiel. Er verbreitete unter dem Volk sein Märchen von Wolfdietrichs Abstammung. Er fügte noch hinzu, die Königin habe mit einem Teufel in heimlicher Verbindung gelebt, der sie auch fortwährend auf dem Turm besuchte und später die Wölfe gehindert habe, sein und Hildburgs Kind zu zerreißen. Das Volk prüfte die Geschichte nicht, sondern glaubte daran und verlangte, dass der Bastard in Meran bleibe. Auch die königlichen Brüder Wachsmuth und Bogen wusste der listige Mann zu gewinnen, dass sie das Gerücht glaubten und ihm die gewünschte Vollmacht erteilten. Er verfuhr nun rücksichtslos nach der Tücke seines Herzens: Er hieß die Königin den Palast verlassen und zu ihrem Bastard nach Meran ziehen. Nur eine Dienstfrau, ein Pferd und ihre Gewänder erlaubte er ihr mitzunehmen. Die reichen Schätze, die sie vom Vater ererbt, die Morgengabe ihres Gemahls, Krone und Kleinodien musste sie zurücklassen. Die königlichen Brüder taten dem Verfahren keinen Einhalt, denn Sabene stellte ihnen vor, wie ihnen nun das ganze väterliche Reich zufalle, und wie sie der Schätze bedürftig seien, um die Herrschaft gegen feindliche Angriffe von Meran her zu verteidigen. Fast wie eine Bettlerin durchzog die edle Frau wüstes Land und raue Gebirge, bis sie nach Lilienporte kam, dem Burgsitz von Herzog Berchtung.
Der alte Meister wollte ihr Anfangs keine Freistätte in seinem Haus gönnen, weil sie gegen seinen Rat den falschen Sabene wieder aufgenommen hatte. Doch überwog das Mitleid mit der unglücklichen Frau. Er führte sie in das Haus und umgab sie mit königlichen Ehren. Bald erschien sie auch im Kreis der Hausgenossen. Da standen um die fürstliche Hausfrau siebzehn kräftige junge Männer und nannten sie alle Mutter. Die Königin erkannte nicht sogleich ihren Sohn, obwohl er der größte und stattlichste unter allen war. Endlich aber sprach ihr Mutterherz, und sie eilte auf den Jüngling zu, ihn zu umarmen. Wolfdietrich wich zurück, denn auch er erkannte die Mutter nicht. Sorgen und Kummer hatten ihr Haar gebleicht, das blühende Rot von ihren Wangen gestreift, ihre Augen waren eingesunken und ihre schöne Gestalt war gebeugt, wie es sonst nur in höherem Alter geschieht. „Jungherr“, sagte der alte Meister, „es ist deine Mutter, die einst bei deiner Geburt vielen Kummer hatte und die jetzt von dir Hilfe fordert gegen den bösen Sabene und deine schlimmen Brüder.“ - „Mutter!“, rief Wolfdietrich, in ihre Arme eilend: „Du sollst Hilfe erhalten. Ich will das mir geraubte Reich wiedergewinnen und dein würdiges Haupt mit der Krone schmücken, die dir gebührt.“
Als der Freudenrausch vorüber war, saßen nach dem festlichen Mahl die Recken beim kreisenden Becher in der Halle versammelt und berieten, was zu tun sei. Der vielerfahrene Herzog riet zum Frieden, weil die Macht der Könige im Kaiserreich allzusehr überlegen sei. Im Land von Meran, meinte er, habe man Überfluss an allem, was zu einem frohen und ruhigen Leben gehöre. Und was er sein eigen nenne, darüber habe auch sein lieber Zögling und Herr zu verfügen. Darauf antwortete Wolfdietrich kühn nach der Dichtung:
„Wer gern liebt sein Gemach,
Der sucht selten fremdes Obdach.
Wer aber im Alter mit Gemach will leben,
Der muss in der Jugend nach dem Hausrat streben.
Du sollst mich dessen nicht irren, dieweil die Faust ich rege,
Ich versuche in meiner Jugend, was ich erwerben möge.
Es müssen auch meine Brüder meine Feinde sein,
Sie lassen mir denn mein Erbe und auch der Mutter mein.“
Und Berchtung antwortete:
„Ich habe nun schon lange geruht, wohl vierzig Jahr;
Jetzt soll ich mit dir haben im Alter Ungemach.
Gott wolle sich erbarmen, dass ich je mit Sabene sprach!
Gegen den will ich dir helfen und die Brüder dein,
Wenn sie das Recht dir weigern, und auch der Herrin mein.“
Der junge, hoffnungsreiche und kriegsfreudige Held ließ sich demnach nicht abraten, und als der Meister ihn daran erinnerte, dass er das Schwert erst mit vierundzwanzig Jahren empfangen könne, meinte er, er nehme es selbst, da er für sein und seiner Mutter gutes Recht fechten müsse. „Nun denn“, sagte der alte Meister, „so will ich dir dazu meine sechzehn Söhne beisteuern, jeden mit tausend auserwählten Recken in blanker Wehr, und mich selbst mit einer gleichen Zahl.“ Im Verlauf der weiteren Beratung wurde beschlossen, die Mannschaft solle sofort einberufen werden, mittlerweile aber solle der Herzog mit Wolfdietrich nach Konstantinopel gehen, um vorerst gütliche Verhandlung zu suchen und, wenn vergeblich, zum Kampf auf offenem Feld zu fordern.
Folgenden Tages in der Früh saßen beide Fürsten auf ihren Hengsten und ritten mit zahlreichem Gefolge nach der Kaiserstadt. Sie gelangten wohlbehalten an und traten alsbald zur Verhandlung mit Sabene und den Königen zusammen. Berchtung wurde ehrenvoll begrüßt, doch der junge Held, sein Begleiter, kaum beachtet. Als dieser sich erbot, sein rechtliches Erbe mit den Brüdern zu teilen, erwiderte Bogen, dem Bastard gehöre nicht eine Scholle von dem Vatererbe, und Sabene setzte hinzu, er solle sich vom Teufel, seinem Erzeuger, ein Reich in der Hölle geben lassen. Wolfdietrich griff nach dem Schwert, doch der alte Meister wehrte ihm und redete zum Frieden. Die Könige und ihr übler Ratgeber suchten ihn für sich zu gewinnen und boten ihm ansehnliche Güter, wenn er die verlorene Sache seines Schützlings aufgäbe. Als er darauf antwortete, die Treue, die er seinem rechtmäßigen Lehnsherrn schulde, sei nicht für Königreiche feil, schalt ihn der heftige Wachsmuth einen alten Ziegenbart, den er bei seinen grauen Haaren aus der Stadt zerren werde, wenn er nicht stracks zum Teufel fahre, der ihn wohl zum Vormund seines Sprösslings bestellt habe. Mühsam den Zorn bezähmend entfernte sich der Herzog mit dem Jungherrn. Sie sprangen auf ihre Rosse und ritten eilends nach Lilienporte, wo sie die aufgebotenen Recken und Knechte schon versammelt fanden.
Das Heer setzte sich schon nach wenigen Tagen in Bewegung. Es war wohlgerüstet zu Ross und zu Fuß und guten Mutes. Neben dem greisen Berchtung sah man den jungen, blühenden Helden Wolfdietrich frisch, freudig und siegesgewiss sein Schlachtross tummeln. Der unverzagte Held ritt auch voraus, als man das feindliche Land erreichte und erspähte die weit überlegene Macht der Könige, die den Kriegern von Meran entgegenrückte. In einem weiten, von Wald umschlossenen Tal wurde haltgemacht. Es war Abend, und die Streiter erquickten sich mit Speise und Trank und pflegten dann der nächtlichen Ruhe.
Der Morgenstern ging auf, und bald entstieg auch die Sonne blutrot dem Nebelmeer, das über Berge und Täler gelagert war. Die Krieger erhoben, stärkten und wappneten sich auf beiden Seiten, und auf beiden Seiten ordneten sich die Scharen um ihre Führer. „Hei, wie die Fahnen und Banner im Wind flattern! Wie die Helme im Morgenschein glänzen, wie die Hörner zum Kampf einladen, zum Siegen oder Sterben!“ So rief Wolfdietrich dem alten Meister zu, der besorgt auf die überlegene feindliche Macht blickte. Der junge Held ging im Vertrauen auf seine Kraft in den Streit wie sonst zum fröhlichen Tanz. Dazu ertönte der Schlachtgesang, von vielen tausend Kriegern gesungen, wie rollender Donner, der mächtig in den Bergen widerhallte, und dann trafen die Heere aufeinander. Wurfspeere flogen hageldicht durch die Luft und hafteten in Schilden, Rüstungen und den Leibern der Männer. Lanzen brachen, Schleudersteine schmetterten auf die Rüstungen, bald blitzten Schwerter und Streitäxte in fürchterlichem Nahgefecht. Im Getümmel des Kampfes war Wolfdietrich allen voran zu sehen. Jetzt erblickte er auf einem Hügel hinter den feindlichen Heeresmassen Sabene und die beiden Brüder. „Siehst du dort?“, rief er dem alten Berchtung zu: „Ich will versuchen, ob sie dem Teufelssohn standhalten.“ Mit diesen Worten spornte er sein edles Ross und stürmte mitten in die feindlichen Heerhaufen. Berchtung, der ihn vergebens zurückzuhalten versuchte, schloss sich ihm mit seinen Söhnen und einigem Gefolge an. Wolfdietrich kämpfte wie der Todesengel, Schrecken und Niederlage verbreitend. Die feindlichen Heerhaufen wichen entsetzt, ganze Scharen wandten sich zur Flucht, Blut und verstümmelte Leichen bezeichneten seinen Weg. Schon näherte er sich dem Hügel, auf welchem seine drei Todfeinde hielten. Schon sah er, wie auch sie eilends den Rückzug suchten. Da griff der alte Meister in die Zügel seines Hengstes und hemmte den Lauf. „Siehst du nicht?“, rief der Alte: „Wir sind umringt! Der schlaue Sabene hat einen Hinterhalt gelegt, und der ist aus den Waldhöhen hervorgebrochen. Nun ist alles verloren.“ - „Wohlan, Meister!“, erwiderte der junge Recke: „So wollen wir mit Ehren sterben.“ Er wandte sich mit seinen tapferen Begleitern rückwärts, sammelte um sich her alle, welche noch zerstreut den übermächtigen Griechen Widerstand leisteten, und führte sie in fester Ordnung ins Gefecht. Es war mörderisch, fast alle Begleiter des Helden wurden erschlagen, nur der Herzog, seine Söhne und einige andere Recken schlugen sich durch die feindliche Umzingelung. Sie wurden aber verfolgt, im fortgesetzten Kampf getrennt und von ganzen Haufen einzeln angegriffen. Sechs von den sechzehn Söhnen Berchtungs fielen unter den Schwertern und Geschossen der Griechen. Ein geschleuderter Stein traf Wolfdietrich auf den Helm, dass er bewusstlos zu Boden stürzte. Indessen gelang es dem alten Meister, sich zu ihm durchzuschlagen und ihn mit Hilfe seiner noch übrigen Söhne der Gefahr zu entreißen. Die trefflichen Pferde trugen das Häuflein glücklich von der Walstatt und aus dem Bereich der Verfolger. Sie jagten fort, die Nacht hindurch, rasteten einige Stunden am Morgen, und erreichten nach mehreren Tagen die starke Burg Lilienporte, wo sich auch noch eine ziemliche Anzahl flüchtiger Krieger sammelte. „Hier wollen wir die tückischen Hunde erwarten.“, sagte der Alte: „Sie sollen sich die Zähne an unseren Steinmauern ausbeißen und mit Hohn wieder abziehen, denn wir haben Wein und Speisevorrat auf vier Jahre.“
Nach kurzer Zeit erschien das feindliche Heer vor der starken Festung. Sabene ließ die Auslieferung des Königssohnes fordern und drohte, wenn man sie verweigere, die Burg mit allem, was darin sei, zu verbrennen. Statt der Antwort tat Wolfdietrich mit einem Teil der Besatzung einen wütenden Ausfall. Er hegte noch immer die frohe Hoffnung auf endlichen Sieg. Wie tapfer er aber kämpfte, wie großen Schaden er unter den Feinden anrichtete, so überwog doch die Menge, er musste zurückweichen und konnte kaum die nachdrängenden Belagerer vor dem Tor zurückschlagen. Seit diesem letzten Fehlschlag verlor er die bisherige jugendliche Freudigkeit. Er wurde düster und schweigsam, denn seine Zuversicht auf den Sieg der gerechten Sache war gewichen. Er hatte den Glauben an eine göttliche Gerechtigkeit verloren. Er war, so meinte er, einer finsteren Macht verfallen, die man Schicksal nennt.
Wolfdietrich und Siegminne
Bereits drei Jahre hatte die Belagerung gedauert, und noch war keine Aussicht auf irgendeine Hilfe von außen. Der Mundvorrat nahm ab, wenn sich aber der Hunger dem Feind als Bundesgenosse zugesellte, so war der Untergang der Burg und der Besatzung unabwendbar. Der alte Meister sann vergeblich auf einen Ausweg. Da trat Wolfdietrich zu ihm und sagte, er wolle in dunkler Nacht das Belagerungsheer durchbrechen, wenn es ihm gelinge, ins Lombarden-Land reiten und Ortnit, den mächtigen Kaiser des Abendlandes, zum Beistand auffordern. Der Alte widersprach und meinte, sie wollten gemeinsam ausharren, man habe noch Vorrat auf ein Jahr, und der Feind sei bereits durch Krankheiten sehr geschwächt und werde sich nicht mehr lange behaupten können. Der junge Held beharrte indessen auf seinem Vorhaben, zu dessen Ausführung er schon die nächste Nacht bestimmt hatte. Um Mitternacht nahm er dann Abschied von seinem Meister und den anderen Recken. „Gott möge dich beschützen, lieber Lehnsherr!“, sagte Berchtung, indem er ihn in die Arme schloss: „Du kommst durch die Wüste Numenei, wo keine Menschen, sondern nur reißende Tiere und spukhafte Wesen hausen. Da geht die Rauh-Else um, die vornehmlich auf junge Recken lauert. Hüte dich vor ihr, denn es ist eine zauberkundige Hagedise. Kommst du aber glücklich zu Kaiser Ortnit, dann vergiss deine elf Dienstmänner nicht, nämlich meine noch übrigen zehn Söhne und mich selbst.“ Der unverzagte Held verhieß, ihrer eingedenk, Hilfe zu schaffen. Er umarmte und küsste jeden der treuen Männer und schied von ihnen.
Nach Verabredung tat die Besatzung einen Ausfall durch das Haupttor, während Wolfdietrich, sein Pferd am Zügel führend, durch ein Hinterpförtchen schlüpfte. Er hatte schon die Mitte des Heerlagers überschritten, als er erkannt wurde. Nun schwang er sich auf seinen Hengst, zog das Schwert und hieb nieder, was ihm den Weg versperrte. Er erreichte glücklich den dunklen Wald, wo die Verfolger von ihm abließen. „Nun ist uns der Edelhirsch entronnen!“, rief Sabene, als er die Nachricht erhielt, „aber das niedere Wild, das wir noch im Garn haben, und besonders der alte Fuchs mit seinen Füchslein soll dafür büßen, und auch die Füchsin, die damals den guten Kaiser mit Zauberei bestrickt hatte.“ Der falsche Mann meinte damit Hildgund, die er so schmählich ihres Reichtums beraubt hatte. Doch die unglückliche Herrin erkrankte von der Stunde an, da ihr kühner Sohn von ihr Abschied genommen hatte, denn ihm gehörte ihre Liebe, und als er sich von ihr losriss, da brach auch ihr Mutterherz, und sie sollte den Liebling nicht wiedersehen.
Wolfdietrich ritt indessen durch die Wildnis des öden, finsteren Waldes. Er hörte in der Entfernung Geheul, wie von Wehrwölfen, doch kam ihm keiner in den Weg. Als der Morgen anbrach, befand er sich an einem breiten Moorwasser. Wie er dem finsteren Grund entlangritt, stiegen allerlei Wundertiere daraus hervor, welche ihm den Weg zu versperren suchten. Er erlegte zwei der derselben mit Wurfspeeren, und da ließen die anderen von ihm ab. Danach irrte er drei Tage in der schauerlichen Wüstenei herum, wo weder für sein Pferd Weide, noch für ihn selbst Speise zu finden war. Er teilte mit dem treuen Tier die mitgenommenen Brotvorräte, doch waren diese endlich erschöpft, und er musste das entkräftete Ross am Zügel führen. Am vierten Abend zwang ihn die Ermüdung, Rast zu halten. Er zündete ein Feuer an, wozu Reisig in Menge vorhanden war. Die Wärme tat ihm wohl, denn ein kalter Nebel war über die ganze Gegend gelagert. Auch eine frisch sprudelnde Quelle gewährte ihm und dem Hengst einige Labung. Auf den Sattel gelagert, dachte er über sein trauriges Schicksal nach. Schon wollte ihn der Schlaf beschleichen, da störte ihn ein Rauschen im dürren Laub. Es kroch heran, schwarz und grauenhaft dem Anblick, richtete sich riesenhaft und entsetzlich auf, redete ihn an, aber nicht mit einer menschlichen Stimme. Wie der Bär im Grimm ein dumpfes Brummen hören lässt, so waren die Laute, die der erschrockene Held vernahm. „Wie wagst du hier zu rasten?“, sprach das Ungetüm: „Ich bin Rauh-Else. Mir ist dieser Boden eigen, wie ich auch noch ein anderes weites Königreich habe. Darum hebe dich weg, oder ich lasse dich in den Moorsumpf versenken.“
Vor Rauh-Elsen hatte Berchtung seinen Zögling gewarnt. Er wäre daher gern dem Befehl nachgekommen, aber er fühlte sich völlig erschöpft. So bat er die bärenhafte Königin nur um einige Nahrung, da er von seinen unbarmherzigen Brüdern aus seinem Erbe vertrieben und bis in die Wüstenei schonungslos verfolgt sei. „So bist du dann Wolfdietrich!“, brummte das Bärenweib: „Das Schicksal hat dich mir zum Ehegemahl bestimmt, und ich will dir in deiner Schwäche Beistand leisten.“ Sie gab ihm hierauf eine saftige Wurzel, und kaum hatte er einen Bissen davon genommen, so fühlte er, wie der alte Mut wiederkehrte, und die Heldenkraft seine Glieder durchströmte. Es war ihm, als könne er allein das feindliche Heer durchbrechen, im Siegesflug niederwerfen und seine elf Dienstmänner befreien. Auf Geheiß der Rauh-Else reichte er auch dem Hengst die Wurzel. Er schnupperte daran herum, biss ab, und sogleich begann er zu wiehern, zu scharren und zu stampfen, wie sonst, wenn sein Herr ihn bestieg, um in die Schlacht zu sprengen. - „Sprich, willst du mich minnen und lieben?“, fragte das Bärenweib und näherte sich ihm, um ihn mit ihren Tatzen zu umschlingen. „Zurück!“, rief er, nach dem Schwert greifend: „Teufelsmutter, suche deinen Ehegenossen in der Hölle, aus der du hervorgestiegen bist!“ - „Habe ich dich nicht gelabt und gekräftigt?“, sagte Rauh-Else: „Ist das des Teufels Werk? Ich habe lange auf dich gewartet, um durch deine Liebe vom bösen Zauber zu genesen. Versage nicht dein Ja, das mir Erlösung bringt!“ - Es schien dem Recken, als ob die Stimme weich und menschlich geworden wäre. „Ja, ja“, sagte er, „wenn nur die raue Haut nicht wäre!“ Er hatte das Ja-Wort kaum gesprochen, da sank das schwarze, haarige Fließ langsam herab, und ein Menschenhaupt, ein schneeweißer Hals und ein blendender Nacken enthüllte sich, und aus der Bärenhülle stieg eine wunderschöne Jungfrau hervor. Die Stirn der Holdseligen umgab ein schimmerndes Diadem, ihre Glieder umfloss ein meergrünes Seidengewand, ein Gürtel von Goldfäden und Edelsteinen umschlang ihre schlanke Hüfte. Sie wiederholte mit wohltönender Stimme: „Sprich, junger Held, willst du mich lieben?“ Statt der Antwort schloss er sie in die Arme und feierte mit einem Kuss die Verlobung. „Wisse denn, teurer Freund“, sagte sie, „Rauh-Else war ich hier in der Wüste, solange der Zauberbann währte. Siegminne, Königin in Alt-Troja, war ich einst und bin ich nun wieder, da dein Ja den Zauber gelöst hat. Nun aber fort nach Alt-Troja, denn dort ist mein Königreich, und dort bist du König.“
Die beiden glücklichen Menschen schritten, gefolgt vom Pferd des Helden, durch die Wildnis. Der eisige Nebel war vergangen und ein geebneter Weg lag vor ihnen. Der freundliche Mond leuchtete durch die verschlungenen Zweige und erhellte ihren Pfad. Sie hörten das Brausen der Meeresbrandung und standen bald an einer weiten Bucht, wo ein wundersames Schiff vor Anker lag. Vorn war statt des Schnabels ein spitzer, riesiger Fischkopf, hinten als Steuerrad ein Meermann, dessen ausgestreckte Hand die Ruderpinne bildete, während der lange Fischschwanz zum Lenken diente. Statt der Segel führte das Fahrzeug Greifenflügel, die auch gegen Wind und Wellen die Fahrt beförderten. Auch der Meermann war so kunstreich aus Fichtenholz vom Libanon gefertigt, dass er ohne Zutun der Reisenden dahin steuerte, wohin ihr Herz gelüstete. Auf dem Schiff waren noch andere Kostbarkeiten: eine Tarnkappe, ein goldener Ring mit einem Siegstein, ein Hemd von Palmatseide und ähnliche Dinge. Das Hemd schien nur für ein kleines Kind gemacht, aber als es Siegminne dem Freund umhing, wuchs es zusehends und passte ihm vollkommen. „Bewahre es sorgfältig“, sagte sie, „trage es in jeder Gefahr, denn es schützt gegen Stahl und Stein, gegen Feuer und Drachenzahn.“
Die Reisenden fuhren mit Hilfe der Greifenflügel windschnell durch das Westmeer, das Inselmeer und landeten nach kurzer Zeit in Alt-Troja. Da empfingen die Hofleute, Bürger und Bauern ihre geliebte Königin, die ein böser Zauber ihnen geraubt hatte. Nicht minder freudig begrüßten sie den stattlichen Recken, den sie zu ihrem Gemahl erwählt hatte. Die Hochzeit wurde mit großen Festlichkeiten gefeiert, und Wolfdietrich schwamm in einem Meer von Wonne. Eine Lustbarkeit folgte der andern. An der Seite seiner schönen Gattin schwand ihm die Erinnerung an die unglücklichen Kämpfe, an die Leiden der Belagerung und selbst an seine elf Dienstmänner. Nur zuweilen, wenn er allein war, kam ihm wie im Traum das Gedächtnis zurück, und er machte sich Vorwürfe, dass er im Wonnerausch heilige Pflichten versäume. Aber wenn dann Siegminne wieder seine Hand fasste und ihn zur Tafel oder zu Spiel und Tanz führte, wenn er ihr in das strahlende Angesicht blickte, da entschwand ihm wieder die Erinnerung an seine Pflicht und den Ernst des Lebens, der zu Taten mahnte.
Einstmals rief das Horn zum fröhlichen Jagen. Jäger und Jägerinnen bestiegen die schnellen Rosse, die Jagdhunde bellten und trieben das scheue Wild auf, Hirsche, Rehe und Wildschweine wurden erlegt. Des Königs Speer verfehlte selten sein Ziel, und auch die Königin schwang mit Geschick den leichten Wurfspieß. Zur Mittagszeit war Rast unter aufgeschlagenen Zelten in einem Palmenhain. Man speiste, man leerte die Becher feurigen Weines, man plauderte, scherzte und lauschte den Weisen der Sänger und ihrem Saitenspiel. Während der heiteren Lust trabte aus dem nahen Dickicht ein wundersamer Hirsch mit goldglänzendem Geweih hervor. Er schien gar nicht scheu, besah sich die Gesellschaft und wandte sich dann wieder nach dem Wald. „Wohlauf, ihr Jagdleute!“, rief Siegminne: „Wer das Wild erlegt und mir das goldene Geweih bringt, der soll hoch in Ehren sein und einen Ring von meinem Finger zur Belohnung erhalten.“ Sogleich sprangen viele Jäger auf ihre Rosse, allen voraus aber jagte Wolfdietrich, fast den losgebundenen Hunden gleich. Immer weiter ging die wilde Jagd. Oft hatte der Held den Hirsch nah vor Augen, aber dann entschwand er ihm wieder, und endlich verloren die Jagdhunde jede Fährte. Wolfdietrich kehrte missmutig nach den Zelten um, aber da fand er Jammer und Not, denn der furchtbare und zauberkräftige Riese Drusian war in Abwesenheit des Königs und der streitbaren Jäger mit vielen bewaffneten Zwergen gekommen und hatte die Königin geraubt. Niemand wusste, wohin er sie entführt hatte.
Da stand nun der unglückliche Mann wieder so arm und elend wie damals, als er in der Wüste von Hunger und Kummer fast aufgerieben war. Er hatte keinen anderen Gedanken, als den an Siegminne. Er wollte sie durch die ganze Welt suchen und, wenn er sie nicht finde, sterben. Er vertauschte den königlichen Schmuck mit einem Pilgerkleid und verbarg sein Schwert in einem hohlen Stab, der ihm zur Stütze diente. So durchwanderte er weite Länder und forschte überall nach der Burg des Riesen Drusian. Endlich erfuhr er von einem Zwerglein, dass der Mann, den er suche, weit über dem Meer im Hochgebirge wohne und dass ihm viele Zwerge dienstbar seien. Er befragte sich genau nach dem Weg und pilgerte nun weiter, bis er ans Meer kam. Mitleidige Kauffahrer nahmen ihn mit und setzten ihn jenseits ans Land. Nun wanderte er fort auf dem bezeichneten Weg und wurde endlich im Gebirge der Burg ansichtig. Er setzte sich müde an einem Brunnen nieder und warf sehnsuchtsvolle Blicke nach dem gewaltigen Bau, der, wie er glaubte und hoffte, seine geliebte Frau umschloss. Ein Fenster wurde geöffnet, aber bald wieder geschlossen. War sie es vielleicht? Hatte sie ihn erkannt? Er hoffte und zweifelte. Vor Ermüdung schlief er ein, träumte von ihr, und war im Traum glücklich.
„Heda, Pilgrim! Hast genug geschnarcht! Sollst mit mir in mein Gehöft kommen und Fütterung kriegen. Mein Weib will dich sehen.“ So ließ sich eine raue Stimme hören, und zugleich erhielt der Pilger einen Stoß, der wohl einen Siebenschläfer aus der Ruhe aufgestört hätte. Wolfdietrich war sogleich auf den Beinen und folgte dem ungeschlachten Mann, der ihn so unsanft aufgeweckt hatte und der nun mit mächtigen Schritten vor ihm herging. Er wusste nun, dass er am Ziel seiner Wallfahrt war, und trat freudig in die weite Halle. Dort saß Siegminne mit verweinten Augen auf dem Hochsitz und starrte nach ihm hin, und ein leises Zucken verriet ihm, dass sie ihn erkannt habe. Er musste seine ganze Kraft zusammennehmen, um sich nicht zu verraten.
„He, Frau!“, schnarrte Drusian: „Da ist nun der Kuttenmann, den du gewünscht hast, damit er dich mit seinem Herrgott tröste. Und noch immer das Gewinsel! Freilich, er ist stumm wie eine Eidechse. Da, Hungerwurm!“, wandte er sich an den Pilger: „Setze dich an die Feuerseite und stärke deine ausgezehrten Glieder an unserer leckeren Kost.“ Der Pilger leistete Folge, und wie weh es ihm auch ums Herz war, der Hunger nötigte ihn zuzugreifen. Zwerge trugen die Speisen auf und schenkten den lieblichen Wein ein. Das Gespräch war eben nicht ergötzlich. Der Riese fragte den Gast, woher er komme, wohin er gehe und welches sein Gewerbe sei, und erhielt kurzen Bescheid, der freilich von der Wahrheit weit entfernt war. Gegen Abend fasste der Riese die edle Frau an der Hand und zog sie gewaltsam vom Hochsitz, indem er sagte: „Du siehst, der Teufelssohn, der dich aus dem Bärenfell erlöst hat, holt dich nicht zum zweiten Mal aus meiner Gewalt. Er fürchtet einen zerklopften Schädel. Nun ist die Jahresfrist um, die du selbst begehrt hast. Also fort in die Kammer!“ Er wollte Siegminne mit sich fortführen, aber schon hatte der Pilger die Kutte zurückgeschlagen und das dem Stab entzogene Schwert in der Hand. Mit dem Ausruf „Zurück, Unhold! Das ist meine Frau!“ stürzte er auf den Riesen zu. Dieser tat einen mächtigen Sprung rückwärts, während sich mehrere Zwerge zwischen ihn und seinen Gegner warfen. „Heda, holla, Teufel!“, rief er: „Bist du der tolle Wolfdietrich, so muss ehrliches Spiel gespielt werden. Du sollst Rüstung haben und mit mir um die Frau kämpfen, wenn du den Mut dazu hast.“
Der Zweikampf wurde angenommen, und dienstbare Zwerge brachten dem Helden drei Rüstungen zur Auswahl, eine von Gold, eine andere von Silber glänzend und eine dritte, schwer von Eisen, aber alt und rostig. Er wählte die letztere, aber nicht das gebotene Schwert, sondern sein eigenes. Auch Drusian kleidete sich in feste Stahlringe und nahm seinen schweren Streithammer zur Hand. Der Kampf begann. Wolfdietrich wich geschickt den gewichtigen Hammerschlägen seines Gegners aus, endlich aber traf ein Streich seinen Schild, dass die Trümmer wie Scherben zerstoben. Der Held schien verloren, aber einem Schlag ausweichend, fasste er sein Schwert mit beiden Händen und traf den Riesen zwischen Hals und Achsel so gewaltig, dass die scharfe Klinge bis in die Brusthöhle schnitt. Kaum war der Unhold gefallen, so stürmten seine Zwerge mit Dolchmessern und zweizinkigen Spießen auf den Sieger ein, um ihren Herrn zu rächen. Die spitzen Waffen drangen in die Ringe der Rüstung, aber das palmatseidene Hemd schützte den einsamen Kämpfer gegen Verwundung, während sein Schwert so viele der winzigen Männer zu Boden streckte, dass die übrigen eilends das Feld räumten. Im blutgetränkten Saal, an der Leiche des räuberischen Riesen, reichten sich die wiedervereinten Gatten die Hände und schlossen aufs Neue den Bund der Liebe bis in den Tod. „Nun fort aus diesem Haus des Fluches!“, rief der Held: „Man kann nicht wissen, ob das Zwergenvolk nicht auf neue Tücke sinnt.“ Sie eilten in den Hof, wo alles öde und erstorben war. Sie fanden jedoch in einem Stall zwei gesattelte Pferde, bestiegen sie und ritten durch das offene Tor ins Freie.

Nach einer beschwerlichen Reise erreichten sie wohlbehalten Alt-Troja. Im ganzen Reich wurde die Heimkehr der Königin und ihres tapferen Gemahls jubelnd gefeiert. Vornehmlich waren die Bürger der Hauptstadt freudetrunken, denn Siegminne übte als Herrscherin Recht und Gerechtigkeit und suchte des Landes Wohlfahrt mit mütterlicher Sorgfalt zu befördern. Sie war aber nach ihrer Heimkehr wie eine Rose, die der eisige Nordwind angeweht hatte, ihre Wangen wurden bleich, die Fülle und Frische ihrer Gestalt verschwanden sichtbar mit jedem Tag. Sie erfreute sich nicht mehr an Spiel und Tanz, noch zog sie hinaus zum fröhlichen Jagen. Ihre Lebhaftigkeit, ihr Scherzen und Kosen waren vergangen, und doch war sie reizend und dabei sanfter, hingebungsvoller als zuvor. Einst saß sie in traulicher Stunde Hand in Hand mit dem Helden zusammen, da sagte sie: „Wenn ich sterbe, dann ziehe wieder in dein Vaterland. Denn hier wirst du ohne mich als eingedrungener Fremdling betrachtet, und es könnte Krieg entstehen, der das Land verwüstet.“ Er hatte nur das Wort „sterben“ gehört, und das schnitt ihm in die Seele, dass er keinen anderen Gedanken fassen konnte. Dennoch bezwang er den Schmerz, wischte eine hervorquellende Träne weg und suchte die Geliebte aufzuheitern. Er verdoppelte seine Sorge, alle Pflege wurde angewendet, aber vergeblich: Der Tod hatte die Königin zur Beute erkoren. Es ist recht traurig, wenn man ein geliebtes Wesen siechen und dem Grab entgegenwanken sieht. Niemals fühlt der Mensch mehr seine Ohnmacht, als dem unerbittlichen Schicksal gegenüber. Wolfdietrich hatte im mörderischen Kampf dem furchtbaren Riesen die Gattin abgerungen, aber gegen den Tod war seine Heldenkraft nicht ausreichend. Sie starb in seinen Armen, und bald umschloss das Grab die früh verblühte Rose.
Der trauernde Held ging oft an die Stätte des Todes, weinte manche Träne, der Geliebten gedenkend, und sang:
„Schöner als Marmor, beredter als tönendes Wort,
Zieret die Träne den stillen, den einsamen Ort.
Schlinge die Perle dir in das Haar,
Wallst du, Erstandne, in der Unsterblichen Schar.“
Einstmals saß der gebeugte Held an der Grabstätte, die jetzt ein prächtiges Denkmal zierte. Er gedachte der Zeit, da aus Rauh-Else Siegminne entstanden war. Da fielen ihm auch der Entschlafenen Worte ein: „Wenn ich sterbe, dann ziehe wieder in dein Vaterland.“ Und seine Mutter und seine elf Dienstmänner kamen ihm in den Sinn. Sein Vorhaben, die Hilfe des mächtigen Kaisers Ortnit anzurufen, alle bisher versäumten Pflichten traten ihm vor die Seele, wie ernste Mahnboten zu neuer Tätigkeit. „Ich werde dich niemals vergessen, teure Frau“, sagte er für sich, „aber ich wäre deiner nicht würdig, wollte ich nicht aufbrechen, um jene zu erlösen, die mir Treue bis in den Tod bewiesen haben.“
Er tat nach seinen Worten, gürtete die Rüstung um, nahm sein gutes Schwert und bestieg sein edles Ross, das ihn mit munterem Wiehern begrüßte.
Wolfdietrich und der Messermann
Er trabte durch volkreiche Länder, wo er überall für reichliche Zahlung gute Herberge fand. Anders war es im Land der wilden Heiden, wo er oft mit Mangel, noch öfter mit Räubern zu kämpfen hatte. Nach einer mühevollen Tagesfahrt sah er abends eine Burg mit glänzenden Zinnen vor sich. Er fragte einen Wanderer nach dem Besitzer derselben, und der sagte sich bekreuzigend: „Lieber Herr, wenn ihr ein Christ seid, so reitet eilends vorüber, denn da haust der Heidenkönig Beligan, mit seiner zauberkundigen Tochter Marpilia, und der schlägt jedem Christen den Kopf ab und pflanzt ihn auf die Zinnen des Schlosses. Seht nur hin, wie oben auf den goldenen Knäufen die gebleichten Schädel grinsen. Ein Knauf ist noch frei. Hütet Euch, dass nicht Euer Haupt darauf gesteckt wird!“ Der Held versicherte, er trage einen festen Helm und stählerne Rüstung im Nacken, da müsse der Mann scharfe Messer haben, um durchzuschneiden. „Herr“, versetzte der Wanderer, „er versteht sich aufs Messerwerfen, und wenn dem stärksten Recken die Klinge im Herzen steckt, dann hilft keine Rüstung mehr.“
Der Mann ging seines Weges, und Wolfdietrich wollte gleichfalls vorüberreiten, da kam ihm aber der Burgherr mit Gefolge entgegen und lud ihn so freundlich ein, Nachtquartier bei ihm zu nehmen, dass der unverzagte Held nicht umhinkonnte, dem Gastgebot Folge zu leisten. Am Portal des Schlosses stand seine Tochter, eine schöne Jungfrau im reichsten Schmuck, und empfing den Gast mit zierlicher Rede. Sie führte ihn in die prächtige Halle, die auf beiden Seiten offen war und die Aussicht in schöne Gärten gewährte. Ein kühlender Luftzug, der hierdurch entstand, brachte immer den lieblichen Blumenduft aus den Gärten in den Saal. Mitten in der oben durchbrochenen Halle stand eine vielzweigige Linde, in der sich goldene Vögel schaukelten. Es war ein wundersames Kunstwerk, denn wenn der Wind stärker wehte, dann sangen die Vögel die schönsten Weisen. Der Held musste sich gestehen, dass kein König auf Erden so herrlich wohnte als dieses heidnische Oberhaupt. Unter der Linde standen eine reichbesetzte Tafel und ein Hochsitz für drei Personen. Die schöne Jungfrau ließ den Gast neben sich platznehmen, ihr Vater setzte sich auf die andere Seite. Da speisten und tranken nun die drei, und es kam auch die Rede auf die Herkunft des Gastes und den Zweck seiner Reise. Der Recke berichtete, er sei ein Graf aus dem Abendland, habe seine Frau verloren und wallfahre zum Heiligen Grab, um seine Sünden abzubüßen. „Also ein Christ!“, sagte der Gastgeber mit einem hämischen Lächeln: „Je nun, da kann schon hier die Buße geschehen. Wir haben gerade noch eine hauptlose Zinne.“
Der Gast begriff den Sinn der Worte, aber stellte sich ganz unbefangen und leerte den Becher aufs Wohl des Gastgebers und seiner Tochter. Als die Schlafenszeit kam, nahm Beligan seinen Gast beiseite und sagte zu ihm, er habe Gnade gefunden in den Augen seiner Tochter Marpilia. Er wolle sie ihm zur Ehe geben samt Burg und Reich, sie sei schön und eine reine Jungfrau, und er werde glücklich mit ihr leben, aber er müsse an Machmet (den Propheten Mohammed) glauben. Der Gast bat sich Bedenkzeit aus, weil er erst zu Hause vieles ordnen müsse, bevor er zur zweiten Ehe schreite. Dagegen versetzte der Heide mit seinem früheren hämischen Lächeln, er solle nur zur Ruhe gehen, da werde er eine lange Bedenkzeit haben. Zum Schluss bot er ihm noch einen vollen Becher, warf aber unbemerkt ein graues Pulver hinein. „Trinke, Freund!“, sagte er: „Da wirst du gut und lange schlafen.“ Der Held war schon im Begriff, danach zu greifen, da riss Marpilia, die wieder eingetreten war, dem Vater den Becher aus der Hand und goss das Getränk mit den Worten aus: „Nicht so, Vater, ich werde heute Nacht den Fremdling eines Besseren belehren.“ Sie nahm daraufhin den Gast freundlich am Arm und führte ihn in ein trauliches Schlafgemach, das von einer kristallenen Ampel beleuchtet war. Die Vögel in der Halle sangen Minnelieder, und die schöne Jungfrau blickte den Helden liebeverlangend an. „Edler Gast“, sagte sie, „ich habe dich einer großen Gefahr entrissen, denn mein Vater wollte dir einen betäubenden Schlaftrunk reichen, um dir dann in der Nacht mit einem scharfen Schwert den Kopf abzuschlagen, wie er schon vielen Christen getan hat. Nun biete ich dir die Hand und das väterliche Reich an, wenn du auch nur zum Schein unseren Glauben annimmst.“
Zeit und der Ort waren wohl verführerisch, aber Wolfdietrich dachte an Siegminne, und alle Frauen der Welt hätten ihm ihre Reize und Königskronen bieten können, er würde sie ausgeschlagen haben. Er verteidigte im Gegenteil seinen Glauben und versuchte, Marpilia um ihres Seelenheils willen zu bekehren. Unter solchen Gesprächen verging die Nacht.
Des Morgens kam Beligan, den Gast zum Frühstück abzuholen. Er sah die Tochter fragend an. Sie verstand ihn und sagte, er wolle nicht. „Wohlan, werter Gast“, versetzte der Heide, „so wirst du doch einen Imbiss nicht verschmähen und sodann ein Spielchen mit Messern mit mir versuchen, wie es bei uns Sitte ist. Wir stellen uns ohne andere Rüstung als einen kleinen Rundschild (Buckler) jeder auf einen Schemel und werfen uns je drei Messer zu. Ich, als der Ältere, habe die ersten drei Würfe, und dann stehe ich dir.“ Der Recke nickte bejahend, und dachte an seine elf Dienstmänner, an Meister Berchtung, der ihn einst in dieser Kunst wohl unterwiesen hatte. Er verließ sich auf seine Übung und jugendliche Gewandtheit. Sobald der Imbiss eingenommen war, ging man in den Hof, wo die Dienstmänner des Königs einen weiten Kreis schlossen. Der Held legte Rüstung und Schwert ab, empfing drei spitze, haarscharfe Dolchmesser, und der Heide stand ihm in gleicher Verfassung gegenüber. Letzterer schleuderte das erste Messer nach einem Fuß des Gegners, aber dieser vermied die Waffe durch einen geschickten Sprung. „Beim Bart des Propheten!“, rief der Heide: „Wer lehrte dich diesen Sprung? Bist du Wolfdietrich, von dem mir Unglück prophezeit wurde?“ Der Gast verneinte und stand wieder gleich einer Mauer. Der zweite Wurf schnitt ihm vom Scheitel ein Stück Haut und Haar ab, der dritte wurde vom Schild aufgefangen. Jetzt war die Reihe an dem Helden. Sein erstes Messer heftete des Gegners linken Fuß an den Schemel, das zweite streifte dessen Seite, das dritte warf er ihm mit dem Ruf „Ich bin Wolfdietrich!“ ins Herz. Der Heidenkönig lag am Boden, aber seine Dienstmänner drangen mit wütendem Geschrei auf den Helden ein.
Die drei Vordersten erlegte er mit den aufgerafften Messern, und als die anderen scheu zurückwichen, gewann er Zeit, Schwert und Schild zu ergreifen. Nun blitzte der Helmspalter in seiner starken Hand, fällte bald da, bald dort einen der anstürmenden Männer und trieb endlich die ganze Meute durch das offene Tor aus der Burg. Darauf legte er seine Rüstung an, zog sein Pferd aus dem Stall und wollte die Reise fortsetzen. Aber da wogte plötzlich ein breiter See um die Burg, und ein Sturmwind trieb die brausenden Wellen empor, dass kein Ausweg sichtbar war. Da erblickte er am Ufer des Gewässers, wie Marpilia mit einem Stab Kreise bald in der Luft, bald auf dem Boden beschrieb und geheimnisvolle Worte murmelte. Er ergriff und schwang sie vor sich auf sein Ross. „Muss ich ertrinken“, rief er, „dann soll mir die Hexe vorangehen.“ Mit diesen Worten spornte er sein Pferd in die wilden Fluten, die sich weiter und weiter gleich einem Meer ausdehnten. Er schien verloren, aber in der höchsten Not warf er das zauberische Weib vom Pferd herab, und sogleich fingen auch die Wasser an abzunehmen, der Sturm hörte auf, und er sah sich bald auf trocknem, festem Boden.
Auch Marpilia war nicht untergegangen. Im Glanz ihrer Schönheit stand sie vor ihm auf einer Höhe und breitete die Arme aus, als wolle sie ihn umfangen. Aber er drohte ihr mit gezücktem Schwert. Alsbald verwandelte sie sich in eine Elster, flog auf einen hohen Felsen und versuchte, ihn durch neuen Zauber zu umstricken. Bald sah er sich auf einer gläsernen Brücke, die unter ihm brach, bald befand er sich in einem brennenden Wald, bald von jähen Felsen eingeschlossen, bald wurde er von höllischen Hunden angefallen, während plötzlich das Tageslicht verschwand und nur die Augen der Ungeheuer wie Feuerbrände leuchteten. Er war bis zum Tode erschöpft und rief: „Hilf mir, dreieiniger Gott, ich verderbe!“ Als er diese Worte gesprochen hatte, verschwand die Hexe. Die Sonne leuchtete wieder über Berg und Tal und zeigte ihm den wohlgebahnten Weg, den er wandern musste, um das Lombarden-Land zu erreichen und Hilfe für seine Dienstmänner zu finden.
Wolfdietrich und Bramilla
Auf diesem Weg kam Wolfdietrich wieder an das Meeresufer und fand eine Hafenstadt, wo er auf ein Schiff in die Heimat wartete. Bald wurde seine Hoffnung erfüllt, und der Schnellsegler „Konstantin“ ging vor Anker. Nachdem die Reisenden, wie auch die Händler mit ihren Waren, an Land gegangen waren und das Schiff nach einigen Tagen zurückkehren wollte, ging auch Wolfdietrich an Bord, verhandelte mit dem Kapitän, und der heldenhafte Recke wurde gern aufgenommen. Am anderen Morgen, als die Sonne blutrot im Osten aufging, begann die Fahrt, der Wind war günstig, und es ging schnell voran. Auf Deck traf er einen reichen indischen Kaufmann mit seiner schönen Tochter Bramilla, und kam mit ihnen ins Gespräch. Er wunderte sich, dass sie seine Sprache verstanden. Da erzählten sie, wie christliche Priester in Indien manch königlichen Hof und hohen Adel und damit auch das Volk bekehrt hätten, so dass sie deren Sprache lernen konnten. Sie erzählten auch viel von ihrem wunderreichen Vaterland, von den köstlichen Früchten, die dort gediehen, den reichen Schätzen an Gold, Silber und Edelgestein, und wie sie sich freuten, irgendwann wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Besonders gern unterhielt sich die Tochter mit dem Recken, und wenn er die schöne Bramilla anredete, blitzten ihre dunklen Augen und verkündeten, dass er ihr liebgeworden war. Auch er war ihr gewogen, doch erinnerte er sich an seine Siegminne und dass er ihr niemals untreu werden wolle, auch wenn ihm ganz Indien und die Herrschaft über alle Reiche der Welt geboten würden.
Indessen ging die Fahrt zügig voran, und der Kapitän des Schnellseglers war frohen Mutes, dass sie bei diesem Wind in wenigen Tagen ihr Ziel erreichten. Am dritten Tag standen die Herren bei dem Steuermann und sahen zu, wie er das Fahrzeug lenkte. Da bemerkten sie, dass er plötzlich mit größter Anstrengung das Steuerrad zu bewegen versuchte. „He, Steuermann, Backbordseite!“, rief der Kapitän vom Ausguck herab, „Leewärts! Zum Henker, Steuermann, willst du gegen Wind und Wellen segeln?!“ Er glitt eilends vom Mast herunter und stürmte ganz wild zum Steuer. „Da, schaut selber zu, Kapitän“, sagte der Steuermann, „unseren Konstantin hat der Tollwurm gestochen. Er achtet das Ruder nicht einen Pfifferling und folgt seinem Tollkopf.“ - Es war in der Tat so, wie der Mann sagte. Das Schiff fuhr gegen Wind und Wellen in einer Richtung, die der bisherigen entgegengesetzt war. Der Kapitän versuchte selbst, den Lauf zu wenden, aber alle Mühe war vergeblich. „Nun mögen uns Gott und die Heiligen helfen!“, sprach er, „unser Konstantin fährt uns in des Teufels Küche.“ - „Ja, es ist des Teufels Werk“, versicherte der Steuermann, „er fährt uns an den Magnetberg. Da müssen wir ersaufen und den Greifen zum Fraß dienen.“ Bei diesen Worten des erfahrenen Mannes falteten der Kapitän und die Matrosen ihre Hände und murmelten Gebete, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. „Der leibhaftige Teufel soll mich holen, wenn ich noch einen Spruch vergessen habe.“, schloss der Kapitän seine Andacht und ging unter Deck, um sich durch eine Flasche Rum der irdischen Sorgen zu entschlagen. Mit größerem Ernst riefen Wolfdietrich und Bramilla zu Gott und flehten, dass er sie aus dieser Gefahr erretten wolle, denn menschliche Hilfe war nicht möglich.
Das Schiff fuhr inzwischen immer weiter, ungeachtet des starken Gegenwindes, in gleicher Richtung fort. Die nicht gerefften Segel zerrissen, die Planken ächzten und drohten zu brechen. Alle wussten nun, dass der Segler in den Bereich des Magnetberges gekommen war, der im Umkreis von sechzig Meilen alles Eisen, folglich auch die mit Eisen beschlagenen Schiffe anzog. Zugleich erblickte man den Berg anfangs wie einen dunklen Punkt am Horizont, dann, je näher man kam, immer höher aus dem Meer aufsteigend, bis er schwarz und gespensterhaft wie eine Halbkugel der Mannschaft vor Augen stand.
Das Schiff fuhr mit steigender Geschwindigkeit, wie vom Sturmwind getrieben, darauf zu. Bald wurden alle Eisennägel aus dem Schiffsleib gezogen, der Rest stieß an die steilen Klippen und zerbarst mit schrecklichem Krachen. Ein Jammerschrei erhob sich und verstummte wieder, denn alles war im dunklen Flutengrab versunken. Wolfdietrich konnte sich von der Rüstung und allen Waffen losmachen, die unaufhaltsam in die Tiefe gezogen wurden, und sich wieder heraufarbeiten, das Land erreichen und sich mit großer Kraft am steilen Uferrand emporschwingen. Die hochgehenden Wellen trieben auch Bramilla heran, die sich an einer Schiffsplanke festgeklammert hatte. Der Held half ihr herauf, die anderen waren alle ertrunken, auch der Vater von Bramilla. Mit einem Seil angelten sie sich einige umhertreibende Kisten und Fässer, die Lebensmittel enthielten, wodurch sie imstande waren, einige Tage ihr Leben zu fristen. Sie hielten ein trauriges Abendmahl und gedachten bei einem Sorgenbecher Wein der Toten.
Der Berg bestand aus einem einzigen Felsen, der glatt wie polierter Marmor war. Er hatte jedoch einige Spalten und Risse, aus welchen dichtes weiches Moos hervorgewachsen war. Dieses Moos diente zu Lagerstätten, und gelandete Segel, die man getrocknet hatte, zur Bedeckung gegen die empfindliche Kälte während der Nacht. Mittels der Risse konnte man auch auf den Gipfel des Berges klimmen und Rundschau halten. Man sah jedoch überall nur uferloses Meer. Bald wurden die Leichen der Menschen und Tiere von den hochgehenden Wellen an den schmalen Uferrand gespült. Da bemerkte Wolfdietrich, der immer nach einem Mittel zur Rettung aus der verzweifelten Lage umherspähte, wie jeden Morgen ungeheure Greife aus weiter Ferne daherflogen, einige von den Leichen mit ihren gewaltigen Krallen ergriffen und leicht, wie ein Habicht einen Sperling, mit sich forttrugen. Da kam ihm in den Sinn, wie vielleicht durch diese Riesenvögel ihre Rettung bewerkstelligt werden könne. Bald fanden sie auch einige Tierhäute, die auf den spitzen Klippen getrocknet waren, und Wolfdietrich schlug vor, sich in solche Felle einzunähen. Die Greife würden sie dann in ihr Nest zum Fraß für ihre Jungen tragen, und dann könne man, wenn die alten Vögel auf neuen Raub ausgeflogen seien, aus den Häuten schlüpfen und in Sicherheit gelangen. Es war ein kühner, ein verzweifelter Vorschlag, aber wenn sich kein anderer Ausweg darbietet, da wagt der Mensch das Äußerste, und oft gelingt dem Mutigen, was unmöglich schien.
Bramilla stimmte zu, denn auch sie sah keinen anderen Ausweg. Sie hüllten sich mehrfach in die herumliegenden Fetzen des dicken Segeltuchs, um gegen die gewaltigen Krallen der Vögel geschützt zu sein. Dann nähten sie sich mit Hilfe einer goldenen Nadel, die Bramilla im Haar trug, zusammen in die Tierhäute ein, lagen am Ufer und warteten in ihrer verzweifelten Lage. Bald hörten sie in der Ferne den Flügelschlag der gewaltigen Vögel. „Gott helfe uns!“, rief Wolfdietrich. „In seiner Güte und Barmherzigkeit“, ergänzte Bramilla. Ein Greif sauste heran, ergriff die Haut, die er für eine Tierleiche hielt, und flog mit Sturmesbrausen fort über das Meer. Der Flug dauerte einige Stunden, dann ließ sich der Riesenvogel mit seiner Beute im Nest nieder, wo die Jungen nach Fraß schrien. Sobald die beiden wieder den Flügelschlag des Altvogels hörten, lösten sie die Stricke ihrer Umhüllung, in der sie fast erstickt wären. Das Nest war so geräumig, wie ein mäßiges Haus, und darin saßen fünf junge Greife, die verblüfft zurückwichen, als ihre Nahrung wieder lebendig wurde. Diesen Moment nutzten die beiden, um an dem steilen Felsen hinabzuklettern, auf dem der Bau stand. Sie eilten nach einem nahen Wald, um vor den alten Greifen geschützt zu sein, und fanden daselbst ein Brünnlein, wo sie den Durst löschten und einen Teil der mitgenommenen Lebensmittel verzehrten.
Nun wanderten sie fort, dem Wald entlang, mehrere Tage. Der Speisevorrat war erschöpft, und sie mussten sich mit allerlei Wurzeln und Beeren begnügen. So gelangten sie an einen größeren Quellteich, der so reich an Fischen war, dass man sie mit den Händen fangen konnte. Desgleichen gelang es bisweilen, ein Wild mit Steinen zu erlegen, was gleichfalls dazu diente, den Tisch in der Wildnis besser zu bestellen. Aus dem Quellteich strömte ein wilder Fluss, dem sie nachfolgten und der sich bald brausend in einen tiefen Schlund ergoss, der, wie es schien, durch den ganzen vorliegenden Berg ging. Ringsherum starrte raues Gestein, senkrechte, unbesteigbare Felsen hemmten die Wanderer von allen Seiten, und von menschlichem Anbau zeigte sich keine Spur. Da war nun wieder guter Rat teuer. Und Bramilla sagte, man könne ein Floß bauen und getrost in den hohlen Berg fahren. Der Gott, der sie aus dem Schiffbruch und dem Greifennest gerettet hatte, werde sie auch glücklich durch den Berg und zu gastlichen Menschen führen. Sofort wurde rüstig Hand ans Werk gelegt. Wolfdietrich zimmerte sich notdürftig eine Steinaxt, fällte damit Bäume, behieb sie, so gut es gehen wollte, und verband sie mit Weidenruten drei und vierfach, damit das Floß beim Anprallen an den Steinwänden nicht auseinanderbreche. Am achten Tag war das seltsame Fahrzeug fertig, und die beiden bestiegen es voller Hoffnung. Das Floß schoss pfeilschnell hinunter in den Schlund, rannte bald rechts, bald links an Ecken und vorstehende Felsblöcke, obwohl sie es mit äußerster Gewalt mittels ihrer Ruderstangen zu lenken versuchten. Je weiter sie kamen, desto mehr nahm die Finsternis zu. In der Dunkelheit glitzerten Karfunkel und andere Edelsteine an den Wänden und von der Decke herab. Nach mehreren Stunden leuchtete den kühnen Schiffern der helle Tag entgegen, und sie gelangten ins Freie. Freudig begrüßten sie das rosige Licht, doch bemühten sie sich auch, aus dem reißenden Strom ans Land zu kommen.
Mit Hilfe der Ruderstangen gelang es ihnen, das Floß seitwärts zu schieben und an einem Vorsprung zu befestigen. Sie waren wiederum in einem Wald. Als sie sich aber durch das wilde, verschlungene Dickicht gewunden hatten, eröffnete sich vor ihnen eine weite Aussicht in eine Talebene, wo man wohlgebaute Dörfer, eine Stadt und eine Anzahl Landsitze erblickte. Auch bemerkte man Leute, die spazieren gingen, ritten und in prächtigen Karossen fuhren, auch emsig arbeitende Landleute mit Ackergerätschaften und Handelsleute, die ihrem Geschäft nachgingen. Alle diese Leute, wie überhaupt alle Bewohner dieser Gegend, waren zwar wohlgestaltet, aber sie hatten nicht zwei, sondern nur ein Auge, und zwar mitten auf der Stirn, das allerdings von besonderer Beschaffenheit war. Man konnte damit auf unglaubliche Entfernung sehen und selbst, wenn Berge und Wälder dazwischenlagen, noch unterscheiden, ob sich Freunde oder Feinde dem Land näherten. Die Einäugigen sollen sogar in die Köpfe und Herzen anderer geblickt und ihre geheimen Gedanken erkannt haben. Vielleicht gibt es auch heute noch Menschen, die imstande sind, mit ihren beiden Augen dasselbe zu tun.
Den Einäugigen, welche vorübergingen, waren die Fremdlinge sehr merkwürdig. Sie blieben stehen, wiesen mit Fingern auf dieselben, redeten sie in ihrer, den Wandernden unbekannten Sprache an und liefen dann zum Stadtrichter, um ihm die Wundergeschichte von zweiäugigen Menschen zu erzählen. Der Richter kam selbst, und große Haufen Neugieriger versammelten sich umher. Der Richter, ein wohldenkender Mann, der die Hilfsbedürftigkeit der Ankömmlinge erkannte, nahm sie mit in seine Wohnung, sorgte für ihre Leibespflege und gab ihnen frische Kleidung. Da sich nun das Gerücht von den merkwürdigen Menschen schnell weiterverbreitete, so ließ sie der König vor sich kommen. Er sah wohl, dass Wolfdietrich ein starker Held war, doch wollte er ihn prüfen und ließ einen wilden Streithengst vorführen. Der Ritter verstand trefflich, denselben zu führen, und wenn er heransprengte, liefen ganze Haufen von Eingeborenen auseinander. Dann sprang er sogar mitten im Galopp vom Ross ab und wieder auf, was den König sowie die anderen Zuschauer in Erstaunen setzte. Daher nahm er den Ritter in seinen Dienst, während die Königin die liebliche Bramilla bei sich behielt. Die Ankömmlinge waren auf diese Weise eingebürgert und erlernten bald die Landessprache. Da erzählte nun Wolfdietrich sein Schicksal und erfuhr dagegen, dass er sich im fernen Morgenland, und zwar im Königreich von Arimaspi befinde, dass aber die Arimaspiden von vielen Feinden bedrängt würden und mittlerweile unerschwinglichen Tribut aufbringen müssten. Der Ritter erbot sich, alle diese Feinde zu züchtigen, dass sie niemals wieder Einfälle wagen sollten, sofern ihm der König Waffen und Rüstung gebe, sowie die Ausbildung des Heeres und dessen Oberbefehl übertrage.
Das Reichsoberhaupt willigte gern ein und belehrte zugleich den neuen Kronfeldherrn, dass ein Einfall der furchtbaren Plattfüßer bevorstehe. Es seien, sagte er, Leute mit ungeheuren langen und breiten Fußsohlen, die über Hecken, Gräben, Mauern, überhaupt über alle Hindernisse hinwegspringen, bald zur Rechten, bald zur Linken angreifen und selbst auf dem Wasser laufen könnten. „Sie sollen springen wie die Heuschrecken, wenn wir sie jagen.“, meinte Wolfdietrich. Er ließ sofort für das ganze Heer Helme und große Schilde schmieden, aber weder Brünne noch Brünnehosen, da diese die schnelle Bewegung hinderten. Ferner wurden Schwerter, lange Spieße und Wurfspeere hergestellt und jeder Kriegsmann in Handhabung dieser Waffen täglich geübt. Nach einer weiteren Anordnung des Feldherrn verfertigten die Frauen künstliche Fallstricke von unzerreißbarem Hanf, die den Fuß dessen umstrickten, der darauf trat.
Als die Plattfüßer, hüpfend und springend über Berg und Täler, über Bäche und Flüsse, blitzschnell anrückten, fanden sie das Heer der Arimaspiden nicht hinter Gräben und Wällen, sondern auf offenem Feld aufgestellt. Sie sahen aber nicht die verdeckten Fallstricke, die ringsum gelegt waren. Sie schossen ihre nie fehlenden Pfeile ab, aber diese wurden mit den Eisenschilden aufgefangen. Sie schwenkten rechts und links in dichten Geschwadern, doch da fielen sie einzeln und haufenweise in die Stricke und wurden mit Schwertern und Spießen erschlagen. Tausende fanden auf diese Art ihren Tod, und das siegreiche Heer verfolgte die Flüchtlinge bis in ihr Land und zwang das ganze Volk zur Unterwerfung und Zinszahlung.
Nicht lange nachher fiel ein anderes Raubvolk in das Reich von Arimaspi ein. Es waren die Ohrlappen oder Langohren, Leute, deren Ohren so lang waren, dass sie bis über die Knöchel herabreichten, und so breit, dass sie sich ganz dahinein hüllen konnten und deshalb keiner anderen Gewänder bedurften. Sie brauchten auch keine Rüstung, da die Ohrenhaut hieb- und stichfest war. Sie rückten in zahlloser Menge und in kriegerischer Ordnung vor, vermieden die Schlingen und glaubten mit leichter Mühe die Arimaspiden überwältigen zu können. Von ihren Geschossen wurden auch viele der Gegner hingerafft. Doch diese bemerkten bald, wie sie beim Spannen der Bogen die Ohrhaut zurückschlugen, und schleuderten mit sicheren Händen ihre Speere dahin, wo eine Blöße war. Nun fielen Hunderte und Tausende, und als dadurch Unordnung unter den Ohrlappen entstand, stürmte Wolfdietrich mit der arimaspidischen Reiterei unter die verwirrten Scharen, die unter den Hufen der Rosse dahinsanken, so dass fast keiner aus der Niederlage entkam und das ganze Volk sich unterwerfen musste.
Groß war der Ruhm des Helden durch diese Taten, aber während man das Siegesfest feierte, erschien ein Bote von dem König der Enakiten oder Enakssöhne, um Zins und Tribut zu fordern. Diese Leute waren gewaltige Riesen und furchtbar, ja unbesiegbar im Kampf. Der Botschafter musste in dem gewölbten Thronsaal, wo der Arimaspidenkönig saß, gebückt stehen, weil er höher emporragte, als die Decke war. Der ungeschlachte Bursche forderte das Geld oder den Kopf des Herrschers, der vor Schrecken mit offenem Mund auf dem Thron saß und kein Wort hervorbringen konnte. Da trat Wolfdietrich vor und rief laut: „Sage deinem König, Gold und Silber hätten wir für ihn nicht, wohl aber eiserne Besen, womit wir ihn, wenn er uns besuchen wolle, säuberlich hinauskehren.“ Mit diesem Bescheid zog der Gesandte seines Weges und stattete seinem Herrn getreulich Bericht ab. Dieser schwur, er wolle den überheblichen Knirps an den höchsten Baum hängen, und befahl seinem Volk, sich zum Feldzug zu rüsten.
Wolfdietrich ordnete gleichfalls seine Scharen zur Abwehr des furchtbaren Feindes. Nach seiner Angabe richtete man große Bärenfallen her, deren scharfgeschliffene Bügel beim Zusammenklappen alle Gliedmaßen, die dazwischenkamen, bis auf die Knochen durchschnitten. Diese Fallen stellte man vor einem Wald auf, an dessen Saum das Heer lagerte. Außerdem wurden Fallgruben gegraben, auf deren Boden spitze Pfähle emporstarrten. Die Enakssöhne stürmten wild, ohne Ordnung mit ihren Eisenkeulen auf das Heer los, traten zum Teil in die Fallen oder stürzten in die Gruben, wo sie sich auf die Pfähle spießten. Die Verwundeten erhoben ein grässliches Geheul, aber jene, welche bis an den Wald gelangten, zerschlugen Büsche und Bäume und fällten viele Arimaspiden, doch wurden auch von geschleuderten Speeren getroffen oder von gewandten Kriegern mit Schwertern an den Beinen verwundet. Auch hier entschied Wolfdietrich mit seinem Heer den Kampf. Er selbst schleuderte seine Speere stets mit Erfolg, durchbohrte die Feinde mit langen Spießen und richtete eine solche Niederlage an, dass der Rest der Enakiten in wilder Flucht davonrannte. Sie halfen nicht einmal ihrem König, der mit einem Bein in einer Falle steckte. Da kam nun der verachtete Knirps und schwang das blanke Schwert über seinem Haupt. Doch er konnte den wehrlosen Mann nicht fällen, sondern nahm ihn gefangen und überlieferte ihn König Arimaspi, dem der dankbare Enak-König nach seiner Heilung den Treueeid schwur und hielt.
So stand Wolfdietrich bei allem Volk hoch in Ehren, und der König gab ihm eine Burg mit Stadt und Dörfern. Dennoch sehnte er sich nach der Heimat, nach Menschen seines Stammes, und gedachte seiner elf Dienstmannen, die er doch befreien wollte. Wenn er die einäugigen Männer oder auch schön gebildeten Frauen vor sich sah, erschrak er oft wie vor Wesen aus einer anderen Welt. Auch Bramilla schien von ähnlichen Gefühlen bewegt zu sein. Sie wurde von Tag zu Tag ernster und trauriger und verhehlte nicht, dass es ihr in diesem Reich oft unheimlich zumute war.
Einstmals strömte das Volk an die Küste, denn da hatte ein fremdes Schiff Anker geworfen, was noch niemals geschehen war. Man glaubte, ein seltsam gebautes Haus sei auf dem Wasser hergeschwommen, und, was noch mehr in Erstaunen setzte, in dem Bau waren lauter zweiäugige Menschen. Es waren Handelsleute, die des Gewinnes wegen ihre Fahrt in die noch unbekannten Gewässer gelenkt hatten und nun ihre seltenen und kostbaren Waren ausbreiteten. Da gab es Gewänder von Samt und Seide in allen Farben, kunstreiche Schmucksachen, nützliche Gerätschaften und scharfe Waffen, künstliche Blumen, Gewürze und andere Dinge. Die Eingeborenen zahlten mit Goldstaub, der zugewogen wurde, oft auch mit Edelsteinen. Die Königin selbst begab sich mit ihrem Gefolge auf das schwimmende Haus und kaufte, was ihr gefiel. Bramilla, die bei der Herrin war, beschaute sehnsüchtig das Schiff und erinnerte sich an ihr Heimatland. Am Abend sprach sie mit Wolfdietrich, und der verbabredete mit dem Kapitän in drei Tagen eine heimliche Flucht, weil der König der Arimaspiden dessen Abschied verständlicherweise verweigerte. So waren Wolfdietrich und Bramilla voller Hoffnung, um so mehr, als sie erfahren hatten, dass die Schiffsreise weiter nach Jerusalem ging, in die Heilige Stadt. Des Nachts wurde das Gepäck auf das Schiff gebracht, und zur festgesetzten Stunde befanden sich beide an Bord. Günstiger Wind schwellte die Segel, und die Fahrt wurde dadurch so gefördert, dass am Morgen nur noch die Bergesgipfel des verlassenen Landes sichtbar waren.
Nach einigen Tagen glücklicher Reise sahen sie die Gottesstadt mit ihren Zinnen und Heiligtümern vor sich liegen. Hier war der Welterlöser gewandelt und am Kreuz für seine Menschenbrüder gestorben, und hier waren die frommen Pilger gewürdigt, in das Gotteshaus einzutreten und am Heiligen Grab zu beten. Sie taten es mit Andacht und opferten reiche Gaben von ihren Schätzen. Nachdem sie alle Gebote erfüllt, das heilige Mahl und die Absolution empfangen hatten, schloss sich Wolfdietrich einer Gruppe von pilgernden Rittern an, die sich zum Kampf gegen die Ungläubigen verpflichtet hatten. Er selbst stritt in allen Gefechten voran, und hauptsächlich mit seiner Hilfe wurden die Heiden weit in die Wüste zurückgeschlagen. Doch da rückte der Sultan mit seinem übermächtigen Heer an. Sie umkreisten die Gegner, schossen Wolken von Pfeilen ab und setzten das Gefecht tagelang fort, bis sie die meisten Ritter erlegt und die Überlebenden gefangengenommen hatten.
Die Gefangenen wurden als Sklaven des Sultans verpflichtet, der gerade auf sandigem Grund einen Palast bauen ließ und deshalb viele Arbeiter nötig hatte. In der Nähe standen noch zwei andere Prachtbauten, der dritte sollte den Abschluss bilden. Nun mussten die Sklaven fast Tag und Nacht schaffen, und es wurden ihnen nur wenige Stunden der Ruhe gegönnt. Wolfdietrich, der das Schwert und nicht Hacke und Spaten zu führen gewohnt war, arbeitete mit Unlust und Ungeschick. Der Sklavenaufseher begnügte sich geraume Zeit mit Schmähen und Schelten, endlich aber griff er zu dem gewöhnlichen Mittel, dem Bambus. Kaum jedoch berührte der Stock den Rücken des Recken, so entbrannte dessen Zorn. Er griff den Peiniger mit starker Faust und warf ihn unter dem Jubel und Hohngelächter der anderen Sklaven kopfüber in die Grube.
Das war nun auch sein Todesurteil, das der Sultan persönlich verhängte. Am Tag seiner Hinrichtung am Galgen wurde Wolfdietrich gebunden vom Henkersknecht vorgeführt. Er blickte traurig auf sein Leben zurück, erinnerte sich an Vater und Mutter, an Siegminne und an Berchtung mit seinen Söhnen, die wohl immer noch auf ihn warteten. Alle seine Abenteuer gingen wie Traumbilder an ihm vorüber. Dann stand die schauerliche Wirklichkeit vor ihm, keine Heldenkraft konnte die Bande lösen, und kein Freund war zur Hilfe bereit. Der Sultan hatte sich mit seinem Gefolge versammelt, um den Befehl zur Hinrichtung zu geben. Da erschien eine verschleierte Sängerin in orientalischer Tracht mit einer Harfe in der Hand vor dem Galgen, und alle lauschten auf das Saitenspiel, der zum Tode Verurteilte, wie auch jene, die sich des Lebens erfreuen wollten. Dann ließ sie den Schleier vom Gesicht fallen und sang mit Tränen in den Augen ein Lied, das allen zu Herzen ging:
„Zu Allahs Bilde wurde der Mensch geboren;
Allah erschuf nach seinem Bilde ihn;
Dann hat er die Genossin ihm erkoren,
Die liebende, die er mit Reiz beliehn.
Wenn sie den Schwur der Liebe ihm geschworen,
Wenn er, mit ihr vereint, ganz glücklich schien,
Dann spiegelte sich mit allen ihren Wonnen
Der Erde höchste Lust im Liebesbrunnen.
Allah verzeiht, im Zorn, in seinen Wettern,
Vertilgt er nicht, die seinen Namen schmähn:
Nein, Wohltat reicht er dar, statt zu zerschmettern,
Bis zur Erkenntnis sie vom Wahne auferstehn.
Ihm gleiche, Sohn der Erde, und Übeltätern,
Die dich mit Hass und blutigem Vergehen
Verfolgen, biete mit versöhntem Herzen
Der Wohltat Brot, die Hand in ihren Schmerzen.
Das ist der Sieg, den Allah dem Gerechten
Hat verheißen! Liebestat bezwingt den Feind,
Wird seinen Trotz, den Wahn des Hasses knechten,
Dass er beschämt zu deinen Füßen weint.
Nicht Erdenlust in liebebrünstigen Nächten,
Nicht Sternenglanz, mit der Reue erscheint
In seiner Träne ein schöneres Gnadenzeichen,
Des Allerbarmers Bild, des Gnadenreichen. “
„Des Gnadenreichen“, das Wort klang noch einmal im Mund der Sängerin, und die Saiten wiederholten die Melodie allmählich anschwellend und wieder leise verhallend, wie die Töne der Äolsharfe aus ferner Welt, und der Wahrheit Lehre senkte sich wie Gold in die Herzen der Hörer. Lautlos saßen die Herrscher, kein Wort des Beifalls wurde gehört, aber die tiefe Stille zeugte von der Töne Macht.
Darauf, als sich allmählich der Zauber löste, der wie im Rausch die Sinne umfing, erhob sich der gelehrte Wesir des Sultans und sprach: „Mich dünkt, ein Bote aus des Teufels Flammenreich ist hierhergekommen in verlockender Gestalt, um die Kämpfer des Propheten zu berücken, dass ihren starken Händen das Schwert des Glaubens entsinke. Es sind die Lehren der Nazarener, die er verkündigt, nicht die des Korans, der uns befiehlt, die Feinde der heiligen Kaaba bis an das Ende der Erde zu verfolgen und zu vertilgen. Darum ergreife man die verführerische Sängerin und stelle sie zu dem verurteilten Verräter, dass sie mit ihm für ihren Frevel büße!“ — Doch der Sultan erwiderte ihm mit tiefem Ernst: „Höre auf mein Wort! Ich will mit dem Dichter zu dir sprechen:
Gleichwie den süßen, duftigen Honigkelch
Schneeweiß umhegt der Lilie lichte Krone,
So umblüht ein greiser Bart die Quelle,
Daraus die Weisheit vieler Jahre strömt.
Du aber“, fuhr er fort, zum Wesir zu sprechen, „hast der Sängerin goldenes Wort in unreines Erz verkehrt, und Torheit quillt nun unter deinem grauen Bart hervor. Sieh, wie ein kühler Brunnen den Wanderer in der Wüste labt, so hat mich der Gesang erquickt, und wenn ein Christ, ja selbst der Teufel mir das Wort der Wahrheit brächte, so spräche ich: Es wurde aus Allahs Mund empfangen und glänzt schöner als der schönste Diamant in meiner Krone.“ Darauf wandte er sich zur Sängerin: „Schöne Dame, begehre, was dein Herz erfreut. Der höchste Preis, und wäre es einer meiner Diamanten - beim Haupt des Propheten - er soll dir gehören.“ Und wieder griff die Schöne in die Saiten und sang:
„Groß und herrlich sind deine Siegesehren,
Oh Herr, und deine Weisheit preist die Welt;
Doch willst den Kranz des Ruhmes du vermehren,
Die Gnade flicht hinein. Den zur Nacht gefällt
Dein Schwert, den Ketten hart beschweren
Und Todesgraun, richte auf, ruhmvoller Held!
In Freiheit lass ihn froh den Anker lichten
Heimwärts, so gebietet Allah zu richten.“

Die Harfenspielerin hatte geendigt, stand schüchtern vor der Versammlung, die Arme über die Brust gekreuzt, wie zum Gebet nach mohammedanischer Sitte, während ihr Träne um Träne über die blühenden Wangen rann. „Du forderst viel.“, sprach der Herrscher mild: „So soll das unerbittliche Recht gebeugt werden um deinetwillen, denn ich habe mein Wort gegeben, und das muss ich halten.“ Ein dumpfes Murren ging durch die Versammlung, und der Wesir wagte laute Rede: „Wie denn, Herr? Den blutbesudelten Verbrecher, den Verächter des Propheten willst du gerechtem Urteilsspruch entziehen? Hab acht, dass nicht des Islams Pfeiler wanken! Und mit dem Islam auch die Feste unseres Reiches! Wenn du die ungläubigen Hochverräter begnadigst, wer wird künftig den Aufruhr dämpfen, der bald da, bald dort sein Haupt erhebt?“ - „Sieh her!“, rief der gewaltige Herrscher, und der blanke Säbel, aus der Scheide gezogen, blitzte in seiner Hand: „Der bezwingt den Aufruhr und den Widerspruch, wo und wie er sich erhebt. Das Recht der Gnade übe ich jetzt, um mein verpfändetes Wort zu lösen. Man gebe dem Gefangenen die Freiheit, dazu hundert Byzantiner und einen Geleitbrief, so dass er sicher in sein Vaterland gelangen kann.“ Niemand wagte mehr Einspruch, tiefe Stille trat ein, nur unterbrochen vom Saitenspiel und der Spielerin Lied, das mit den Worten schloss:
„Wir preisen hoch den Stern im Morgenland,
Durch Allahs Huld den Gläubigen gesandt.“
Die Fesseln wurden gelöst, Wolfdietrich war frei, empfing die Gaben des Sultans und ging hinab zum Hafen. Schon längst hatte er erkannt, dass die Sängerin Bramilla war, die ihm das Leben gerettet hatte, und diese traf er auch am Hafen. Sie umarmten sich lange, und schließlich sprach Bramilla: „Sei gesegnet, großer Held, und kehre nun glücklich in dein Vaterland zurück! Ich habe ein Schiff mit Kaufleuten nach Indien gefunden, und werde zu meiner Familie fahren.“ Sie überreichte ihm eine kostbare Perlenschnur zum Andenken, drückte einen Kuss auf seine Lippen und eilte weinend, ohne sich umzusehen, fort auf das Schiff nach Indien. Wolfdietrich sah ihr lange nach, wie das Fahrzeug die Anker lichtete und langsam am Horizont in der Weite des Meeres verschwand. Er war traurig, trotz seiner gewonnenen Freiheit, die Träne floss und der Abschied schmerzte wie der Tod seiner geliebten Siegminne. Doch dann schaute er sich um, gedachte seiner Heimat, fand bald darauf mit dem Geld des Sultans ein schnelles Schiff, das ihn aufnahm, und mit seinem Geleitbrief erreichte er sicher das hochersehnte Ziel.
Die Geschichte von Kaiser Ortnit
So gelangte Wolfdietrich unter mancherlei Abenteuern zu Land und zu Wasser nach Sizilien, wo ihn König Marsilian, ein Verwandter seiner Mutter Hildburg, gastlich aufnahm. Er war gänzlich abgerissen an Gewandung, aber von dem Gastfreund erhielt er nicht nur freundliche Leibespflege, sondern auch stattliche neue Kleider und ein Boot, das ihn über das Meer an das Festland trug. Im wilden Gebirge trat ihm ein Riesenweib von unholder Gestalt entgegen. Sie war aber seinem Vater Hugdietrich befreundet gewesen, und als er ihr von seinen Erlebnissen berichtete, war sie bereit, seine weitere Reise zu fördern. Sie bewirtete ihn reichlich, und als sie erfuhr, dass er die Hilfe von Kaiser Ortnit suchte, setzten sie sich auf einen Felsen, und dort erzählte sie ihm die ganze Geschichte, welches traurige Schicksal Ortnit und die arme Liebgart getroffen hatte:
Der gewaltige König Ortnit herrschte früher im Land der Lombarden. Danach hatte er seine Macht über ganz Welschland (Italien) vom Gebirge bis an das Meer und über Sizilien ausgebreitet, und auch noch andere Könige in der Nähe und Ferne sich untertänig gemacht, denn er besaß Zwölfmännerstärke und blieb in allen Schlachten Sieger. Dennoch war er nicht zufrieden, eine innere Unruhe vergällte ihm das Mahl und den köstlichen Trank im goldenen Becher. So saß er oft träumerisch an der vollen Tafel und hörte kaum zu, wenn seine Helden und Lehnsleute von den siegreichen Schlachten redeten, oder wenn der Sänger im begeisterten Lied seine Taten rühmte. Oft stand er am Meeresstrand und sah dem Spiel der Wellen zu, die vom Abendrot beleuchtet ihre glänzenden Bahnen zogen und dann in die Tiefe versanken. Da stieg eines Tages aus dem Gewässer vor seinen Augen ein Nebel auf, der sich wie ein Schleier auseinanderteilte und ein wunderbares Bild sehen ließ: Es war eine Burg mit Türmen und Zinnen, und auf einem Söller stand vom Abendsonnengold beleuchtet ein Frauenbild, wie er es auf allen seinen Fahrten niemals gesehen hatte. Er konnte den Blick von der Erscheinung nicht abwenden und war wie vom Zauber gebannt. Aber der Nebel zog sich allmählich wieder dichter zusammen, das Wunderbild zerrann.
Wie Ortnit noch unverwandt nach der Stelle hinstarrte, wo die Erscheinung verschwunden war, hörte er ein Geräusch hinter sich. „Sie ist es selbst und will mich beglücken!“, dachte er, kehrte sich um, schloss seine Arme und küsste den bärtigen Yljas, den Fürsten der wilden Reußen, seinen Oheim, der Umarmung und Kuss kräftig erwiderte. „He!“, sagte er, „Bist ein herzlicher Junge! Empfängst den Bruder deiner Mutter, wie ein Liebhaber sein süßes Lieb! Du hast wohl dem Hexenspuk dort auf dem Wasser ins Angesicht geschaut, und das hat dir ein bissel den Kopf verwirrt. Schlage dir das Meerwunder aus dem Sinn, denn es könnte sonst leicht dazu kommen, dass dein königliches Haupt auf eine Zinne von Montabur aufgepflanzt würde, wo die schöne Hexe mit ihrem heidnischen Vater wohnt.“ - „Sie lebt!?“, rief Ortnit heftig: „Dann muss sie mein werden, oder ich will Leib und Leben verlieren.“ - „Hei, lustig, ihr Fiedler!“, versetzte Yljas: „Ein Königskopf für einen Weiberzopf! Das gibt ein neues Lied, das man in ganz Lombardenland singen wird.“ - „Was meinst du damit?“, fragte der König: „Berichte mir die Geschichte der Spielmänner!“ - „He, Neffe!“, erwiderte der Reuße: „Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Es ist kein Spielmannsmärchen, was ich dir jetzt berichte: Machorel, der mächtige Beherrscher von Syrien und noch anderen Reichen im Morgenland, ist der Vater jener wundervollen Jungfrau. Als ich auf meiner Pilgerfahrt nach dem Heiligen Grab schier verschmachtet an das Tor der Burg Montabur gelangte, verschaffte mir ein mitleidiger Sarazene („Morgenländer“) Einlass und leibliche Pflege. Da sah ich nun den schrecklichen Heiden, der schwarz wie ein Mohr ist, und auch die schöne Jungfrau Sidrat. Desgleichen hörte ich, er lasse jedem Freier ohne Erbarmen den Kopf abschlagen, weil er die Tochter stets in seiner Nähe haben wolle. Zweiundsiebzig Häupter grinsten bereits hohläugig von den Zinnen herab. He, kühner Neffe, trägst du Gelüste, das deinige als das dreiundsiebzigste dem Mohrenkönig darzubieten?“ - „Manch seltsames Abenteuer habe ich schon bestanden“, erwiderte Ortnit, „so will ich es auch mit dem Heiden versuchen.“
Und das Riesenweib erzählte weiter:
Gleich am folgenden Tag berief der König die Lehnsträger des Reiches zusammen und erklärte seinen Wunsch, eine Heerfahrt über das Meer nach Syrien zu unternehmen. Yljas brachte seine Einwände vor und schilderte die Gefahren, worauf andere meinten, der König könne sich doch eine geziemende Ehefrau unter den Fürstentöchtern des Landes wählen. Aber Ortnit beharrte auf seinen Entschluss. Er berichtete von dem Vorhaben Machorels, und wie es unsterblichen Ruhm und ewiges Heil bringe, wenn man das Oberhaupt der Heidenschaft samt seinem Volk zum Christentum bekehre. Die königlichen Worte überwanden mit siegender Gewalt alle kleinlichen Bedenken, und alle Fürsten waren bereit, ihm zu folgen, was den König erfreute. Doch er bat sie, von der Fahrt abzustehen, weil sie inzwischen die Burgen und Städte beschützen sollten, und insbesondere auch seine geliebte Mutter. Da rief Yljas, der Fürst der Reußen: „Beim heiligen Nikolas! Wenn du deinen Tollkopf auf die Zinne von Montabur tragen willst, Neffe Ortnit, dann bleibe ich nicht zurück. Mit fünftausend Recken in blanker Rüstung sollst du mich bereit finden, auch wenn mein eigener Kopf am Giebel von Montabur als Vogelscheuche aufgesteckt wird.“ So war die Fahrt beschlossen, und Zacharis, der Herr von Pullien (Apulien) und Sizilien, der zwar ein heidnischer Mann war, aber der treueste Wehrgenosse des Königs, erbot sich, dafür zwölf Schiffe mit Speise und Trank auf Jahre hinaus auszurüsten und mit Kaufgut von goldbesticktem Gewand und Samt und Seide reichlich zu beladen. „Wohl, vielgetreuer Heide“, sprach der König, „du gehörst in den Kreis der Edlen des Reiches, auch wenn du die christliche Taufe nicht empfangen hast. Nun lasst die Werbung in allen Landen geschehen. Ich habe Schätze genug, um wohl hunderttausenden Sold zu zahlen. Seht dort den festen Turm mit eisernen Pforten! Er ist vom Boden bis zum Dach mit Gold und Silber und manchem Kleinod angefüllt. Wohlauf, in wenig Wochen sind wir alle zur Reise fertig.“ - „Ja, ja, guter Neffe“, sagte Yljas, „da wäre die Reise schnell getan, doch Sturmriesen werden alsbald die Schiffe umwerfen, und Meerammen uns zur Hochzeit laden. Der Herbst hat schon begonnen, und wir müssen die Fahrt bis zum Frühling verschieben. Wenn im schönen Mai die Quellen rieseln und die Blumen blühen, dann besteigen wir unter Vogelgesang die Schiffe.“ Da gegen den Rat des erfahrenen Mannes kein Einwand erfolgte, wurde es so beschlossen.
König Ortnit blieb auf Burg Garden mit seiner Ungeduld allein zurück. Wohl stellte ihm seine verständige Mutter wiederholt die Gefahren der Fahrt vor. Sie meinte auch, es sei misslich, eine Jungfrau zu begehren, die man nur wie im Traum gesehen hat, von deren Gemütsart man gar keine Kenntnis habe. Sie könne wohl eine böse Schlange sein, die das Leben vergifte. Das alles brachte ihn von seinem Entschluss nicht ab. Er hatte keine Ruhe mehr, als der Gesang der Lerchen den nahenden Frühling verkündigte. Es zog ihn hinaus in die wilden Berge, und er wünschte irgendein verwegenes Abenteuer, um in Kampf und Gefahr seinen Unmut zu vergessen. So trat er eines Tages gerüstet zu seiner Mutter, um sich auf kurze Zeit zu verabschieden. - „Kannst du denn nimmer ruhen, nimmer Frieden finden, mein lieber Sohn?“, fragte die sorgende Frau: „Ich fürchte, ich verliere dich früher als deinen Vater, und ich habe dann niemanden, der mich recht von Herzen liebt und mich in meinem Alter tröstet. Dein Oheim Yljas ist wohl mein Bruder und ein treuer Mann, aber wild und trotzig, wie das Volk der Reußen. Bleibe hier bei mir im schönen Schloss Garden! Da kannst du jagen oder im See fischen und friedlich deines königlichen Amtes als König der Völker walten. Entschlage dich der Heerfahrt und der Abenteuer, da du schon in jungen Jahren der Lorbeeren viele auf blutigen Schlachtfeldern gewonnen hast. Bald stehen die Auen in grüner Pracht, da ist es gar lieblich im Lombardenland.“ - „Lieb Mütterchen“, sagte er schmeichelnd, „bleibe mir hold und gewogen. Ich sitze noch immer gern, wie früher als Knabe, zu deinen Knien und spiele mit deinen beringten Fingern, aber ich kann doch nicht mehr Tage und Stunden verträumen. Es ist mir, als müsse ich hinaus in die fremde Welt, in Kampf und Streit. Mich dünkt, ich würde hier vor Unruhe sterben. Gib mir noch einmal deine liebe Hand, und nun lebe wohl, ich kehre bald zurück.“ - „So nimm nun diesen Fingerring“, sagte die Frau, „das Gold ist von geringem Wert und der Stein unscheinbar, aber ein Zauber ist darin beschlossen, den man nicht um ein Königreich kaufen könnte. Dann reite getrost in das wilde Gebirge, zuerst den Weg links über die Höhen bis an den See, dann seitwärts an der hohen Steinwand entlang und weiter zu Tal, wo ein Brünnlein aus dem Felsen hervorquillt. Dort wirst du an eine mächtige Linde gelangen und ein großes, nie geahntes Wunder erfahren.“ Ihre Stimme stockte vor innerer Aufregung. Er hätte gern mehr erfragt, aber ihre tränenden Augen schienen ihn anzuflehen, er solle nicht weiter forschen.
Als er in den Hof kam und sein gutes Streitross bestieg, umringten ihn die Dienstmänner, alle wohl gerüstet. Sie wollten den lieben Herrn in das wilde Gebirge begleiten, aber er lehnte ihre Hilfe ab und schlug gedankenvoll die bezeichnete Richtung ein. Die frische, kühle Luft verscheuchte bald die Grillen. Er ritt fröhlich fort, obgleich der Abend schon hereinbrach und der Weg sich im Wald verlor. Wegen der starrenden Baumäste musste er endlich absteigen und das Pferd am Zügel führen. Das war nun sehr beschwerlich, um so mehr, als die Dunkelheit überhandnahm. Er konnte sich nur nach den hier und da durchschimmernden Sternen richten. Nach mühsamer Wanderung erreichte er endlich den Ausgang des Waldes, eben als der Morgen aufdämmerte. Das heitere Morgenrot bestrahlte die Gipfel der Berge und spiegelte sich im wallenden See, der sich vor dem Wanderer ausbreitete. Der kühne Held verzehrte einen Imbiss, den er bei sich führte, während der Hengst im frischen Gras weidete. Darauf schlug er wieder den Weg nach dem Gebirge ein und erreichte endlich die Steinwand, von der ihm die Mutter gesagt hatte. Er schritt ihr entlang, bis er das Brünnlein rauschen hörte und bald auch, um einen Vorsprung biegend, die Linde vor sich sah. Es war ein mächtiger, majestätischer Baum und schon in der frühen Jahreszeit ganz grün und voller Blüten, die würzigen Wohlgeruch hauchten. Er stand auf einer weiten Aue, wo Gras und Klee, von roten, weißen, blauen und goldglänzenden Blumen übersäet, üppig hervorsprossen. Im Gezweig des weitschattenden Baumes hüpften und nisteten viele befiederte Sänger, die, so schien es, den Wanderer mit hundert- und tausendstimmigem Getön begrüßten. Es war dem König seltsam zumute, denn er meinte, er habe das alles schon in früher Kinderzeit gesehen.
Wie er noch darüber nachsann, fiel sein Blick auf den von der Mutter empfangenen Ring. Der darin befindliche Stein glänzte jetzt wie loderndes Feuer und beleuchtete ein liebliches Kind, das vor ihm unter Blumen lächelnd schlummerte. „Armer Knabe“, sagte der königliche Held mitleidig, „wer hat dich hierher in die Wildnis gebracht? Wie wird deine Mutter in Sorgen um dich sein! Aber ich darf dich nicht hier zurücklassen. Du würdest vor Hunger umkommen oder eine Beute der wilden Tiere werden.“

Er hatte schon vorher sein Pferd an einen Baumast gebunden und hob nun den Knaben auf, um ihn dorthin zu tragen, aber er erhielt plötzlich einen so gewaltigen Stoß auf die Brust, dass er nicht bloß das Kind fallenließ, sondern fast rückwärts zu Boden getaumelt wäre. Er hatte kaum wieder festen Fuß gefasst, so fühlte er sich von dem Knaben umschlungen, und er musste seine ganze Kraft aufbieten, um nicht zu Fall zu kommen. Es begann nun ein wütender Ringkampf zwischen dem großen, stattlichen König und dem wunderbaren Knaben. Blumen und Gräser wurden niedergetreten, Büsche und Sträucher zerstampft. Endlich brachte Ortnit den unscheinbaren Gegner unter sich und zückte im auflodernden Zorn sein Schwert, um ihn zu durchbohren. Er konnte aber den Streich nicht ausführen, denn der Kleine sah ihn flehend an und bat ihn mit sanfter, schmeichelnder Stimme, er möge ihn, den Wehrlosen, nicht ermorden, sondern Buße annehmen. Dann erbot er sich, für die Auslösung seines Lebens wertvolles Rüstzeug zu liefern, nämlich Helm, Schild und Brünne, glänzend von Silber und Gold, und das Schwert Rosen, der Zwerge Werk, gehärtet in Drachenblut. Der König forderte Bürgschaft, aber der Kleine versicherte ihm, in der einsamen Wildnis sei kein Bürge zu finden. Er könne sich auf seine Treue, auf sein gegebenes Wort verlassen, denn auch er sei ein König über ein weit größeres Reich als das Lombardenland. Es liege jedoch nicht auf, sondern unter der Erde, wo seine Untertanen Tag und Nacht auf Erz, Gold und Silber schürften, Waffen und Kleinodien mit kunstfertigen Händen schmiedeten. Da keine Bürgschaft zu beschaffen war, ließ endlich der Held seinen Gefangenen aufstehen. Ehe sich derselbe aufmachte, die verheißenen Gaben zu beschaffen, bat er ihn um den schmalen Fingerring an seiner Hand, der ihm, wie er meinte, ohne Wert und Nutzen sei. „Das Fingerringlein erhältst du nimmer!“, sagte Ortnit: „Es ist ein Geschenk von meiner vielgeliebten Mutter, die mir niemals wieder hold würde, wenn ich es von mir ließe.“ - „Hei, du kühner Held!“, spottete der Kleine: „Fürchtest der Mutter Rutenstreiche?! Wie könntest du im Kampf Schwertwunden ertragen?“ - „Würde mir auch der Leib von Schwertern zerhauen“, versetzte der Lombarde, „so schmerzte es mich nicht so sehr, als eine Träne oder ein Seufzer meiner Mutter.“ - „Nun, tapferer Weiberknecht“, fuhr der Kleine fort, „anschauen und betasten darf ich doch das Ringlein. Ich bin ja in deiner Gewalt, da du noch immer das blanke Schwert in der Rechten hältst, während ich wehrlos vor dir stehe.“
Nach einigem Zögern ließ es der König zu, dass ihm der Knabe den Ring vom Finger streifte. Aber kaum war es geschehen, so verschwand derselbe vor seinen Augen, und er starrte in die leere Luft. Nur seine Stimme hörte er, die ihm höhnisch zurief, er werde nun wohl zu Hause die Rute kriegen. Er tastete, er hieb mit dem Schwert in der Richtung, aber traf nur Blumen und Sträucher, und der listige Dieb höhnte fort: „Einem Schalksnarren ist solch ein Ringlein nichts nütze, denn er kennt die Kraft des winzigen Steinchens nicht, das in dem Gold verschlossen ist. Ich will ihm dafür ein paar handliche Steine zuwerfen.“ Bei diesen Worten flogen dem Helden scharfkantige Steine an den Kopf, dass ihm der Schädel zerborsten wäre, hätte ihn nicht der stahlfeste Helm geschützt. Wie ergrimmt auch der König war, wie er die Faust gegen den unsichtbaren Kobold ballte, der ihm bald von der einen, bald von der anderen Seite Steine und höhnende Worte zuschleuderte, er sah endlich doch ein, dass hier weder seine Zwölfmännerstärke noch sein scharfes Schwert Hilfe schaffen konnte. Er ging zu seinem Ross, schnallte den Gurt fest und wollte aufsitzen. Da rief ihm der Kobold zu: „Bleibe doch, guter Freund! Mich erbarmen die Schläge, die dir die Mutter geben wird. Höre mich an: Ich habe noch von großen Dingen mit dir zu reden. Verpfändest du mir dein königliches Wort, dass ich frei reden darf, und dass du auch das Geschehene nicht rächen willst, dann erhältst du sogleich das Fingerringlein zurück.“ - „Wohl“, sagte der Lombarde, „auf des Königs Wort und Treue hast du Sicherheit.“ - „Auch wenn ich von deiner Mutter Unliebsames rede?“, fuhr der Kleine fort. „Ha, nimmer!“, rief Ortnit: „Schilt mich, wie du magst, lästere, kläffe immer zu, aber meine Mutter sei ohne Makel und Tadel!“ - „Das ist sie mir, wie dir.“, sprach der Kleine: „Höre mich in Frieden an, denn ich bin Alberich, König der Zwerge, die im Schoß der Erde schaffen, und bin dir näher verwandt, als du denkst. Ich will dir die Wahrheit verkünden. Zuvor aber nimm dein Fingerringlein hin, da ich deinem Wort und deiner guten Treue vertraue.“
Alsbald fühlte der König den Ring wieder in seiner Hand, und wie er ihn an den Finger schob, sah er den Knaben vor sich stehen. „Wisse denn, reicher König“, begann der Kleine wieder, „Land und Leute, Burgen, Städte und Siegesehren und deine große Leibesstärke, das alles verdankst du mir. Dein Vorfahr, den du Vater nanntest, verheiratete sich im fortgeschrittenen Alter mit der jugendlich blühenden Schwester vom Fürsten der wilden Reußen. Doch die Ehe blieb kinderlos, und vergebens beteten beide Gatten, der Himmel möge ihnen einen Leibeserben schenken. Deine Mutter härmte sich, dass nach ihres Gatten Tod das Reich verwaist, den habsüchtigen Lehnsfürsten und den lauernden Feinden preisgegeben, und sie selbst schutzlos, vielleicht sogar vertrieben, ins äußerste Elend verstoßen sein sollte. Ich hörte oft ihre Klagen, wenn ich unsichtbar ihr Gemach betrat. Ihre Sorge, ihr Harm nahmen zu, je mehr der König alterte. Dann - ja, du musst es doch erfahren - tat ich dem harmvollen König den Vorschlag einer heimlichen Scheidung und einer ehelichen Verbindung der Königin mit mir. Er willigte ein, aber nicht die edle und tugendhafte Frau. Sie weinte Tage und Monde, und nur der bestimmende Befehl ihres Gemahls bezwang ihren Widerstand. Priesterspruch heiligte die zweite Ehe, und du giltst als Sohn des Königs. Schau mich nur an, so wahr ich schon fünfhundert Jahre zähle, so klein ich bin, so gewaltig an Körpergliedern du vor mir stehst, ich bin doch dein rechtmäßiger Vater. Doch erst als der alternde Herrscher ins Grab sank, gelang es mir, der Gattin Herz zu gewinnen. Da führte ich sie manchmal hierher unter die Linde, und oft spielte ich mit dir in den Blumen der Aue, wie Kinder es tun. Als du zum Mann, zum Helden heranwuchsest, war ich in blutiger Schlacht neben dir, wehrte feindliche Waffen ab und erschreckte die feindlichen Kämpfer. So werde ich auch weiter dein treuer Helfer sein, wenn du über die wilde See fährst, um die Mohren-Jungfrau zu erkämpfen. Solange du das Ringlein am Finger trägst, wirst du mich vor dir sehen, wenn du meines Beistandes bedarfst. Nun harre hier, dass ich dir die Rüstung bringe, die keine Waffe versehrt, und das Schwert Rosen, das Stahl und Eisen und sogar Drachenschuppen durchschneidet.“
Wolfdietrich hörte gespannt zu, und das Riesenweib erzählte weiter:
Ortnit sah nun alles wie im Traum: Die Kinderspiele auf der Blumenwiese, der Vogelgesang im Gezweig der Linde, der Zwergenkönig Alberich, die unsichtbare Hand, die im Schlachtgetümmel die Geschosse ablenkte, alles ging vor seinem inneren Auge vorüber, und dann die edle Gestalt der königlichen Mutter, welche ihn gepflegt, ihm den Ring gegeben hatte, und ihn auch jetzt mit Sorgen erwartete, denn sie war ja seiner Liebe wert. Schwere Schritte und das Klirren von Waffen schreckten ihn aus seinen Träumen. Es war Alberich, der mit Hilfe seiner Zwerge die versprochenen Gaben herbeischleppte. Das väterliche Geschenk war in der Tat eines Königs würdig: Der silberglänzende Helm mit goldenen Spangen, oben auf der Spitze ein leuchtender Diamant, Halsberg und Brünne gleichfalls mit silbernen und goldenen Ringen, der goldene Schild mit Edelsteinen verziert, und die ganze Rüstung leicht und zierlich gearbeitet und doch fest gegen alle Waffen, das Schwert Rosen in goldener Scheide, der Knauf ein glänzender Karfunkel, die Klinge haarscharf, mit goldenen Bildern und dem Namenszug des Königs versehen, und alles in Drachenblut gehärtet. Ortnit staunte über die nie gesehene Pracht. Er legte das Rüstzeug an, und es passte ihm wie angegossen. Da hob er den winzigen Vater zu sich empor und küsste ihn auf den rosigen Mund. Und der erwiderte den Gruß nicht mit einem Faustschlage, wie bei der ersten Begegnung, sondern mit einer zärtlichen Umarmung. Als der König sein Ross bestieg und Abschied nahm, rief ihm Alberich noch zu: „Vergiss das Fingerringlein nicht! Gib es niemals von dir. Drehst du es um, dann bin ich zur Hilfe bereit.“

Als sich Ortnit der zinnengekrönten Burg Garden näherte, eilten die Dienstmänner und Knechte auf die Mauer, um den Recken in der strahlenden Rüstung zu sehen, den sie nicht erkannten. Erst als er den Helm abnahm, erhob sich der Jubel über die glückliche Heimkehr des Gebieters. Auch die Mutter winkte ihm vom Söller herab freudig zu. Er stieg eilends zu ihr hinauf und sprach: „Ich komme von Vater Alberich.“ - „Du weißt?“, fragte sie. „Ich weiß“, versetzte er, und schloss sie an seine starke männliche Brust.
Der Mai, der fröhliche und jauchzende Mai kam endlich wieder ins Land. Da sammelte sich das Kriegsvolk der Lehnsträger, und streitbare Söldner fanden sich zahlreich ein, denn der König hatte seinen Turm geöffnet und zahlte aus den darin verborgenen Schätzen reichlichen Sold. Der Zug ging von Garden südwärts durch Lombardenland, Toskana, das Gebiet von Rom und Lateran, Benevento, Troyen und Pullien (Apulien), wo sich überall zahlreiche Mannschaft dem Heer anschloss. Auf bereitgehaltenen Booten setzte man über nach Messina, dem allgemeinen Sammelplatz auf Sizilien. Der getreue Zacharis hatte daselbst die Schiffe schon gerüstet, und nicht nur mit Speise und Trank, sondern auch mit Kaufgut versehen, um im Fall der Not feindliche Raubgaleeren zu täuschen. Bald war die Mannschaft an Bord, günstiger Wind schwellte die Segel, und erfahrene Seeleute steuerten die Fahrt durch die wilde See.
„Land in Sicht!“, rief eine Stimme vom Mastkorb herunter: „Land Syrien! Stadt Tyros!“ Bald erblickte man auch auf dem Verdeck das Land und die befestigte Stadt. Da trat der Kapitän zum König mit den Worten: „Herr, wir sind alle verloren. Der Wind ist uns zu sehr entgegen, als dass wir vorüberfahren könnten. Schon hat man uns erblickt. Die Raubgaleeren werden sogleich auf uns Jagd machen.“ - „He, Neffe!“, rief der Reuße Yljas: „Wirf den feigen Kerl ins Meer, dass er mit den Fischen Brüderschaft trinke! Haben wir nicht gute Rüstung und scharfe Schwerter und sollten uns vor dem mohrischen Raubvolk scheuen?“ - „Herr“, versetzte der Bootsmann, „die Heiden werden uns mit Wildfeuer (griechischem Feuer) bewerfen. Dagegen hilft weder Schild noch Schwert. Die Schiffe lodern auf, und die gesamte Mannschaft wird verbrannt oder ertränkt.“ Die Helden standen ratlos und blickten den Raubschiffen entgegen, die sich allmählich, vom Wind begünstigt, der Flotte der Christenleute näherten. Da rief eine Stimme vom Mastkorb herunter: „Waffen unter Deck, Kaufgut herauf! Segel gerefft, dass die Feinde nicht wähnen, wir flöhen!“ - „Hei, das ist Alberich“, sagte Ortnit, „wie konnte ich ihn vergessen?!“ Er blickte empor und sah den Zwergkönig schnell, wie eine Lerche aus hoher Luft sich ins Weizenfeld niedersenkt, am Mastbaum herunter auf das Verdeck gleiten. „Du hast des Ringes, hast meiner vergessen!“, raunte er dem König zu: „Aber ein Vater vergisst des Sohnes nicht. Nun schaffe, dass meine Befehle vollzogen werden!“ Beschämt tat Ortnit nach dem Gebot. Bald waren alle Hände beschäftigt, die kriegerischen Geräte in den unteren Raum und den Kaufschatz herauf zu schaffen, ihn auszubreiten und die Waren in zierliche Ordnung zu bringen. Währenddessen hatte das Zwerglein schon wieder den Mast erklommen und rief den Mohren zu: „Ohe! Friedliche Männer führen Kaufschatz, schöne Gewänder aus Welschland (Italien), Gold- und Silbergerät, Schmuck und Kleinodien aus Frangistan (Christenreich)! Begehren freies Geleit nach Tyros!“
Yljas starrte mit offenem Mund nach der Mastspitze, wo er nur die königliche Flagge wehen sah, aber keinen Menschen erblickte. „Ist der Teufel an Bord?“, fragte er sich bekreuzigend, „Oder ein guter Geist? Mit wem hast du geredet, Neffe? Wer ruft von oben herab?“ - „Es ist ein guter Geist“, erwiderte Ortnit, „ein Zwerglein, das uns aus der Klemme hilft. Du sollst es gleich mit Augen schauen.“ Er schob ihm das Ringlein an den Finger, und der Reuße erblickte den schönen Knaben, der schon wieder herunterstieg, und er staunte, als ihm Ortnit eilends einige Kunde von seinem Abenteuer gab. Indessen waren die Galeeren nahe herbeigekommen. Der Hauptmann derselben erschien an Bord, und wie er die prächtigen Kaufschätze sah, versprach er sicheres Geleit und führte selbst die Kauffahrer in den Hafen von Tyros. Da stellte sich alsbald der Stadthalter ein, und auch er ließ sich täuschen, erlaubte die Landung und den freien Verkehr mit der städtischen Bevölkerung. Posaunenschall verkündigte den Frieden, welcher den fremden Gästen gewährt war.
Am Abend hielten die beiden Führer Rat, was weiter zu tun sei. „Schlachten!“, rief Yljas, „Schweine schlachten, Mann und Maus, Weib und Kind, die ganze Heidenschaft müssen alle auf den Block und werden dann für den Teufel und seine Gesellen gebraten, wenn das Nest im Feuer aufgeht. “ - „Das ist ein übler Rat!“, ließ sich Alberich vernehmen, der ungesehen genaht war: „Ein König, der ehrlich um Sieg und Ruhm wirbt, sendet dem Feind durch einen Herold den Aufruf zur Fehde.“ - „Aber der wilde Heide wird den Boten an den Galgen hängen“, wandte Ortnit ein. „So will ich selbst die Botschaft bringen.“, sprach der Zwerg und verschwand bald aus den Augen des Königs.
Alberich eilte auf unbetretenen Wegen nach Montabur. Da stand König Machorel auf der Burgmauer, um nach der Tageshitze die abendliche Kühlung zu genießen. „Merke auf, Heidenkönig“, rief ihm der Zwerg aus dem Burggraben zu, „was dir König Ortnit, mein Herr, entbieten lässt. Du sollst ihm dein holdes Töchterlein Sidrat zur Ehegenossin geben, dass sie an seiner Seite als Königin über das Land der Lombarden herrsche. Bist du dessen nicht willig, dann kündigt er dir Krieg an und wird, ehe der Tag graut, deine Hauptstadt Tyros mit Heeresmacht angreifen und, wenn sie erobert ist, vor Montabur rücken, um dich für deine Untaten zu strafen und die geliebte Jungfrau heimzuführen!“ - „Heda!“, rief Machorel zornig, „Willst du den Kuppler machen? Zuvor wird dein Haupt auf eine Burgzinne gesteckt, dann auch das deines gottverfluchten Herrn, wenn er sich blicken lässt. Aber wo ist denn der Kobold? Kann ich ihn doch nicht schauen!“ - „Hier, unter dir, im Burggraben.“, war die Antwort. Darauf wälzte der König einen schweren Stein hinunter, der jedoch sein Ziel verfehlte. Er rief nun seine Mannschaft herbei, ließ den Graben und die Umgegend durchforschen, aber Alberich blieb unsichtbar. Der wiederholte nochmals den Fehderuf und trat sodann den Rückweg an. Vor Tagesanbruch war er wieder auf dem Schiff und half, eine große Anzahl geräumiger Boote vom Strand herbeizuschaffen, auf denen das Heer übergeführt wurde.
Die ganze bewaffnete Macht stand in früher Dämmerung vor der Stadt, die dem Untergang geweiht war. Die Bürger schliefen fest, selbst die Wächter waren eingenickt und hatten die Tore unverschlossen und unbehütet gelassen. Als aber das Heer anrückte, wurden sie vom Klirren der Waffen und Hufschlag der Pferde aufgeweckt. „Ho! Feinde! Verrat! Mord!“, riefen die aufgeschreckten Wächter und stießen in die Hörner und Hallposaunen, dass es weit über Land und Meer erscholl. Die Bürger ergriffen ihre Waffen und stürmten zur Verteidigung. Doch sie fielen haufenweise unter den Speeren und Schwertern der Lombarden, die unaufhaltsam in geschildeter Ordnung vordrangen. Als sie sich aber mehr und immer mehr sammelten, wurde der Kampf schwer und mörderisch auf beiden Seiten. Indessen, mit Ortnit war der Sieg. Das Schwert Rosen in seiner Hand spaltete Helme und Schilde. Der Schrecken des Todes ging vor ihm her, Blut und Leichen bezeichneten seinen Weg. Nicht weniger tapfer focht Yljas an der Spitze seiner Reußen. Des Heeres Sturmfahne in der Linken, das Schwert in der Rechten, schritt er wie ein Würgengel seinen Mannen voraus. Da kam Botschaft, ein Teil der Stadtwehr sei durch ein anderes Tor ausgefallen und dringe gegen die Schiffe vor, um sie in Brand zu stecken und dann das Heer im Rücken anzugreifen. Ortnit überließ dem Reußen die Verfolgung der weichenden Sarazenen („Morgenländer“) und warf sich mit einem auserlesenen Häuflein der feindlichen Macht entgegen, welche Flotte und Rückzug bedrohte. Der Stadthalter führte diese an, und er war der erste, der unter Ortnits Streichen fiel. Ihm folgte der größte Teil seiner Kämpfer in den Tod, die anderen ergriffen die Flucht, wo irgend des Königs Schwert blitzte. „Hab acht auf den Reußen!“, ließ sich jetzt eine Stimme neben Ortnit hören, und er erkannte seinen Beschützer Alberich. Er eilte sogleich nach der Walstatt, wo er seinen Oheim verlassen hatte. Aber schon kamen ihm Flüchtlinge, erst einzeln und dann in Masse entgegen, bald auch die siegreich nachdringende Stadtwehr, die durch Hilfsmannschaft vom Land mächtig verstärkt war. Doch sie bestand nicht vor Ortnits furchtbaren Streichen. Die flüchtigen Scharen sammelten sich wieder um ihn her und zwangen nun ihrerseits die Feinde zum Rückzug. Sie gelangten auf den früheren Kampfplatz, aber der gewährte einen traurigen Anblick. Zerhauen, tot oder wund lagen da Freunde und Feinde. Und da lag auch der starke Yljas mitten unter seinen Reußen, die mit ihrem Blut ihre Treue besiegelt hatten.
Ortnit ließ von der Verfolgung ab und betrachtete in tiefer Trauer den gefallenen Freund. Er nahm ihm den Helm ab und fand, dass noch Leben in ihm war. Zufällig berührte er dessen bleiche und faltige Stirn mit dem Fingerring Alberichs, da schlug der Held die Augen auf. Er erhob sich in voller Kraft, holte Schwert und Sturmfahne aus der Blutlache hervor und begehrte Kampf. „Hei, Neffe!“, rief er: „Ich lebe noch. Ein Keulenschlag auf den Helm warf mich nieder, und da sind meine Dienstmänner alle erschlagen! Aber die heidnischen Teufel sollen es entgelten. Wo? Wo sind die Höllenhunde? Ich will sie alle zu ihrem teuflischen Ahnherrn befördern.“
Die Stadtwehr hatte sich wieder gesammelt, als Ortnits furchtbares Schwert nicht mehr im Kampf blitzte. Der Reuße warf sich nun überaus wütend auf die anrückenden Scharen. Er durchbrach, versprengte sie, dass Ortnit kaum folgen konnte. Endlich war jeder Widerstand gebrochen, und nur vereinzelte Flüchtlinge fand noch der grimmige Reuße, die er ohne Erbarmen niederhieb. Wehrlose Leute, Männer, Frauen und Kinder, in einem unterirdischen Gewölbe versteckt, flehten vergebens um Gnade. Er und seine Gefährten würgten und metzelten, bis der König erschien und dem Morden Einhalt tat. Yljas aber geriet darüber in noch größere Wut. Er wusste nicht mehr, was er tat, stürzte auf das Schlachtfeld zurück und zerstampfte oder erwürgte mit dem Schwert die Verwundeten, mochten sie Freunde oder Feinde sein. Der König hörte das Jammergeschrei. Er sah mit Entsetzen das Wüten des Mannes, der gleich einem Tiger nach Mord und Blut brüllte. Da umfasste er ihn und entwand ihm die bluttriefende Waffe.
Die Stadt Tyros war erobert, die Bürgerschaft, soviel von ihr noch am Leben war, erhielt Gnade. Sie musste dem König den Huldigungseid leisten und sein Banner auf der Zinne der Burg aufpflanzen. Nun aber sorgte der königliche Eroberer für die Verwundeten. Die Sarazenen übergab er zur Pflege den Bürgern, die eigenen Streitgenossen wurden auf die Schiffe gebracht. Es waren ihrer noch fünfhundert. Dem Heer hatte der fürchterliche Kampf neuntausend Mann gekostet, ein empfindlicher Verlust, da noch der wilde Machorel mit seiner Hauptmacht in Montabur lagerte.
Das Riesenweib fuhr fort, Wolfdietrich hörte achtsam zu:
Nur wenige Tage gönnte der König dem Heer Rast. Die Sehnsucht nach der wundervollen Jungfrau ließ ihn Tag und Nacht nicht ruhen. Wer aber sollte auf dem Zug die Sturmfahne tragen? Wer sollte das Heer in dem fremden Land führen? Der zornmutige Reuße schien dazu nicht mehr geeignet. Da gedachte Ortnit seines Vaters Alberich, drehte das Ringlein, und sogleich stand der Zwerg an seiner Seite und fragte nach seinem Begehr. „Vertraut und folgt mir!“, rief er, als er vernahm, was den König wünschte. Mit diesen Worten bestieg er ein gesatteltes Pferd, nahm das Banner in die Hand und setzte sich an die Spitze des Heeres, das staunend die wunderbare Erscheinung vor Augen sah. Denn man gewahrte wohl das Ross und die wallende Fahne, aber nicht den Reiter, der sie trug. „Es wurde ein Engel vom Himmel zu uns gesandt!“, sprachen die Krieger untereinander und folgten mit Freuden, obgleich der Weg weit und die Beschwerden unendlich waren. Anfangs ging der Marsch durch fruchtbares Gelände, dann aber durch grauenvolle Einöde, wo die Sonne glühend brannte und kein Wasser zu finden war. Da sehnten sich die fast verschmachtenden Krieger nach den frischen Brunnen des Vaterlandes, nach einem kühlenden Tropfen vom Labsal der grünenden Heimat. Doch der Marsch des Heeres ging indessen weiter. Die Krieger folgten nicht in der Richtung, wo die trügerische Wüstenfee Morgana ihre sprudelnden Quellen zeigte. Das königliche Banner in unsichtbaren Händen, war ihnen ein himmlisches Zeichen auf dem Weg zu Siegesehren oder zur Seligkeit durch die Pforte des Todes.
Und endlich tauchten am Horizont blaue Berge auf, bald breiteten sich duftige grüne Matten aus, hohe Zedernstämme, die keines Menschen Hand gepflegt, beschatteten den Weg, und von steilen Felsen hernieder stürzte brausend und schäumend ein wilder Bergstrom hinab ins Tal. Da ruhten die lechzenden Krieger von der mühseligen Wanderung, sie schlürften durstig mit begierigem Mund den kühlen Trank, der aus den Bergen quoll, doch nimmer, so schien es, wurde ihr Durst gestillt. Da flatterte am jenseitigen Ufer eine blutrote Fahne, und blutrot wimmelten dort die Turbane in Busch und Strauch. Bögen wurden gespannt, und scharfe Pfeile flogen alsbald von starker Hand entsandt, um das feindliche Ufer blutrot zu färben.
Es war der grimmige Machorel, der hier mit zahlreichem Aufgebot das feindliche Heer zu hemmen suchte. Er hatte bereits Kunde erhalten von der Eroberung seiner Hauptstadt Tyros und von dem Zug nach Montabur. Auf sein Geheiß waren zahlreiche Krieger aus der Nähe und Ferne herbeigeströmt, und immer noch kamen Schwärme zu Ross und zu Fuß, um seine Macht zu verstärken. Ortnit ordnete seine Streiter zum Angriff. Ihm war nicht vor der Übermacht bange, wohl aber trug er Sorge, wie man durch den reißenden Strom kommen sollte. Da zog der unsichtbare Führer mit dem wallenden Banner voran, und kühn folgten die Krieger, und es war, als ob die schäumenden Wasser zurückwichen und eine breite Furt eröffneten. Ein fürchterlicher Kampf entbrannte am jenseitigen Ufer, und obgleich der König mit seinem guten Schwert alles vor sich her niederschlug und der Reuße nicht minder wütete, so wichen doch die Feinde nur Schritt für Schritt. Doch wurden sie bis an den Burggraben gedrängt. Hier machten sie Halt und versuchten, sich mit äußerster Gewalt zu verteidigen. Gleichzeitig begannen die Katapulte und andere Wurfmaschinen von der Mauer herab, zentnerschwere Steine und Balken auf die Belagerer zu schleudern, von denen Hunderte den tödlichen Geschossen erlagen. Gegen solche Waffen halfen weder Schwerter noch Speere, und die bisher Sieger waren, mussten weichen. In diesem Augenblick, da eine Niederlage, vielleicht sogar der Untergang des ganzen Heeres bevorstand, griff Ortnit nach dem Ring. Sogleich war der hilfreiche Zwerg zur Stelle und schaffte Rat. Er eilte, er flog durch das Kampfgetümmel, verschwand unter den feindlichen Scharen und erschien alsbald wieder auf der Burgmauer. Ungesehen von den arbeitenden Kriegsknechten, nur dem König sichtbar, stürzte er mit seiner wunderbaren Kraft eine Maschine nach der anderen in den Burggraben, während die Knechte, unwissend, wer ihnen ihre Werkzeuge entriss, voll Staunen und Schrecken den krachend hinabstürzenden Geräten nachblickten. Ortnit sah freudig die Werke des Zwerges, und nun flammte sein furchtbares Schwert wieder seinen Scharen voran und brach ihnen einen blutigen Weg durch das feindliche Heer.
Alberich verließ unterdessen die Burgmauer und schritt nach einem turmartigen Vorbau, der über die Mauer emporragte. Daselbst war das Heiligtum der Mohren, wo ihre Abgötter Machmet und Apollon, zwei mächtige Steinbilder, aufgestellt waren. Die Königin und ihre Tochter, die schöne Sidrat, knieten vor ihnen und flehten um Schutz vor den grimmigen Feinden, welche den König, sie selbst und das Land bedrängten. Da fühlte Sidrat ihre Hand von einer unsichtbaren erfasst. Sie erschrak zuerst, dann glaubte sie, der Gott selbst habe ihr Gebet erhört und wolle ihr seinen Schutz anzeigen. Es war aber Alberich, und der flüsterte ihr zu: „Deine Götter sind Staub. Ich bin ein Bote aus einer anderen Welt, der dir Rettung bringen und den wahrhaftigen Gott verkündigen will.“ Die Jungfrau riss sich erschrocken los und flüchtete zu ihrer Mutter. Nun ergriff der starke Zwerg die Steinbilder, trug sie auf den Söller und stürzte sie hinunter in den Graben. Die Frauen hörten das Krachen des Falles und drängten sich in einen Winkel des Betsaales, denn sie meinten, ein böser Geist habe das Werk getan. Aber Alberich stand schon wieder neben der Jungfrau und zog sie gegen ihren Willen nach dem Söller, indem er sagte: „Sieh dort den Helden, der dich begehrt, der dich glücklich, zur reichen Königin über alle seine Reiche machen will.“ Unwillkürlich blickte sie hinunter auf das fürchterliche Kampfgewühl. Da stand Ortnit inmitten des blutigen Streites, hoch, alle überragend, in glänzender Rüstung wie ein Gott, der sich unantastbar und unwiderstehlich durch die wild anstürmenden Wogen des Krieges freie Bahn schafft. Sie konnte den Blick nicht von ihm abwenden. Aber nun nahte er ihrem Vater, der seine ausweichenden Krieger sammelte und ermutigte. Da erreichte er ihn, sein blitzendes Schwert spaltete dessen Schild und erhob sich abermals zum Todesstreich. Sie stieß einen lauten Schrei aus, und Ortnit konnte den Streich nicht vollenden. Sein Auge hing an dem Frauenbild auf dem Söller, denn sie war die Erscheinung am Meeresstrand.
„Siehst du den königlichen Helden?“, sprach die Stimme des Unsichtbaren zu der Jungfrau: „Er will dich zur Königin über alle seine Reiche erheben.“ Sie antwortete nicht, doch ihr Blick war dem des Königs begegnet. Der Zwerg verstand die stumme Sprache und fuhr fort: „Morgen beim ersten Tagesgrauen steige in den Burggraben nieder. Dein Vater wird es dir vergönnen, wenn du sagst, du wollest seine Götter anrufen, dass sie wieder in die Burg zurückkehren. Dort wirst du den König finden.“
Das Gefecht war indessen lässig geworden, weil Ortnit säumte. Nur Yljas wütete noch schonungslos unter den Mohren, die fortwährend im Weichen waren. Doch konnte er ihren Rückzug in die Burg nicht verhindern, noch die eisernen Tore sprengen, die sich hinter ihnen schlossen. Der Verlust auf beiden Seiten war groß. Zwar hatten die Heiden doppelt soviel Streiter eingebüßt, aber sie erhielten fortwährend Hilfsmannschaft, da die geschwächten Belagerer die ausgedehnten Festungswerke nicht einschließen konnten. Um vor einem nächtlichen Ausfall sicher zu sein, zog sich das Heer hinter den Strom zurück. Da wurden die Verwundeten verbunden. Das frische Wasser und die mitgeführten Vorräte an Wein und Speise gaben ihnen, wie den gesunden Kriegern, die wohlverdiente Labung. Als die Nacht den Schleier des Friedens ausbreitete, überließen sich die müden Recken dem Schlaf und träumten von neuen Kämpfen und Siegesehren. Nur der König konnte nicht ruhen. Er hatte von seinem Beschützer die Verabredung in Erfahrung gebracht. Er wappnete sich nach kurzer Rast, bestieg seinen Streithengst und ritt nach Montabur. Der Mond leuchtete hell. Hinter ihm lag das Lager im Frieden des Schlafes, vor ihm und um ihn die leichenvolle Walstatt im Frieden des Todes. Es war schauerlich unter den Leichen. Der König hielt nahe an der Burg unter einem weitschattenden Tamarindenbaum, wo er nicht leicht von den schlaftrunkenen Wächtern gesehen werden konnte. Er stieg ab und dachte, an den Stamm gelehnt, über das nach, was geschehen war und was noch geschehen sollte. „Wird Sidrat kommen? Werde ich sie endlich in die Arme schließen? Und wenn sie mein ist, dann biete ich der ganzen Heidenwelt Trotz.“ Unter diesen und ähnlichen Gedanken sah er nicht, wie sich am östlichen Horizont das erste Licht des Tages zeigte. Aber nun öffnete sich ein Ausfallpförtchen, eine weiße Gestalt trat heraus. „Sidrat!“, rief er und hielt sie in seinen Armen, und sie erwiderte seinen Kuss. „Fort! Säume nicht!“, flüsterte der Zwerg neben ihm: „Dort rechts nach dem Strom!“ Er begriff die Mahnung, hob die Jungfrau auf sein Ross, stieg selbst auf und ritt in der angedeuteten Richtung eilend vorwärts.
Es war auch höchste Zeit, denn ein Wächter auf der Mauerzinne erkannte die glänzende Rüstung und den Karfunkel auf der Helmkrone und stieß in sein Lärmhorn, dass die ganze Burgmannschaft wach wurde. Die Tore öffneten sich, Krieger zu Ross und zu Fuß stürmten hinaus, den Flüchtlingen nach. Mit Mühe erreichte Ortnit die schmale Furt durch das Bergwasser, das sonst überall wegen der reißenden Strömung und der felsigen Ufer nicht zu überqueren war. Auf der anderen Seite verbarg er Sidrat in einer kleinen Höhle, und nun stand der Held, sein gutes Schwert Rosen in der Hand, um die Furt zu verteidigen. Wurfspieße, Pfeile und krumme Säbel klirrten ihm auf Helm, Schild und Brünne, aber Alberichs Werk widerstand, Rosen flammte wie ein Blitzstrahl in der Faust des Helden und spaltete Rüstungen und Häupter, dass das Wasser rot von Blut wurde. Der erste Angriff war abgeschlagen, aber nun erschien Machorel mit frischer Mannschaft. „Seid ihr Männer?“, rief er den Kriegern zu: „Dann schlagt den Hund, den Mädchenräuber, in Stücke, dass sich Wölfe und Geier an seinem Fleisch mästen!“ Der Kampf wurde immer erbitterter, Ortnit fühlte, wie die menschliche Kraft zuletzt der Übermacht unterliegen müsse. Er stieß in sein Horn und hoffte, sein Oheim werde es hören, aber nirgends zeigte sich Hilfe, während immer neue Horden gegen ihn andrangen und sein Arm mehr und mehr erlahmte. Da hörte er Pferdehufschlag und Getümmel hinter sich und fürchtete, die feindliche Schar haben das Wasser anderweitig überquert und greife nun auch von hinten an. Dann wäre kein Entrinnen und keine Rettung mehr möglich gewesen. Aber es waren die Freunde, es war Yljas, der Reuße, und der stand bald an seiner Seite, die Sturmfahne in der Linken, das Schwert in der Rechten, warf er die vorgedrungenen Mohren in den Bach und drängte nach dem jenseitigen Ufer. Ortnit, erschöpft zum Sterben, sank in das hohe Gras. „Da nimm!“, rief er dem Freund zu: „Nimm Rosen! Ich kann nicht mehr.“
Der Reußenheld ergriff die starke Waffe und wütete unter den weichenden Heiden, indem er rechts und links niederschlug, was Widerstand leistete. Dennoch kam das Gefecht nicht zum Stehen, da neue feindliche Haufen auf dem Schlachtfeld angelangten. Sidrat fand den König, eilte mit Ortnits Horn zum Wasser und erfrischte den Ermatteten mit einem kühlen Trank.

Als sich daraufhin Ortnit erholt hatte und Rosen wieder in seiner Hand flammte, wurde der Rückzug der Mohren allgemein. Zweimal begegnete ihm Machorel im Mordgetümmel, zweimal warf er ihn mit dem Schild zu Boden, aber er scheute sich, den Vater der Geliebten zu töten. So gelang es dem Mohrenkönig, seine erschöpften Scharen in die Burg zurückzuführen, ohne dass die Lombarden zugleich mit eindringen konnten.
Der Verlust der Belagerer war indessen so groß, dass an Einschließung und Erstürmung der Festungswerke nicht mehr gedacht werden konnte. Da nun auch der Zweck der Heerfahrt erreicht war, so trat das Heer den Rückzug an. Man fand zu Tyros die Flotte noch wohlbehalten, schiffte sich ein und fuhr mit reicher Beute und der schönen Königstochter durch die blauen Meereswogen der Heimat zu. Sidrat aber vergaß an der Seite des geliebten Freundes Vater, Mutter und ihre Götterbilder, deren Ohnmacht sie erkannt hatte. Sie wurde im Christentum unterrichtet und erhielt in der Taufe den Namen Liebgart. Nach der glücklichen Landung ging der Zug unter großem Jubel der Landbevölkerung nach Garden, wo die alte Königin die mit viel Mühe und Blut erworbene Schwiegertochter und ihren ruhmvollen Sohn freudig empfing.
Und das Riesenweib erzählte weiter:
Eine glänzende Hochzeit wurde hierauf gefeiert, und da gab es viele Turnierspiele und ein fröhliches Gelage mehrere Wochen lang. Eine große Zahl edler Knappen empfing das Ritterschwert und Burgen, auch Kleinodien aus dem noch unerschöpften königlichen Schatz. Nach den festlichen Tagen lebten die beiden Ehegatten in Liebe und Ehren. Der gefeierte Held erhielt sogar in Rom die Kaiserkrone und wurde von den Sängern und Spielleuten wegen seiner Taten gepriesen. Einst saß er mit der Kaiserin in festlicher Halle auf dem Thron, während seine Recken umher fröhlich zechten. Da wurde ein fremder Mann gemeldet, der, wie er sagte, aus dem Morgenland komme und reiche Geschenke bringe. Nach erteilter Zustimmung trat der Fremdling ein. Er war von riesenhaftem Wuchs und wildem Ansehen und nannte sich Welle. Er gab an, König Machorel wünsche um der Tochter willen Versöhnung mit seinem Schwiegersohn und sende ihm zum Zeichen seiner friedlichen Gesinnung die edelsten Kleinodien, welche in Syrien zu finden seien. Als der Mann seine Rede geendigt hatte, rief er sein Weib Ruotze. Sie erschien sogleich und war noch ungeschlachter als er selbst. Sie schleppte vier Kisten herein, deren Inhalt sie vor dem königlichen Paar und den neugierig zudrängenden Hofleuten auskramte. Die erste enthielt feine, zierliche Gewänder und allerlei Stahlwaren, die zweite Spangen, Ringe und Gürtel von Silber, die dritte dergleichen von Gold. Die vierte Kiste öffnete der Mann selbst und brachte daraus zwei riesige Eier zum Vorschein, die seltsam geformt und gefärbt waren. „Es sind Eier der Abrahamschen Wunderkröte.“, sagte der Mann: „Wenn sie ausgebrütet werden, was das Werk meines Weibes ist, dann findet man darin den herrlichen Krötenstein, der im Dunkeln wie die Sonne leuchtet, oder ein Wundertier, das, sofern man es gut nährt, die Grenzen des Landes gegen jeden feindlichen Angriff sicherstellt. Ich bin König Machorels Jägermeister und verstehe mich auf die Zucht. Darum, wenn ihr mir und meinem Weib in den Bergen eine finstere, feuchte Höhle anweist, dann wird die Brut wohlgeraten. In einem Jahr wird mein königlicher Herr selbst über das Meer herkommen, um Frieden und Freundschaft zu schließen und die Wunder zu beschauen.“
Die Königin freute sich der väterlichen Gaben und der nicht erloschenen Liebe ihrer Eltern. Sie fiel ihrem Gemahl um den Hals und bat ihn, die gebotene Hand ihres Vaters nicht zurückzuweisen. Dem stimmten die Hofleute zu, denn sie wussten, dass das Morgenland reich an mancherlei Wunderdingen war. Nur Zacharis, der getreue Heide, meinte kopfschüttelnd, es sei der Rede und den Gaben nicht zu trauen. Doch seine Worte blieben unbeachtet, und der König befahl dem Verwalter des Gebirges, den Boten zurechtzuweisen und für seine Bedürfnisse Sorge zu tragen.
Hoch im Gebirge bei Trient in einer Steinwand war eine finstere und moorige Felsenhöhle. Dort nahm Welle mit seinem Weib Herberge, und letztere versorgte die Brut. Es dauerte nicht lange, da krochen aus den geborstenen Eiern zwei Lindwürmchen heraus. Sie waren gar zierlich und gelehrig und ringelten sich der Frau um den Leib, oder auch um einen Baumstamm, wie sie ihnen befahl. Selbst der Verwalter, der manchmal die Höhle besichtigte, hatte seine Freude an den munteren Tieren. Sie fraßen begierig das vorgeworfene Fleisch und wuchsen schnell heran, dass sie bald den Riesen und sein Weib überragten, wenn sie sich aufbäumten. Sie begehrten aber immer mehr des Fraßes, ein ganzes Rind genügte ihnen nicht mehr. Dabei wurden sie bösartig, zischten und heulten, wenn der Verwalter oder sonst ein Fremder eintrat, rissen die Rachen weit auf und zeigten zwei Reihen Zähne, die Fleisch und Knochen zu zermalmen drohten. Weil mit der Größe auch der Hunger wuchs und der Verwalter sich weigerte, mehr als zwei Rinder täglich zu liefern, so bedrohten sie selbst den Riesen Welle und sein Weib Routze so schrecklich, dass sich dieselben in eine andere Felsenhöhle flüchteten. Nun aber brachen die Ungeheuer heraus, erwürgten Menschen und Vieh und verheerten die ganze Gegend. Das Volk verließ die anmutigen Fluren am Ausgang des Gebirges und suchte anderwärts sichere Unterkunft. Aber die Ungetüme brachen bald da, bald dort aus der Wildnis hervor, so dass man nirgends mehr sicher war. Vergeblich suchten mancherlei Recken, sie zu bekämpfen. Sie fanden alle ihren Untergang. Der Verwalter rückte mit einigen Heerhaufen aus, doch Wurfspeere und andere Geschosse prallten wie schwache Zweiglein von den Drachenschuppen ab, und als die Ungeheuer, unter das Kriegsvolk stürzend, Ross und Mann zerrissen, ergriffen die Scharen die Flucht. Das ganze Königreich schien dem Verderben verfallen.
Eines Tages trat Kaiser Ortnit zu seiner Gattin und bat sie, ihm die Rüstung anzulegen, weil er einen schweren Kampf bestehen müsse. Sie sah ihn traurig an und sprach stockend: „Ortnit, in welchen Kampf?“ - „Sieh, Liebgart“, sagte er, „die Linddrachen, die Land und Leute verderben, das sind die Krötensteine, die mir dein Vater gesandt hat. Ich aber bin des Volkes Schutz. Wie mein Volk für mich kämpfte und blutete, als ich auszog, dich zu erwerben, so will, so muss ich jetzt für dasselbe Sieg gewinnen oder sterben.“ - „Du schaffst mir großes Leid“, sagte sie weinend: „Du bist mir Vater und Mutter, dein Gott ist mein Gott geworden, an deinem Leben hängt das meine. Wenn du in dem schrecklichen Abenteuer umkommst, dann muss auch ich untergehen. Und sollte ich das elende Leben weiter ertragen, so wird man mich, die Landesfremde, hinausstoßen wie eine Bettlerin.“ - „Sei getrost, Liebgart“, sagte er, „ich habe Rosen, das gute Schwert, das Stahl und Stein spaltet. Es wird auch die Drachenschuppen zerhauen. Kehre ich aber nicht zurück, dann wird mir ein Rächer auferstehen. Wer dir dann den Ehering wiederbringt, den ich einst von dir empfing, der ist mein Rächer, und ihm magst du die Hand zum neuen Ehebund reichen.“ Er drückte den Abschiedskuss auf ihre Lippen, dann riss er sich aus ihren Armen und eilte fort. Sie sah dem geliebten, hochherzigen Mann lange nach, wie er auf seinem edlen Ross in strahlender Rüstung nach dem wilden Gebirge ritt, wo schon so viele treffliche Recken ihren Untergang gefunden hatten.
Ortnit erreichte auf bekanntem Weg die Steinwand, an deren Fuß die finstere Felshöhle sein sollte, in welcher die Würmer ausgebrütet worden waren. Doch er fand sie nicht. Er stieg vom Pferd, stieß in sein Horn und ließ den treuen Jagdhund los, den er mitgenommen hatte, um die Unholde aufzuspüren. Da öffnete sich plötzlich ein Felsentor, und der Riese Welle trat heraus. „Holla, Mädchendieb!“, rief der Berserker und schlug mit seiner Eisenstange nach ihm, fehlte jedoch, und der König hieb ihm mit seinem guten Schwert die Stange mittendurch. Der Riese sprang zurück, zückte aber blitzschnell ein sechs Ellen langes Schwert und traf ihn damit auf den Helmkegel, dass er zu Boden taumelte. „Hast gut getroffen, altes Mondkalb!“, schrie das Riesenweib Ruotze, das vom Kampfgetöse herbeigelockt war: „Nun will ich dem Dieb den Hals umdrehen und seinen Leib den Würmern zum Fraß vorwerfen.“ In diesem Augenblick erhob der Jagdhund des Königs im Wald ein wütendes Gebell. Ruotze stürzte fort, um zu sehen, was es gebe, und da erhob sich der König und hieb nach kurzem Gefecht dem Riesen ein Bein ab. Der Unhold heulte laut und wehrte sich noch, an die Felswand gelehnt, aber sein Gegner hieb ihm auch das andere Bein ab. Auf das Geschrei kam die Riesin zurück. Mit einem entwurzelten Baum schlug sie nach dem König, traf aber in der Wut ihren Mann, dass ihm der Schädel zerbarst. Ortnit erschlug nun auch die Riesin und ruhte nach dem grässlichen Kampf mit den Scheusalen. Er aß und trank von den mitgenommenen Vorräten, während sein Hengst im Gras weidete. Als er sich wieder gestärkt fühlte, brach er auf. Er ritt durch unwirtliche Wälder und traf endlich auf einige Waldleute, die sich mit Holzkohlebrennen beschäftigten. Sie sagten, die Ungeheuer hätten sich westwärts verzogen. Doch hause daselbst nur das eine und habe in einer tiefen Höhle ein Nest voller Jungen. Das andere sei, wie es scheine, tiefer ins Gebirge, vielleicht auch in ein fernes Land gegangen. Dann beschworen sie den Helden, die Untiere nicht weiter aufzusuchen, weil kein sterblicher Mensch sie bestehen könne.
Ohne auf die Warnung zu achten, ritt Ortnit in der angegebenen Richtung nach Westen weiter. Anderen Tages kam er in einen Wiesengrund, wo er unter einem Baum den kleinen Alberich sitzen sah. Der Zwerg schien sehr traurig und sagte zu ihm, als er das Pferd anhielt: „Ortnit, mein lieber Sohn, es ist der Weg des Todes, den du reitest. Kehre um! Denn ich habe keine Macht über das höllische Gezücht, das du bekämpfen willst. Ich kann dir dabei keine Hilfe leisten.“ - „Ich bedarf der Hilfe nicht!“, versetzte der Held: „Habe ich nicht das Schwert Rosen? Das ist mein Helfer gegen die Mächte der Hölle, die mein geliebtes Volk verderben wollen.“ - „Fahre glücklich!“, rief der Kleine, war mit einem Sprung bei ihm auf dem Sattel und küsste ihn auf den bärtigen Mund. „Fahre glücklich, sei wachsam und schlafe nicht! Achte auf diesen letzten Rat, den ich dir geben kann. Nun aber gib mir das Fingerringlein, das du von deiner Mutter empfangen hast. Kommst du wieder heil nach Garden, dann erhältst du es zurück.“ Kaum hatte Ortnit die Gabe dem Zwerg ausgehändigt, da fühlte er noch einen Kuss auf seinen Lippen, und der Kleine war verschwunden.
Der unverzagte Held ritt unbeirrt weiter durch raue Felsentäler und wilden Tann. Er gelangte unvermutet an die ihm bekannte Steinwand und, ihr entlang reitend, an jene Linde, unter welcher er den guten Alberich zuerst schlafend gefunden hatte. Da tönte noch der heitere Vogelgesang, da blühten und dufteten noch die vielfarbigen Blumen, da lud der frische Rasen den Wanderer zur Ruhe ein. Ortnit und sein Pferd waren müde. Er stieg daher ab, ließ seinen Hengst frei weiden und lagerte sich in das weiche Gras. Der treue Hund streckte sich dicht neben seinen Herrn. Der König dachte über sein Vorhaben nach. Es schien ihm, als jubelten ihm die Vögel Beifall zu, sie sangen immer lieblicher und gaukelten über ihm in den Zweigen, die ein sanfter Lufthauch bewegte. Der Held sah dem Spiel zu, seine müden Augenlider schlossen sich allmählich, und er fiel in tiefen Schlaf.

Plötzlich verstummte der Vogelgesang, die Zweige lispelten nicht mehr, die Blumen senkten, wie von einem Gifthauch angeweht, ihre Kronen. Durch das Gehölz kroch, Bäume und Sträucher niederbrechend, der scheußliche Lindwurm, seine Schuppenhaut rasselte, seine Augen glühten wie Feuerbrände, sein halboffener Rachen zeigte zwei Reihen spitzer Zähne. Der treue Jagdhund, ein starkes und flinkes Tier, fiel ihn mit wütendem Gebell an. Als der Wurm aber den Rachen weit aufriss und mit grässlichem Geheul auf ihn zu stürzte, lief er zu seinem Herrn zurück und zerrte an seinem Gewand, um ihn zu wecken. Es war vergeblich, der Held war wie von einem Zauberschlaf befangen. Der Hund sprang von neuem auf den Drachen los, er umkreiste ihn, versuchte ihn am Rücken zu fassen, aber er entging kaum den Schlägen des Schweifes, der sich wie ein Rad umschwang. Jetzt hatte der Wurm den Helden aufgespürt. Er stürzte auf ihn zu, erfasste ihn mit den Zähnen, trug ihn mit einigen Sprüngen ins Dickicht, wo er ihn an einer Felsenzacke zermalmte. Helm und Rüstung blieben zwar unverletzt, aber alle Körperglieder waren wie morsches Holz zerbrochen. Darauf ergriff er die zermalmte, tote Masse wieder und trug sie nach der finsteren Höhle, wo er sein Nest mit den jungen Würmern hatte. Der Jagdhund verfolgte ihn zwar mit wütendem Gebell. Als ihm aber der alte Drache wieder zähnefletschend und brüllend entgegenkam, wich er scheu zurück, blieb jedoch während der Nacht in der Nähe und trat erst am folgenden Morgen den Rückweg nach Garden an. Die jungen Ungeheuer versuchten indessen vergebens Helm und Rüstung zu zerbeißen, sie konnten nur mit ihren spitzen Schnauzen durch die festen Stahlringe Blut und Fleisch aussaugen.
Wolfdietrich hörte aufmerksam zu, und das Riesenweib fuhr fort:
In Garden brachten unterdessen Liebgart und die alte Königin Tage und Nächte in großer Unruhe zu. Sie hofften und fürchteten. Am vierten Tag saßen sie kummervoll beisammen, da kratzte und winselte etwas an der Tür. Liebgart öffnete und erblickte den wohlbekannten treuen Hund, den Begleiter ihres Gemahls. Er sprang nicht, wie sonst, fröhlich auf sie zu, sondern kroch langsam herein und legte sich wimmernd der alten Königin zu Füßen. „Er ist tot, von dem Ungeheuer erwürgt!“, rief die unglückliche Mutter. Es waren ihre letzten Worte. Sie sank leblos von ihrem Hochsitz. „Tot! Alles tot!“, klagte die junge Königin: „Höre es, Lombarden-Land, dein König ist tot!“ Die lauten Klagen riefen die Frauen und viele Burgmannen in die Halle. Sie hörten, sie sahen, was geschehen war, und allgemeine Bestürzung verbreitete sich in der Burg, in der Stadt und bald weiter im ganzen Land. Mehrere Recken machten sich auf, den geliebten König, den hochherzigen Landesvater, zu suchen oder zu rächen. Sie folgten dem Jagdhund, der, als ob er ihre Absicht verstehe, voranlief. Doch als die ersten zur Beute des Ungetüms wurden, das bald da, bald dort aus dem Dickicht hervorbrach, da scheuten sich auch die mutigsten Helden, das Abenteuer zu wagen, denn es war etwas anderes, den ruhmvollen Schlachtentod zu sterben, als unter den Zähnen eines Untiers sein Leben auszuhauchen.
Das Lombarden-Land war nun herrenlos. Die großen Vasallen rissen die königlichen Rechte an sich, führten Krieg, verwüsteten einander die Länder mit Feuer und Schwert, während der Linddrache Menschen und Vieh raubte und seinen Jungen zum Fraß vorwarf. Es war eine schlimme und trostlose Zeit. Da traten endlich die Großen des Reiches zusammen und berieten sich, wie Besserung zu schaffen sei. Man kam zu dem Beschluss, die Kaiserin müsse aufgefordert werden, sich einen edlen Gemahl zu wählen, der Macht und Weisheit besitze, das Reich aus dem tiefen Verfall zu erheben. Dazu meinte nun jeder, der geeignete Mann zu sein. Jeder hoffte daher, die kaiserliche Braut heimzuführen. Als nun die Fürsten vor die trauernde Witwe traten, erklärte diese ernst und feierlich, sie werde dem einzig geliebten Ortnit die Treue bis in den Tod bewahren. Auch sei keiner der Fürsten würdig, sein Nachfolger in der königlichen Halle zu werden, als wer ihn an dem grässlichen Ungeheuer räche. Die Fürsten sahen einander bestürzt an und verließen die edle Frau. Indessen ließen sie dieselbe bald ihren Unwillen fühlen. Sie rissen die königlichen Schätze an sich, beschränkten sie auf ein armseliges Jahresgehalt und nötigten sie dadurch, ihr Gefolge zu entlassen und mit wenigen Frauen, die nicht von ihr wichen, für ihren Unterhalt selbst zu spinnen und zu weben.
Mit Unmut hörte der gute Markgraf von Tuskan (Toskana) von der Bedrängnis der Kaiserin. Er bot ihr Burgen und Schlösser in seinem Land an, aber sie erwiderte, in Garden sei sie einst mit Ortnit glücklich gewesen, da wolle sie auch in ihrer Trauer um ihn verharren. Gerührt von der Treue der edlen Frau, sandte ihr nunmehr der Fürst täglich die nötigen Vorräte an Speise und Wein, damit sie mit ihren Dienerinnen vor unwürdigem Mangel geschützt sei. Indessen lebte sie doch fortwährend unter schweren Drangsalen, da sie von den übrigen Burgherren unablässig mit Beschränkungen gekränkt wurde, um sie zu einer zweiten ehelichen Verbindung zu zwingen. Sie ertrug aber alle Misshandlungen mit Hingabe, denn in ihrer Seele lebte das Andenken an den geliebten Gatten und die Hoffnung, es werde ihm noch ein Rächer auferstehen.
Damit beschloss das Riesenweib die Geschichte von Kaiser Ortnit. Wolfdietrich saß lange schweigend und dachte darüber nach. Seine frohen Hoffnungen waren weit entschwunden, doch war er entschlossen, seine Fahrt fortzusehen. Da meinte das Riesenweib, das werde auf seinem vierbeinigen Klepper sehr langsam gehen, nahm ihn samt Pferd auf ihre gewaltigen Schultern und trug ihn huckepack in einem Tag zweiundsiebzig Meilen über Berge, Täler und Flüsse ins Lombardenland, wo sie die Bürde absetzte.
Wolfdietrich und Liebgart
Es war eine mondhelle Nacht, als Wolfdietrich nach Garden kam. Er hörte den See tosen und stand bald am Ufer. In der bewegten Flut spiegelten sich auf- und niederschwankend der Mond und die Sterne. Ein leuchtender Stern sank vom Himmel nieder und verschwand im Wasser. „Ist es ein Zeichen von Siegminne?“, dachte er, „die auch so an meinem Himmel strahlte und bald im Grauen des Grabes unterging? Oder ist es ein Wahrzeichen für mich, dass ich meine Reise im Rachen des Wurmes endigen soll, gleich dem mächtigen Ortnit?“
Er war abgestiegen und stand im Schatten eines Olivenbaumes. Da sah er zwei weibliche Gestalten am Ufer herwandeln. Die eine von ihnen war groß und stattlich, und wie sie den Schleier zurückschlug, hätte er laut aufschreien mögen, denn sie glich Siegminne. Hatte das Grab seine Beute zurückgegeben? War es eine trügerische Elfe, welche die geliebte Gestalt angenommen hatte, um ihn zu berücken? Er stand atemlos, wie gelähmt, und lauschte dem Gespräch, denn es war Kaiserin Liebgart mit einer vertrauten Dienerin. Er hörte, wie Erstere um den Gemahl klagte und über die Bedrängnisse, welche freche Vasallen ihr bereiteten. „Die Feiglinge“, sagte sie, „die den Mut haben, ein schwaches Weib zu ängstigen, aber es nicht wagen, mir das zu gewähren, was ich allein auf Erden noch begehre, wofür ich, wenn auch ungern, meine Hand versprochen habe: Rache, Rache an dem entsetzlichen Ungetüm!“ - „Doch lebt noch einer“, sagte die Zofe, „der es wohl wagte und vollendete. Es ist Wolfdietrich von Griechenland, dessen Ruhm in allen Landen vom Mund der Sänger gepriesen wird.“ Da trat der Held aus dem Schatten hervor und rief: „Der Rächer ist gekommen, hohe Königin! Ich will den Drachen bestehen und Leib und Leben wagen.“ Die Frauen waren erschrocken zurückgewichen, aber die edle Gestalt des Mannes und seine tröstenden Worte beruhigten sie. „Es ist Wolfdietrich“, sagte die Dienerin leise, „er hatte mich einst aus Räuberhand errettet.“ - „Wohlan, edler Held“, sprach Liebgart, „möge dich der Himmel beschützen! Aber der Unhold wird auch dich, wie meinen Gemahl, in seine Höhle zum Fraß tragen. So ziehe ruhig deinen Weg und überlass mich meinem Schicksal.“ Als der Grieche auf seinem Vorhaben beharrte, überreichte sie ihm einen Ring, den sie von einem Zwerg als ein glücksbringendes Pfand erhalten hatte. „Möge dir der Goldring mit dem leuchtenden Stein Glück und Sieg bringen!“, sagte sie mit einem warmen Händedruck und wandte sich nach Burg Garden zurück.
Ohne länger zu warten, ritt der Held entlang dem See nach den rauen Bergen. Nach langem Umherirren traf er Erzleute, welche ihr kärgliches Frühstück gern mit ihm teilten, da er ihnen Hilfe gegen den Drachen verhieß. Das Ungeheuer hatte ihnen schon manchen Mann geraubt, und sie lebten bei ihrer Arbeit in beständiger Furcht. „Warum schlagt ihr nicht allesamt das Gewürm mit euren Gerätschaften tot?“, fragte der Recke. „Ach, werter Herr“, war die Antwort, „es schießt wie ein Blitz aus Dickicht oder Geklüft hervor, und weder Hammer, noch Brecheisen, noch auch Schwerter und Spieße schaden ihm. Es wird auch Euch wie einen Mandelkern verschlucken.“ - „Jammerschade um den schönen Herrn!“, sagte ein ehrlicher Steiger: „Es wird ihm ergehen wie dem Kaiser Ortnit, um den das ganze Lombardenland trauert.“
Der unverzagte Recke bekümmerte sich nicht um die Rede der Bergleute. Er ritt ohne Säumen dem angewiesenen Weg zur Höhle des Wurmes. Er kam dahin, blickte in die dunkle Höhlung und sah fünf Drachenköpfe, die ihm entgegen starrten und züngelten. Es waren die jungen Lindwürmer, und der alte war auf Fraß ausgezogen. Der Held griff schon zu Speer und Schwert, um sie abzuschlachten, aber es kam ihm in den Sinn, dass es besser sei, wenn der Drache gar nichts von ihm gewahr werde. „Habe ich die Mutter erlegt“, dachte er, „dann müssen auch ihre Kinder an den Spieß.“ Wie er seines Weges weiterritt, sah er ein schönes Kind auf einem Felsen stehen, das ihm zurief: „Du bist zum Rächer meines Sohnes Ortnit bestellt. Aber schlafe nicht! Denn wenn du schläfst, dann bleibt mein Sohn ungerochen und du wirst ein Fraß des Wurmes.“ - „Hei, Bübchen“, lachte der Held, „hast früh die Vaterschaft angetreten. Doch bewahre dich selbst, denn du wärst ein leckerer Bissen für das Ungetüm.“ - Er spornte sein Pferd und ritt lachend weiter. Wie Ortnit kam er an eine Steinwand, und ihr entlang auf einen Anger, wo Klee, Gras und duftige Blumen in üppiger Fülle den Boden bedeckten. Eine mächtige Linde bot Kühlung gegen die mittägliche Sonne. Der Held war müde von der Reise und von der durchwachten Nacht. Er streckte sich in den Schatten, um zu ruhen, während das Pferd auf dem Anger saftige Weide fand. Die Ermüdung, die frische Kühle und der Vogelsang in den Zweigen wiegten den ruhenden Helden allmählich in sanften Schlummer.
Ringsherum war alles so ruhig und friedlich, der schlummernde Recke, das weidende Pferd, die singenden Vögel, die vom Windhauch bewegten lispelnden Blätter, alles atmete Frieden und Ruhe. Diesen glücklichen Frieden unterbrach plötzlich ein grässliches Zischen, ein Krachen von rollenden Felsen und brechenden Bäumen. Es war das scheußliche Untier, der Schrecken des Landes, das aus der Felswand hervorbrach. Da rief der Zwerg Alberich, denn er war der Warner gewesen: „Wach auf, edler Held! Schlafe nicht mehr, oder du bist des Wurmes Fraß!“ Der Zwergenkönig stand auf einer Felsenzacke und wiederholte immer wieder mit weit tönender Stimme seinen Weckruf. Auch der treue Hengst sprang hinzu und stieß seinen Herrn mit dem Fuß, aber vergeblich, der Schläfer schien unter einem Zauberbann zu ruhen. Das edle Ross sprengte gegen das Ungetüm an, doch scheute es vor dem Anblick und entging kaum der tödlichen Umschlingung. Jetzt witterte der Drache die Spur des Helden und stieß herankriechend ein Gebrüll aus, dass die Felsen erzitterten. Dies brach den Zauber, der Held erwachte, sah die Gefahr und griff nach Speer und Schild. Er rannte mutig gegen den grauenhaften Feind, aber der Speer zerbrach an der Hornhaut des Tieres. Er versuchte es mit dem guten Schwert, es biss nicht ein, und wie er, mit beiden Händen die Waffe fassend, einen gewaltigen Streich tat, zersprang die Klinge in drei Stücke. Er warf verzweifelnd den Schwertknauf dem Ungeheuer an den Kopf und befahl seine Seele Gott, denn er war wehrlos. Der Wurm umschlang ihn mit seinem ungeheuren Schweif, während er zugleich das wieder ansprengende Pferd mit den Zähnen ergriff. Die doppelte Beute trug er nach seiner Felshöhle und warf sie seinen Jungen vor. Er selbst kroch dann wieder fort, um für sich Fraß zu suchen. Das Gewürm in der Höhle fiel sogleich über die menschliche Beute her, doch konnten sie die starke Rüstung nicht zerbeißen. Sie versuchten, zwischen den Ringen hindurch das Blut auszusaugen, doch dagegen schützte das palmatseidene Hemd. Sie zerrten den Körper hin und her, so dass der gemarterte Mann das Bewusstsein verlor. Nun stürzten die Würmer über das Ross her und stillten schmatzend ihren Hunger mit dem noch zuckenden Fleisch.
Es war Nacht, als Wolfdietrich aus seiner todähnlichen Ohnmacht erwachte. Es war ein schauerlicher Aufenthalt. Er hörte die Drachen schnarchen und stöhnen. Er tastete um sich her, wo überall Gebeine (Knochen) lagen, vielleicht die Gebeine edler Recken. Ein Mondstrahl stahl sich durch eine Spalte in die schreckliche Höhle und beleuchtete zwei hellglänzende Gegenstände. Der Held tastete danach und entdeckte zwei Karfunkel, den einen an einem Schwertknauf, den anderen auf dem Kegel eines Helmes. Es lagen da noch andere Rüstzeuge und Waffen, und er probierte an den Felsen mehrere Schwerter. Doch bestanden sie nicht, denn sie wurden stumpf oder zerbrachen. Nur das Schwert mit dem Karfunkel blieb scharf und unversehrt. „Das ist Kaiser Ortnits Waffe, das Zwergengeschenk Rosen“, dachte er, „und daneben sein Helm und seine Rüstung. Nun werde ich heil bleiben und das Gewürm erlegen.“ Er schüttelte die Gebeine aus Helm und Rüstung. Da fiel ihm auch ein Ring in die Hand, den er sorglich zu sich nahm. Darauf legte er das Rüstzeug an, nahm Rosen in die Hand und erwartete getrost den Anbruch des Tages. Sobald es hell war, führte er auf den alten Wurm einen kräftigen Streich, der durch Horn und Schuppen drang, dass schwarzes Blut hervorquoll. Brüllend fuhr das Ungeheuer empor, bäumte sich hoch auf bis an die zehn Klafter hohe Decke und stierte mit weit offenem Rachen auf den Feind im eigenen Haus. Dann schoss es auf ihn herunter mit Blitzesschnelle, spießte sich aber in das vorgehaltene Schwert. Dennoch machte es sich wieder los und warf den Helden zweimal mit dem Schweif zu Boden. Indessen rastete Rosen nicht, und jeder Hieb und Stoß mit der Zwergengabe zerriss Horn und Schuppen, so dass das Tier nach heftigen Zuckungen verendete. Nun mussten auch die Jungen sterben, aber der Sieger selbst war von der Blutarbeit so erschöpft, dass er nur mühsam aus der von Blut und Gift verpesteten Höhle hervorwanken konnte. Dort sank er unter einem Baum nieder und wünschte nur einen Tropfen Labung, denn er war fast verschmachtet. Da trat Alberich zu ihm, den Sieger und Rächer rühmend, ließ von dienstbaren Zwergen ein reichliches Mahl vortragen und schenkte den erquickenden Wein in goldenen Pokalen. Der Held war wie ein König unter den jubelnden Zwergen, welche mit Saitenspiel und allerlei grotesken Sprüngen und Tänzen den Sieg über den Schrecken des Landes feierten.
Bevor der siegreiche Held den Weg nach Garden wieder einschlug, ging er in die Drachenhöhle zurück, um sich die Köpfe der erlegten Untiere zu holen, die ein Zeugnis seiner Taten sein sollten. Sein gutes Schwert Rosen trennte einen nach dem anderen vom Rumpf. Er fand aber, als er sich diese aufladen wollte, dass sie zu schwer waren. Dazu hätte er jener Riesin an Kraft gleich sein müssen, die ihn mit seinem Hengst über die Berge trug. So begnügte er sich damit, die Zungen aus den fletschenden Rachen zu schneiden. Diese barg er in einem Ledersack, den ihm der dienstwillige Zwerg verabreichte. In Ermangelung eines Pferdes musste er sich zu Fuß auf den Weg machen, was freilich mühsam war und die Reise wenig förderte. Er verfehlte oft den Weg und irrte mehrere Tage in den wilden Bergen herum, bis er einen Ausweg fand. Nun gelangte er an die wohlbekannte Linde auf dem wonnesamen Anger. Hier konnte er sich ausruhen und ohne Gefahr im Vogelgesang dem Schlaf überlassen. Er mochte lange geruht haben, denn als er erwachte, war die Sonne am Untergehen. Dann verspeiste er den Rest von den Vorräten, die ihm Alberich mitgegeben hatte, lud den Sack mit den Drachenzungen auf die Schultern und wanderte die Nacht hindurch längs der Steinwand nach dem See. Dort stürzte ein Bach von hohem Felsen rauschend in die Flut, und durch das Brausen und Tosen des Wasserfalles hindurch hörte er Paukenwirbel und Hörnerklänge. Es kam von Garden herüber und verkündigte wohl, dass man drüben ein Fest feiere. Er machte sich sogleich auf den Weg, um zu sehen, was das bedeute. Da kam er an eine Klause, in welcher ein frommer Einsiedler wohnte, und nahm daselbst Einkehr. Der Mann saß bei einem reichlichen Mahl und lud den Wanderer sogleich ein, daran teilzunehmen. „Seht, werter Herr, das hat mir der tapfere Burggraf Gerwart, der Überwinder des Lindwurms, gesendet, dass ich für ihn bete. Er feiert heute seine Hochzeit mit der schönen Liebgart, der Witwe von Kaiser Ortnit, Gott hab ihn selig.“ Als der Gast diese Nachricht vernahm, ließ er die köstliche Pastete unberührt, die der Wirt ihm vorsetzte, und sprach: „Höre, frommer Mann, leihe mir deine Kutte und Kapuze. Ich will mir das Fest beschauen, aber unerkannt bleiben.“ Der Klausner sah ihn misstrauisch an, doch als der Gast gebieterisch sein Gesuch wiederholte und erklärte, dass es um den Kampf gegen die Lüge geht, holte er eine Kutte und Kapuze aus einem Schrein hervor und übergab sie ihm, indem er sagte, die Gewänder hätten dem guten Bruder Martin gehört, der vor ihm die Klause bewohnt habe. Wolfdietrich legte die ungewohnte Tracht an, die Helm und Rüstung vollkommen verbarg, und schritt weiter nach Burg Garden. Überall begegnete er Bürgern und Landleuten und hörte, wie das Land nun der Linddrachen-Plage ledig sei, und wie nun auch durch die Vermählung der Kaiserin mit dem Besieger der Untiere die Unruhen und blutigen Fehden der Landherren ein Ende nehmen würden.
Auf Burg Garden war große Festlichkeit. Die Vasallen des Reiches saßen in der Halle bei Schmaus und Trank, zuoberst Burggraf Gerwart, der auch „Habichtsnase“ genannt wurde, denn er hatte in der Tat ein Geruchsorgan, das ein stattlicher Höcker bekrönte. Königin Liebgart nebst einigen Jungfrauen schenkte die oft geleerten Becher wieder voll, aber manche Träne fiel in den duftigen Trank, wenn sie an den stolzen Hochzeiter dachte, der ihr den Ehering der Liebe nicht geben konnte, wie ihr Ortnit verhießen hatte. Doch über dem Hochsitz grinsten die Drachenköpfe, das Siegeszeichen des Burggrafen, der mit achtzig Recken ausgezogen war, aber, wie man versicherte, doch ganz allein die Ungeheuer erlegt hatte. Im unteren Raum der Halle trieben sich Gaukler, Fiedler und Spielleute herum, die jedoch der eingetretene Klausner alle überragte. Die Kaiserin erblickte den vermeintlichen Einsiedler, und frommen Sinnes ging sie selbst mit einem gefüllten Becher zu ihm. Er leerte den Pokal auf einen Zug, ließ aber unbemerkt den Ehering von Ortnit hineingleiten. Sie bemerkte das Kleinod erst, als sie wieder neben Gerwart den Hochsitz eingenommen hatte. Da zitterte sie heftig, aber ermannte sich und rief mit fester Stimme: „Einsiedler, tritt vor und sprich, wer dir den Ring gegeben hat.“ Der Klausner drängte sich durch die Menge, stand vor dem Hochsitz und sagte laut und vernehmlich: „Der den Drachen mit der Brut erschlagen hat.“ - „Wer bist du?“, fragte sie weiter: „Und wie bist du zu dem Ring gekommen?“ - „Herrin, du selbst hast ihn mir einst geschenkt!“, rief er. Dann nahm er die Kapuze ab, öffnete die Kutte, und vor der Königin und allen Hofleuten stand der Held Wolfdietrich, strahlend in Ortnits Rüstung, hoch und herrlich, wie einst der Heidengott Balder (als Gott des Lichtes) in der Versammlung der Asen. Alle erkannten Helm, Rüstung und Schwert des gefeierten Kaisers, aber Liebgart erkannte auch den Helden, der sie jetzt trug. Und weil er ihr auch den Ehering der Liebe gebracht hatte, das Pfand von Kaiser Ortnit, das ihr der liebe Gatte einst beim letzten Abschied versprochen hatte, da blieb kein Zweifel mehr, der Held war des Kaisers Rächer und Nachfolger. Die Königin erklärte das alles der Versammlung, und viele Stimmen riefen: „Der Rächer unseres Herrn, der Held, der die Drachenbrut vertilgte, soll König im Lombardenland sein!“

Dagegen erhob sich Burggraf Gerwart. Er deutete auf die Drachenköpfe als Zeugen seiner Taten und nahm sie herunter, um sie vor sich aufzupflanzen. Doch dabei verwundete er sich an einem hervorstehenden Zahn des alten Wurmes und ließ ihn erschrocken zu Boden fallen mit dem Ausruf: „Er beißt noch!“ - „Er beißt noch!“, wiederholten die umstehenden Recken unter schallendem Gelächter, in welches alsbald noch andere einstimmten, da sich der Mann mit der blutenden Hand über die Habichtsnase fuhr und diese nunmehr in hochroter Färbung erschien. Die Szene wurde indessen ernster, denn die Dienstmänner des Grafen zogen für die Ehre ihres Lehnsherrn die Schwerter, während andere Hofherren zu Wolfdietrich standen. Durch den Tumult hörte man aber die mächtige Stimme des Helden. Er fragte, ob die Würmer nicht auch Zungen hätten, und als man es bejahte, zeigte er die hohlen Rachen. Darauf holte er die fehlenden Zungen aus dem Ledersack hervor, indem er sagte: „Seht, werte Herren, die alte Drachenmutter hat sie mir alle abgeben müssen und nun zum Zeichen der Wahrheit dem edlen Grafen ihren Zahn fühlen lassen.“ Dieser Beweis war so überzeugend, dass die ganze Versammlung in den Ruf einstimmte: „Es lebe Wolfdietrich, unser König! Nieder mit dem verlogenen Gerwart!“ Der armselige Burggraf bat fußfällig um Gnade, und erhielt sie, musste aber auf Ehren und Würde Verzicht leisten.
Unter den versammelten Landherren wurde der Wunsch laut, der erwählte König möge in alle Rechte des Burggrafen eintreten, folglich auch in die Rechte auf die Hand der Kaiserin. Er erwiderte: „Als Oberhaupt des Reiches bin ich zugleich Diener meiner Völker und verpflichtet, für ihre Wohlfahrt zu sorgen. Was aber mich selbst und die Wahl einer Gattin betrifft, so ist meine Wahl frei, und nicht vom Willen anderer abhängig. Dieselbe Freiheit hat die königliche Frau, die noch in Trauer um den ersten Gemahl ist. Hält sie mich für würdig, an seine Stelle zu treten, glaubt sie, dass meine Liebe und Verehrung ein Ersatz für das sei, was sie verloren hat, dann biete ich ihr die Hand zum Bund auf Lebenszeit.“ Liebgart schwankte nicht. Die letzten Worte ihres vorigen Gatten und der Edelmut des Mannes, der ihn gerächt hatte, überwogen jedes Bedenken. Sie schlug in die dargebotene Hand ein und die Vermählung wurde gefeiert.
Wolfdietrich war nicht mehr der hoffnungsvolle feurige Jüngling, der mit starker Hand alle Hindernisse niederzuwerfen glaubte. Er war zum Mann gereift. Zwar vertraute er noch seiner Heldenkraft, aber auch mit Vorsicht und Weisheit. So gedachte er nun wieder seiner Dienstmänner, denn er hatte erfahren, dass die Burg Lilienporte nach mehreren Jahren Belagerung schließlich von Sabene eingenommen wurde, dass seine alte Mutter, die Kaiserin Hildburg, an Hunger und Gram starb und die völlig ausgehungerte Mannschaft zusammen mit Berchtung und seinen Söhnen als Gefangene nach Konstantinopel verschleppt wurden. Er war bereit, sie dort zu befreien, doch wollte er zuvor dem zerrütteten Land den Frieden wiedergeben, sich die Liebe und opferwillige Hingebung des Volkes erwerben, ehe er ein Aufgebot zu einer Heerfahrt in ferne Länder erließ. Er übte daher Recht und Gerechtigkeit, zerstörte die Raubnester der Wegelagerer, vertilgte Räuber, bezwang mit siegender Gewalt widerspenstige Landherren und sorgte für den Wohlstand der Untertanen. Das Schwert Rosen in seiner Hand glänzte stets in Gefechten dort, wo die Gefahr am größten war. Wenn er aber aus den Kämpfen heimkehrte und die Hausfrau ihm die Rüstung abnahm, da war er ganz der liebende Gatte, und beide bereuten ihre Wahl nicht. Wohl ein Jahr ging unter solchen Mühen dahin, bis das Land in Frieden und das Volk seinem Herrscher ganz ergeben war. Nun entdeckte er der Frau die peinliche Sorge für seine Dienstmänner, und wie es seine Pflicht sei, für ihre Auslösung das Schwert umzugürten. Sie weinte und fürchtete, er werde so wenig wiederkehren, wie einstmals Ortnit, aber sie riet nicht ab, nachdem er ihr die Vorgänge erzählt hatte. Nun geschah das allgemeine Aufgebot, und das Volk gehorchte willig, über sechzigtausend Krieger waren zur Heerfahrt bereit.
Wolfdietrichs Weg der Befreiung
Wind und Wellen waren der Flotte günstig, und man landete in einiger Entfernung von Konstantinopel. In einem Wald wurde das Lager aufgeschlagen. Er selbst, der Kriegsherr, ging in seiner Mönchstracht auf die Spähe, um über seine Dienstmänner Erkundigung einzuziehen. Er kam an die Stadt, ging hinein, wanderte durch die volkbelebten Straßen und forschte wohl auch da und dort, aber niemand konnte ihm Auskunft geben. Man ging seinen Geschäften nach, man hatte andere Dinge im Kopf, es war ein Eilen, Schaffen und Drängen hier auf dem Weltmarkt, wo zwei Erdteile fast zusammenstießen, dass man sich um ein Dutzend Gefangener gar nicht bekümmern konnte, dass oft ein Bruder nichts von dem anderen wusste. Der Held wollte schon der Stadt den Rücken wenden, da begegnete ihm der Gefängniswärter Ortwin, der ihm von früherer Zeit her bekannt war. Der Mann trug einen Korb mit schwarzen Broten. Er bat ihn nun um eins derselben, da er, wie er sagte, noch nüchtern war, und zwar bat er um Wolfdietrichs willen. Jetzt erst sah ihn der Mann schärfer an und erkannte ihn. „Ach, Jungherr“, sagte er, „wie ist es hier so schlimm hergegangen! Die altehrwürdige Kaiserin starb auf der umlagerten Burg. Als die Festung übergeben werden musste, wurden der edle Herzog Berchtung und seine Söhne in Eisen hierhergebracht und in ein finsteres Gefängnis gesperrt. Dem alten Herrn gab der Tod endlich die Freiheit, aber die zehn Jungherren sitzen noch immer in enger Haft, und ich darf ihnen täglich nur solches Schwarzbrot und Wasser reichen.“ - „Nicht nur die Mutter, sondern auch der alte Meister tot!“ Wolfdietrich schlug sich an die Stirn, denn er bedachte, dass er nicht ohne Schuld sei. Indessen, das war nicht mehr zu ändern. Aber er hieß dem guten Ortwin, seinen zehn noch lebenden Dienstmännern bessere Kost zu reichen und, wenn er die Stadt mit Heeresmacht angreife, ihre Bande zu lösen. Der alte Wärter ging vergnügt zu seinen Gefangenen und erfreute sie mit der frohen Kunde.
Der König aber eilte zu dem Heer im Wald. Dort fand er die Mannschaft auf den Beinen und marschfertig, denn der schlaue Sabene, der überall seine Späher hatte, war nicht ohne Kenntnis von der Landung einer feindlichen Macht geblieben, und auf sein Gebot hin zog sich von allen Seiten Kriegsvolk zusammen, um dem Angriff zu begegnen. Er handelte immer noch als Ratgeber der beiden Könige Bogen und Wachsmuth, Wolfdietrichs jüngeren Brüdern, deren Vertrauter und Günstling er war. Dabei misstraute er dem Volk in der Stadt und auf dem Land, denn seine Reichsverwaltung war drückend, weil er nur seinen Säckel zu füllen suchte. Er vertraute dagegen auf zahlreiche Haufen von Söldnern, die für Geld ihre Haut verkauften, aber geübt und kriegstüchtig waren. Diese rückten unter dem Befehl der Könige gegen den Wald vor, der die Lombarden decken sollte. Obgleich der Tag schon weit fortgeschritten war, durfte man doch nicht zaudern. Daher zog das Heer ins offene Feld. Doch blieb eine zahlreiche Nachhut zurück, da der königliche Befehlshaber wiederum einen Hinterhalt befürchtete. Diese Vorsicht war nicht vergeblich, denn als die Schlacht auf der vorliegenden Ebene tobte, drangen Söldnerscharen auf der anderen Seite in den Wald, um der Hauptmacht in den Rücken zu fallen. Ihnen begegnete die Nachhut, die jeden Fußbreit Landes hartnäckig verteidigte. Der Kampf wütete geraume Zeit ohne Entscheidung. Wolfdietrich stürzte nicht, wie er sonst pflegte, blindlings auf die Todfeinde voran, er war bald im Vordertreffen, bald bei der Nachhut, und sein Schwert Rosen verbreitete Wunden und Tod. Dennoch standen die Feinde unerschüttert im mörderischen Gefecht. Da lösten sich plötzlich ihre geschlossenen Reihen. Sie wichen, die Flucht wurde allgemein, und vorwärts stürmte der Held nach dem Hügel, wo seine Brüder mit ihrem bösartigen Ratgeber hielten. Nun aber erkannte er auch, was unter den Feinden solchen Schrecken verbreitet und ihm den Sieg verschafft hatte: Die Bürgerschaft der Stadt war ausgefallen und den Söldnern in den Rücken gekommen. An ihrer Spitze kämpften seine Dienstmänner, voran Herbrand und Hache, die ältesten Söhne Berchtungs. Schon hatten sie die drei Männer auf dem Hügel umzingelt, darauf den feigen Sabene ohne Widerstand, die Könige nach kurzer Gegenwehr gefangen und gebunden.
Der Sieg war vollständig, die Beute unermesslich. Auf dem Schlachtfeld wurde der Held jubelnd als Oberhaupt von Griechenland begrüßt. Nach dem festlichen Einzug in die Hauptstadt schritt man zu Gericht über Sabene und die königlichen Brüder. Ersteren traf das Todesurteil, und er wurde sogleich fortgeführt. Dann ging es aber um dessen Gönner: Volk und Heer verlangten den Tod der beiden Könige. Auch der Tod seiner Mutter, des alten Meisters, seine eigenen Mühseligkeiten forderten das Blut derjenigen, die das alles verschuldet hatten. Dennoch konnte Wolfdietrich keinen Entschluss fassen und verschob das Urteil auf den folgenden Tag.
Der Sieger ruhte auf seinem Lager von den Kämpfen des Tages. Er schlief den Schlaf der Gerechten, und im freundlichen Traumgesicht sah er seine Mutter, verklärt wie eine Heilige, die sprach: „Schone meine Kinder, dann wird mein Segen auf dir ruhen.“ Darauf erschien auch der ehrwürdige Meister und sagte, die Hand zum Himmel erhebend: „Gott erbarmt sich der verirrten Kinder. Vergieße kein Bruderblut!“ Wie der Held noch staunend auf die Erscheinung blickte, trat auch Liebgart sanft und freundlich hinzu: „Hast du nicht Reich und Ruhm und mich selbst durch die Untat deiner Brüder erworben? So vergilt Übeltat mit Wohltat.“ Der Morgen brach an und das Traumbild verschwand, aber Wolfdietrich hatte seinen Entschluss gefasst. Er berief die Fürsten und Edlen des Heeres, ließ die Gefangenen vorführen und sprach das Wort der Gnade über die Könige, seine Brüder, und setzte sie wieder in ihre Würden und in den Besitz ihrer Länder ein, aber unter des Oberhauptes Lehnsherrschaft. Als er den Spruch getan hatte, grollte dumpfes Murren durch die Reihen. Und Hache (Rache), der Rasche, voll Zorn über die erlittene Misshandlung, verlieh dem Murren Worte. „Wer“, rief er, „wer wird künftig Empörung, Meuterei und Raubtat niederwerfen, wenn dafür Ehren und fürstliche Würden zugeteilt werden?!“ - „Sieh her!“, antwortete Wolfdietrich, und das Schwert Rosen flammte in seiner Hand: „Das zwingt Aufruhr und Widerspruch, wo und wie er sich erhebe. Das Recht der Gnade steht dem Herrscher zu, der seiner Macht vertrauen darf, und das übe ich an meinen Brüdern.“ Da wurde es in den Reihen der Fürsten still, und er ließ den Brüdern die Fesseln abnehmen, umarmte und belehnte sie mit ihren Ländern.
Als das Reich geordnet war, fuhr Wolfdietrich mit dem Heer nach Lombardenland zurück. Er wurde mit großem Jubel empfangen, am freudigsten von Liebgart, die bisher in Furcht und Sorge um ihn gelebt hatte. Die Fürsten nebst ihren Mannen führten ihn daraufhin nach Rom, wo er zum Kaiser gekrönt wurde. Bei dem Fest, welches der Krönung folgte, erteilte er den Söhnen des lieben alten Meisters ansehnliche Lehen. Herbrand, der älteste, erhielt die Stadt Garden nebst dem dazugehörigen Gebiet. Er wurde der Stammvater des berühmten Geschlechts der Wölflinge durch seinen Sohn Hildebrand, von dessen vielbesungenen Taten die Sage in der Folge berichten wird. Hache, der kühne Held, wurde mit dem Gebiet am Rhein begabt, nahm seinen Sitz zu Breisach, und dessen Sohn Eckehart wurde zum getreuen Pflegevater der Herlungen-Söhne Imbreke und Fritele. Berchther, der dritte Sohn, wurde mit dem väterlichen Besitztum Meran belehnt. Und die übrigen Abkömmlinge des alten Meisters wurden in ähnlicher Weise bedacht. Diese und andere Helden umgaben den Thron des Kaisers, der nach der langen und schweren Prüfungszeit im Frieden in seinen Reichen waltete und auch in seinem Hauswesen glücklich war, indem er mit der schönen Liebgart einen Sohn und eine Tochter gewann. Die Tochter nannten sie nach ihrer Mutter Sidrat, und den Sohn nach seinem Großvater Hugdietrich, weil er ihm an Körper und Geist ähnlich war. So regierte Wolfdietrich als Kaiser über 20 Jahre ein friedliches Reich in einer goldenen Zeit. Selbst die Natur zeigte sich freundlich, es gab keine Missernten, keine Hungersnöte, keine Seuchen oder verheerenden Kriege. Alles schien sich wie von selbst zu klären, und die Menschen lebten glücklich und zufrieden miteinander. Tochter Sidrat und Sohn Hugdietrich wuchsen zur großen Freude ihrer Eltern heran. Der Junge strebte seinem Vater und Großvater nach, wurde bald ein kräftiger Held, von Herbrand, dem ältesten Sohn von Berchtung, in der Waffenkunst ausgebildet und danach zum Ritter geschlagen. In vielen Kämpfen zeigte er seinen Mut, seine Kraft und Überlegenheit. Auch die Tochter lernte viel von ihrer Mutter, übertraf sie bald an Schönheit, und als sie ins heiratsfähige Alter kam, wurde sie glücklich verheiratet. So verging die Zeit, und das Alter forderte seinen Tribut in der Welt der Sterblichen. Die Kaiserin starb in den starken Armen von Wolfdietrich, der diesen Kampf nicht gewinnen konnte. Er trauerte ein langes Jahr, und dann verkündete er seinen Rückzug in ein Kloster. Er ernannte seinen Sohn zum König der Lombarden, und als ihn die Obersten im Reich von seinem Rückzug nicht abbringen konnten, wurde Hugdietrich auch zum neuen Kaiser in Rom ernannt.
Wolfdietrich packte sich die Mönchskutte ein, die er damals vom Einsiedler bekommen hatte, bestieg sein treues Pferd und ritt allein, wie ein Pilger ohne Gefolge, nach Norden durch sein Reich. In allen Dörfern, Städten und Burgen wurde er mit Freude empfangen, und zum Abschied lief manche Träne. So kam er an den Rand der Alpen und stand unversehens am Fuß jener Linde, wo er einst gegen den Drachen gekämpft hatte. Die Vögel zwitscherten fröhlich in den Zweigen, Blütenduft lag in der Luft, Blumen blühten auf der grünen Wiese, und alles atmete wonnevollen Frieden und Ruhe. Hier ließ er sein Pferd frei grasen, und als er sich unter dem freundlichen Schatten der Linde niederließ, um sich von der beschwerlichen Reise auszuruhen, erschien ihm kein Lindwurm mehr, sondern jenes Riesenweib, das ihm damals, als er im Süden auf dem Festland ankam, die Geschichte von Kaiser Ortnit erzählt und ihn dann nach Norden getragen hatte. Auch jetzt kannte sie das Ziel seiner langen Reise und wusste, wie erschöpft er war, so dass sie ihre Hilfe anbot. Dazu berichtete sie ihm von einem weitabgelegenen Kloster am Rande des Christenreiches, das dem Heiligen Georg geweiht war, und bot sich an, ihn dahin zu tragen. Er schaute sie einige Zeit nachdenklich an, dann fragte er: „Warum Sankt Georg?“ Da begann das Riesenweib unter der Linde zu erzählen:
Georg wurde vor langer Zeit im Land der Griechen in einer edlen christlichen Familie geboren, aber als ein kränkliches Kind, das sein Vater so schnell wie möglich taufen ließ. Doch er überlebte, widmete sich dem höchsten Gott und wurde ein starker Ritter im Kampf um das Christentum. Manche Marter hatte er überstanden, und man berichtet: Er wurde von seinen Feinden gebunden, doch von Christus wieder erlöst. Er wurde von seinen Feinden enthauptet, doch von Gott wieder ganz gemacht, und er wurde von seinen Feinden gevierteilt, doch die Engel hatten ihn wieder zum Leben erweckt und zu vollkommener Schönheit geheilt. Eines Tages gelangte er auf seiner Reise an einen großen See, wo er eine weinende Jungfrau erblickte, die königliche Kleider und eine Krone trug. In diesem See, der so tief wie ein Meer war, wohnte ein giftiger Drache, der bisher unbesiegbar war und alle Angreifer getötet oder in die Flucht getrieben hatte. Wenn er hungrig wurde, kam er aus dem See und verpestete mit seinem Gifthauch Land und Leute. Der König und das Volk fanden keinen anderen Rat, als ihm jeden Tag zwei Schafe zu opfern. Doch als es keine Tiere mehr in den Dörfern gab, waren sie gezwungen, auch ihre Kinder zu opfern, damit der Drache nicht alle tötete. Das Los entschied, und bald traf es auch des Königs Tochter, sein einziges und über alles geliebtes Kind. Da wurde der König traurig und sprach: „Nehmt mein Gold und Silber und die Hälfte meines Königreiches, aber lasst mir meine Tochter, dass sie nicht so jämmerlich sterbe.“ Darüber erzürnte das Volk, und sie sprachen: „Oh König, du selbst hast das Gebot gegeben. Wir mussten alle unsere Kinder verlieren, und du willst deine Tochter behalten?“ Als der König ihren Ernst sah, begann er, seine Tochter zu beklagen und sprach: „Weh mir, mein Kind, was soll ich mit dir tun, was soll ich sprechen? Ach, nimmer werde ich deine Hochzeit sehen und einen königlichen Erben bekommen.“ Doch sie fiel zu des Vaters Füßen nieder und bat um seinen Segen. Den gab er ihr unter Tränen, und dann ging sie hinaus zum See. Da kam der Heilige Georg geritten, und als er sie weinen sah, trat er zu ihr und fragte nach dem Grund. Sie antwortete: „Guter Jüngling, steige schnell auf dein Ross und fliehe, oder du wirst mit mir verderben.“ Darauf sprach er: „Fürchte dich nicht, sondern sage mir, worauf du hier wartest unter den Augen des Volkes?“ Da erzählte sie ihm alles, und er sprach: „Liebe Jungfrau, sei ohne Furcht, ich will dir helfen im Namen Christi.“ Während sie noch redeten, hob der Drache sein Haupt aus dem See. Die Jungfrau zitterte vor Schrecken und rief: „Flieh, guter Herr, flieh so schnell du kannst!“ Aber Georg sprang auf sein Ross und ritt gegen den Drachen, der ihn angreifen wollte. Er schwang seinen Speer mit großer Macht, befahl sich Gott, und traf den Drachen so schwer, dass er zu Boden stürzte.

Der Heilige Georg besiegt den Drachen, Johann König, um 1600
Dann sprach er zur Jungfrau: „Nimm deinen Gürtel, wirf ihn dem Wurm um den Hals, und fürchte nichts!“ Sie tat es, und der Drache folgte ihr nach wie ein zahmes Hündlein. Als sie ihn nun in die Stadt führte, erschrak das Volk und floh auf die Berge und in die Höhlen und sprach: „Weh uns, nun sind wir alle verloren.“ Da winkte ihnen Sankt Georg und rief: „Fürchtet euch nicht, denn Gott der Herr hat mich zu euch gesandt, dass ich euch von diesem Drachen erlöse. Darum glaubt an Christus und den einigen Gott, dann will ich diesen Drachen erschlagen.“ Da ließ sich der König taufen und alles Volk mit ihm, und Sankt Georg zog sein Schwert und erschlug den Drachen. Der König war überglücklich, sein Volk befreit und seine Tochter gerettet zu haben, ließ zu Ehren der Jungfrau Maria und Sankt Georg eine schöne Kirche bauen, und auf dem Altar entsprang ein lebendiger Quell, der alle Kranken heilte, die daraus tranken. Die Jungfrau hätte ihren Retter gern geheiratet, doch Sankt Georg zog weiter, denn er hatte seine Aufgabe erfüllt und seinen Segen zurückgelassen. So entstand, wie ich vernahm, an jenem See am Rande des Christenreiches später auch ein Kloster, das dem Heiligen Georg geweiht wurde. Wenn du willst, bringe ich dich dahin.
Soweit erzählte die Riesin, und mehr wollte Wolfdietrich auch nicht wissen. Er kannte nun sein Ziel und war bereit für die Reise. Sein treues Pferd, das auch alt und müde geworden war, ließ er unter der Linde zurück, und das Riesenweib versprach, es gut zu versorgen. Dann trug sie ihn so schnell wie der Wind in das weitentfernte Kloster, wo er die Mönchskutte des Einsiedlers anzog. Seine Rüstung und seine Waffen opferte er auf dem heiligen Altar, mit dem Wunsch, sie wieder zu empfangen, wenn es nötig ist. Doch auf wundersame und unerklärliche Weise waren sie nach einiger Zeit vom Altar verschwunden. Manche sagen, der Zwergenkönig habe sie sich zurückgeholt, andere sprechen von einem Engel oder Gott selbst. Der Abt des Klosters freute sich über den neuen Bruder und wollte ihn auch besonders ehren, doch Wolfdietrich forderte gleiche Speise und Ehre für alle Ordensbrüder. Er sprach: „Gleiche Brüder und gleiche Kappen, gleiche Speise und gleiche Ehre für ein göttliches Leben zur Freude Gottes!“ Als sich daraufhin einige Brüder von edler Abstammung darüber beschwerten, band er sie mit ihren langen Bärten zusammen und hing sie über eine Stange, bis sie sich fügten. So lebte er im Kloster, gewann noch manchen Kampf um das Kloster und den Christenglauben, doch vor allem in seinem Inneren, denn all die Geister der im Kampf Getöteten begegneten ihm wieder und forderten seine Buße als Sühne für die Sünde. Dazu ließ er sich eine Bahre in das Münster vor den Altar stellen und kämpfte tapfer.
Die alten Feinde kamen herbei in breiter Schar:
Ein Jeder wollt es rächen, der ihm erlegen war.
So kam er durch sie alle während der Nacht in große Not,
Denn die da mit ihm fochten, sie vergingen nicht im Tod.
So trieb es Wolfdietrich eine winterlange Nacht,
Mit ungezählten Toten focht er in heißer Schlacht.
Vor Müde wie vor Hitze ward dem Helden weh,
Das Haar auf dem Haupte ward ihm so weiß wie Schnee.
Am Morgen, da die Mönche zur Mette wollten gehn,
Da sahen sie im Münster, wie dem Bruder war geschehn.
Ihm war der Sinn geschwunden, er lag im Chor wie tot;
Da hatten Abt und Mönche vor Schrecken große Not.
Sie hoben ihn vom Boden: da war er noch warm;
Ihn trugen nicht die Füße, der Abt bot ihm den Arm.
Doch kam er bald zu Kräften, ein Trank hatte ihn erlabt:
„Wir loben Gott im Himmel, wenn Ihr gebüßet habt.“
Da lebte er im Kloster hernach noch sechzehn Jahr,
Und diente treu dem Herrn, sagt uns das Buch fürwahr.
Dann trugen Engelhände zu Gott ihn sicherlich,
Hier hat das Buch ein Ende und heißt Wolfdieterich.
(Nach: Das kleine Heldenbuch, Karl Simrock, 1859)
Kaiser Dietwart
So lebte und herrschte Hugdietrich in der Weltstadt Romaburg als Kaiser, der vom Volk und seinen Freunden auch Dietwart (der „Diener des Volkes“) genannt wurde. Er war schon in früher Jugend durch kühne Heldentaten berühmt geworden, so dass man in allen Landen seinen Namen kannte und ehrte. Er sandte nun Botschaft an König Ladmer in Westenmer und ließ um dessen Tochter, die vielgepriesene Minne, werben. Die Recken, die den Auftrag bekamen, fuhren fort über das Meer und traten nach glücklicher Fahrt vor den Herrscher, den seine Hofleute umgaben. Als sie geziemend ihren Antrag vorgebracht hatten, sagte der König, das Begehren des Kaisers von Romaburg gereiche ihm zu großer Freude und Ehre, doch möge der edle Freier selbst nach Westenmer fahren, um zu erkennen, ob die Jungfrau der Ehre wert sei und ob sie die Werbung annehme, da er nicht willens sei, der Jungfrau Zwang anzutun. Mit diesem Bescheid kehrten die Boten zu ihrem Herrn zurück. Dietwart ließ sogleich ein Schiff ausrüsten und trat in Begleitung von hundert seiner kühnsten und getreuesten Helden die Fahrt an. Er hatte viel Not durch Sturmwetter zu erdulden, doch gelangte er endlich an das Ziel seiner Wünsche.
König Ladmer empfing den hohen Gast seinem Rang gemäß. Er ließ ihn neben sich den Thron einnehmen und ihn wie seine Recken mit Speisen und edlem Wein erquicken. Er wiederholte ihm aber auch, was er schon den Boten gesagt hatte, dass er sich die Liebe der Jungfrau erwerben müsse, sofern er Wohlgefallen an ihr finde, und dass er ihr deshalb noch nichts von der Werbung mitgeteilt habe. Am folgenden Tag war ein großes Festmahl. Da saß Dietwart in unscheinbarem Gewand unter seinen Recken, und die königliche Jungfrau schenkte nach alter Sitte den Wein. Als sie zu den fremden Gästen kam, wusste sie nicht, wem sie zuerst den Becher bieten sollte. Doch ihre Wahl war bald getroffen, denn sie trat vor Dietwart, den seine hohe Gestalt, seine blonden Locken und die fürstliche Haltung auszeichneten. Er leerte den Becher auf ihr Wohl. Sie aber dankte züchtig und kehrte zum Vater zurück, der das alles mit Freuden wahrgenommen hatte. Am Abend, als sich die Gäste verabschiedet hatten, sagte er ihr, der Fremdling, den sie zuerst geehrt hatte, sei der mächtige Kaiser von Romaburg, und derselbe begehre sie zur Ehegemahlin. „Ja“, sagte sie, „er scheint wohl ein großer Herrscher, aber ich weiß nicht, was er für Sitten hat, und es könnte mir im fremden Land übelergehen. Ich will lieber in der Heimat, im Vaterhaus bleiben.“ Der gütige Vater sagte darauf nichts, er küsste die Tochter auf die Stirn und entließ sie.
Die Hörner klangen, die munteren Hunde zerrten an den Leinen, die Jäger standen mit ihren Waffen und Fangeisen in Bereitschaft. Eine große Jagd sollte abgehalten werden, denn das Wild tat viel Schaden in den Feldern, und etliche Bauern hatten sogar ihr Leben eingebüßt. Man erzählte auch, es sei ein grauenhaftes Ungetüm aus dem Meer hervorgestiegen, das sei unten wie ein Mensch gestaltet, habe aber oben Hals, Kopf und Rachen wie ein Lindwurm und an den Händen lange Krallen. Der König hielt den Bericht für ein Märchen furchtsamer Leute, doch wollte er den Wald durchstreifen, weil sich selbst in der Nähe der Burg Spuren von Wölfen gezeigt hatten. Als indessen auch seine Tochter, mit Speer, Bogen und Weidmesser bewaffnet, im Gefolge mehrerer Gefährtinnen dem Jagdzug sich anschließen wollte, hieß er sie davon abstehen, weil sie in Gefahr geraten könne. Sie bat indessen dringend, er möge ihr die Jagdlust nicht verweigern, und versicherte, sie könne so gut wie die Jagdgesellen den Bogen spannen. Da gab er, wie gewöhnlich, ihren Bitten nach. Dem Kaiser Dietwart gefiel das Gebaren der kühnen Jungfrau wenig. Er sagte zu seinen Recken, dem Weibe stehe besser an, wenn es die Spindel, anstatt Bogen und Wurfspeer führe, und er wolle sich doch lieber eine Genossin unter den Fürstentöchtern der Heimat erwählen, die an friedliches Gewerbe gewöhnt und nicht minder lieblich seien als die kühne Jägerin. Indessen sei es doch seine und der tapferen Recken Pflicht, wohl achtzuhaben, dass der Königstochter kein Leid geschehe. Er folgte demnach ihren Schritten während der Jagd und bewunderte die Jungfrau, wie sie gewandt und flüchtig bald zu Ross, bald zu Fuß das scheue Wild verfolgte, wie sie geschickt den Bogen spannte und die tödlichen Pfeile versandte.
In einem engen Felsental hatte Jungfrau Minne einen stattlichen Hirsch mit sicherem Pfeil getroffen. Die Hunde verfolgten das Tier, auch die Gefährtinnen der Königstochter eilten nach, während diese den Köcher ordnete und einen weiteren Pfeil herausnahm. Da heulten plötzlich die Jagdhunde und stürzten, wie von Schrecken ergriffen, aus dem jenseitigen Dickicht hervor und an der Jägerin vorbei. Ihnen nach kamen eiligen Laufes die Mädchen, um Hilfe schreiend und ihre Herrin zur Flucht mahnend. „Der Wurm!“, riefen sie, „Der Linddrache! Das höllische Ungeheuer!“ Sie flohen über den Wiesengrund einem steilen Hügel zu, der sich im Hintergrund erhob. Jetzt rauschten die Büsche, Sträucher und Bäume stürzten krachend, und hervor brach der Unhold von scheußlichem Ansehen. Ein Zischen und Stöhnen drang aus dem weit geöffneten Rachen hervor, das selbst kühne Helden mit Schrecken erfüllen konnte. Jungfrau Minne schoss drei Pfeile wohlgezielt auf das Untier, aber sie sprangen von der Hornhaut wie von einer Felswand zurück. Als sie sich daraufhin zur Flucht wandte, strauchelte ihr Fuß und sie stürzte zu Boden. Sie schien verloren, eine Beute des Drachen, der grimmig auf sie zukam. Doch Dietwart war mit seinen Recken in der Nähe, und diese drangen auf den Wurm los, während er sich selbst vor die Jungfrau stellte. Ein entsetzlicher Kampf begann. Die Recken griffen den Feind von allen Seiten an, aber die Speere, Lanzen und Schwerter prallten von der Hornhaut zurück oder zersprangen in Stücke. Dagegen schlug das Untier mit den Tatzen manchen tapferen Helden und zerbiss andere mit den Zähnen, die fast wie Schiffsanker gebogen und geformt waren. Da stürmte Dietwart seinen Getreuen zu Hilfe. Er zielte mit der Lanze nach dem Hals des Wurmes, aber der Stoß glitt ab, und der Drache zerriss ihm mit der Tatze die Brust. Dann wollte ihn der Drache mit den Zähnen fassen und sperrte den Rachen weit auf. Diesen Augenblick erspähte der Held, stieß ihm den Speer in den gähnenden Schlund und drängte mit aller Kraft nach, dass die Spitze auf der anderen Seite wieder hervordrang. Ein Strom von Gift und lodernder Glut quoll dem Sieger entgegen. Er stürzte ohnmächtig zu Boden, und das Ungetüm unter Todeszuckungen über ihn her.

Heftiges Rütteln und Schütteln erweckte den Helden aus seiner Betäubung. Er sah, als er die Augen aufschlug, wie Jungfrau Minne bemüht war, den Riesenleib von ihm abzuwälzen. Die Recken und Weidleute kamen zu Hilfe, so dass er endlich frei wurde. Er fühlte sich aber völlig entkräftet und musste auf einer aus Zweigen geflochtenen Trage zum Königshof getragen werden. Hier wurde die Brustwunde sorgfältig verbunden. Sie schien ungefährlich, denn nur das Fleisch war von der Kralle zerrissen, aber sie eiterte fort und die Ränder wurden schwarz, wie von innerem Brand. Die Ärzte erklärten, es sei das Gift von dem Hauch des Drachen hineingedrungen und fürchteten um das Leben des Helden. Der König, die Hofleute, ja Stadt und Land waren in tiefer Trauer, da der tapfere Mann sie alle von großer Bedrängnis befreit hatte.
Eines Morgens lag Dietwart in Schmerzen und angstvollen Fieberträumen auf seinem Bett, da fühlte er eine Hand an seiner Wunde beschäftigt, die ihm weicher und sanfter erschien, als die des Arztes. Er schlug die Augen auf und erkannte die Königstochter, wie sie die Binden vorsichtig löste und aus einem Fläschchen eine Flüssigkeit in die Wunde tropfte. Der brennende Schmerz ließ sogleich nach. Er wollte reden, seinen Dank aussprechen, aber sie legte die Hand auf den Mund. Nachdem sie den Verband wieder angelegt und den Wärtern gleichfalls durch Zeichen Stillschweigen geboten hatte, entfernte sie sich leisen Schrittes, wie sie gekommen war. Es war dem wunden Mann so wohl, als habe ihm ein Engel vom Himmel den Kelch der Genesung gereicht. Er fiel in einen ruhigen Schlummer, und erst in der Nacht fühlte er wieder Schmerzen. Doch des Morgens stand die Engelserscheinung abermals an seinem Lager und träufelte Balsam in die Wunde, und so kam die Jungfrau auch am dritten Morgen. Da fühlte er sich wunderbar gekräftigt. Er ergriff ihre Hand und führte sie an seine Lippen. Sie aber entzog ihm dieselbe und wiederholte, sich entfernend, das Zeichen des Schweigens. Der Arzt freute sich über die rasch fortschreitende Genesung. Als er aber erfuhr, was sich zugetragen hatte, sagte er, die königliche Jungfrau habe den wundertätigen Balsam von ihrer Mutter auf dem Sterbebett erhalten, aber sie dürfte ihn nur im äußersten Fall bei Menschen anwenden, die sie von Herzen liebe, und sie müsse dabei das tiefste Schweigen bewahren.
„Bei Menschen, die sie liebt!“, wiederholte der Held und fühlte sich recht glücklich durch diese Worte. Als er ihr darauf nach völliger Genesung lustwandelnd im Garten begegnete, da sprach er von seiner Liebe, die Hände und die Herzen fanden sich zusammen, und der gute König Ladmer trat hinzu und segnete seine Kinder. Bald wurde das Hochzeitsfest gefeiert. Da stand auf der geschmückten und reich besetzten Tafel in Silber gefasst ein Zähnchen des Linddrachen, und das wog nicht weniger als einen halben Zentner.
Die beiden Ehegatten traten bald die Fahrt nach Romaburg an. Wind und Wellen waren günstig, so dass sie ohne weitere Gefahren und Abenteuer das Vaterland Dietwarts erreichten. Sie lebten in glücklicher Ehe, ihre Herrschaft war tugendhaft und friedlich, und so regierte Dietwart über dreißig Jahre als römischer Kaiser. Mit Gottes Hilfe war es ihm möglich, reichen Besitz, Ehre und die Macht eines Siegers zu erhalten. Dietwarts Tugendhaftigkeit, Reinheit und höfische Sittlichkeit wurden zum Ideal für die höfische Gesellschaft. Solange diese befolgt wurden, lebte auch das ganze Volk glücklich und zufrieden. Dietwart und Minne erfreuten sich als Kaiserpaar eines langen Lebens auf Erden und bekamen viele Kinder. Ihr ältester Sohn hieß Siegher, und der setzte auch ihr Erbe fort. Man sagt, er heiratete Amelgart aus der Normandie, und sie hinterließen zwei Kinder, einen Sohn, den sie wieder Ortnit (oder auch Amelung?) nannten, und eine Tochter namens Sieglinde. Sie heiratete König Siegmund, der sie in die Niederlande führte. Ihr gemeinsamer Sohn war dann der berühmte Siegfried, der Drachentöter und Held der Nibelungen. Und damit endet die Sage von Hugdietrich.
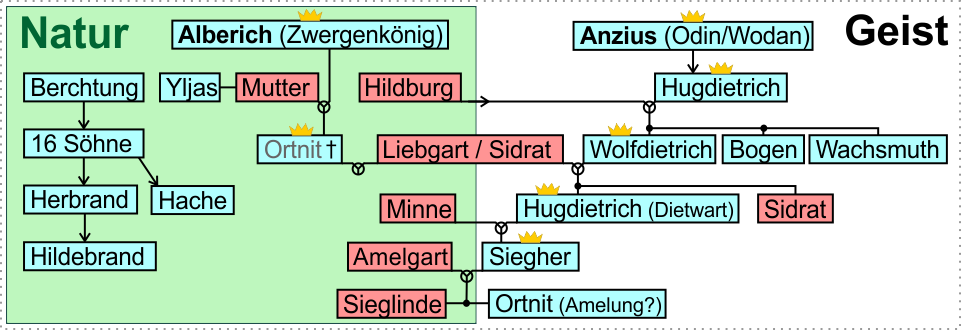
Weiter zur Dietrichsage
